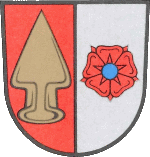In gespaltenem Schild vorne in Rot eine gestürzte goldene Pflugschar, hinten in Silber eine blau besamte rote Rose mit grünen Kelchblättern.
Die Besitzbestätigung der „Burbacher mulin“ für Frauenalb durch Otto von Eberstein und Heinrich von Roßwag im Jahre 1255 ist zwar das erste urkundliche Zeugnis über Burbach, das Dorf ist jedoch bereits einige Jahrzehnte früher durch die Grafen von Malsch oder im Zuge der Ausweitung der ebersteinischen Herrschaft in dem zur alten Ettlinger Großmarkt gehörenden Waldgebiet gegründet worden. Eine Burg, auf die der Ortsname in seiner alten Form „Burkbach“ hinzudeuten scheint, kann nicht nachgewiesen werden, doch ist 1404 ein zuvor ebersteinischer Sitz bezeugt. In das 1896 geschaffene Wappen von Burbach ist zur Erinnerung an die historische Bedeutung des Geschlechts der Ebersteiner für den Ort, neben der Pflugschar, dem vereinfachten alten Fleckenzeichen, die ebersteinische Rose aufgenommen.
1287 übertrug Heinrich I. von Eberstein den Ort und seinen dortigen Besitz zu seinem Seelenheil an das Kloster Frauenalb. Von diesem Zeitpunkt an hatte das Kloster bis zur Säkularisation 1802/03 die Ortsherrschaft über Burbach mit allen Rechten, dem Genuss eines Teils des Zehnten und Einkünften aus verpachteten Liegenschaften inne. Die Dorfverwaltung, bestehend aus dem vom Kloster ernannten Schultheiß und sechs Richtern (die Richter entsprechen etwa den heutigen Gemeinderäten), ist seit 1402 nachgewiesen. Burbach teilte die politischen Schicksale der gesamten Klosterherrschaf, auch die Bedrückungen in Kriegszeiten. Das im 16. Jahrhundert neu erbaute Pfarrhaus brannte im Dreißigjährigen Krieg „mit dem gesamten Dorf mit Sumpf und Stiehl“ ab. An das von Erzherzog Karl von Österreich verhinderte Vordringen des französischen Revolutionsheeres im Jahre 1796 erinnert der Gedenkstein an der Straßenschleife im Albtal.
Das Verhältnis der Burbacher zu ihrer Ortsherrschaft war nicht immer spannungsfrei. 1712 lehnten sie sich wegen der Frondienste auf, 1772 wegen der Zehntabgaben und der 1797 aus demselben Grund ausgebrochene Konflikt musste gar durch ein Husaren-Exekutions-Kommando des Markgrafen Karl Friedrich niedergeschlagen werden. Durch die Jahrhunderte bildete die Landwirtschaft die Haupterwerbsquelle der Bevölkerung. Daneben spielten die Waldgewerbe (z.B. Kohlebrennen) eine Rolle. Mit der Industrialisierung unseres Raumes entwickelte sich Burbach zur Pendlerwohngemeinde, die freilich im Kern ihr bäuerliches Erbe bewahrt hat. So ziert eines der ältesten Fachwerkhäuser des Albtals aus dem Jahre 1688 die Pfarrgasse. Die Kirche, ein neugotischer Bau des Jahres 1844, beherrscht auch heute noch das Bild des Ortes.
Zur alten Gemarkung Burbach gehören die im Moosalbtal gelegene Weimersmühle und der Metzlinschwander Hof. Die Weimersmühle, die seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts bezeugt, mit Sicherheit jedoch älter ist, war die Bannmühle für das ebenfalls dem Kloster Frauenalb gehörende Völkersbach.
In Gold auf blauem Vierberg ein stehender blau bezungter und rot gekrönter roter Löwe.
Der Ortsname, in den ältesten schriftlichen Zeugnissen „Phaffinrode“ und „Pfaffenrode“ geschrieben, lässt deutlich den Ursprung der Siedlung erkennen: Geistliche rodeten im Mittelalter auf der Höhe östlich der Alb oder ließen hier den Wald roden und das Land urbar machen. Der Anstoß dazu ging wahrscheinlich von Marxzell aus, noch bevor die Herren von Eberstein in unserem Gebiet Fuß fassten. Ein Fingerzeig auf die ältesten Besitz- und Herrschaftsverhältnisse könnte der Verkauf „gewisser Güter in Pfaffenrot, genannt Gasteleßgut“, 1262 durch Heinrich, genannt Hoteli und seinen Sohn Berchtold an das Kloster Frauenalb sein. Die Verkäufer waren nämlich Lehensleute der Grafen von Vaihingen, die Grafen hatten also zumindest über Teile des Ortes die Lehenshoheit inne (als Gemeindewappen wurde daher im Jahre 1900 das Wappen der Grafen von Vaihingen gewählt). Im späten 12. Jahrhundert hat das Dorf wohl zum ebersteinischen Ausstattungsgut des Klosters Frauenalb gehört.
Für eine frühe Verbindung mit dem Kloster spricht die Heranziehung des Pfaffenroter Schultheißen Konrad als Zeuge bei der Besitzbestätigung der Burbacher Mühle für Frauenalb im Jahre 1255. Diese Urkunde ist der älteste schriftliche Hinweis auf Pfaffenrot selbst und zugleich auf das Vorhandensein einer Dorfverwaltung. Die Äbtissin von Frauenalb war bis 1802/03 „von wegen des Klosters rechte Herrin“ über das Dorf.
Das Kloster erhielt die üblichen Abgaben und Steuern, der gesamte Wald auf Pfaffenroter Gemarkung war Klostereigentum.
Die Wendelinuskapelle im Zentrum des Ortes besteht schn seit dem 16. Jahrhundert und erhielt 1770 im Wesentlichen ihre heutige Gestalt. Der Wunsch nach einer eigenen Pfarrei und einer Kirche im Ort, der seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr verstummte, erfüllte sich nach dem zweiten Weltkrieg. 1952 wurde die weitgehend in Eigenarbeit der Bevölkerung gebaute St.-Josef-Kirche geweiht.
In Silber auf grünem Boden eine grüne Tanne.
Schielberg ist der höchstgelegene Ortsteil der Gemeinde Marxzell. Im Süden der Gemarkung steigt das Gelände auf nahezu 560 m NN an. Das ist die zweithöchste Erhebung im gesamten Landkreis Karlsruhe. Die Schwarzwaldlage soll durch die Tanne im Ortswappen, das seit 1902 geführt wird, zum Ausdruck gebracht werden.
Auch Schielbergs erste schriftliche Erwähnung und die seines Schultheißen Albert findet sich in der die Burbacher Mühle betreffenden Urkunde von 1255. Der Name des natürlich schon älteren Ortes lautet in seiner frühestens Form „Scuhelberg“ und wurde bis in jüngere Zeit „Schillberg“ geschrieben. Er konnte bisher nicht zweifelsfrei gedeutet werden. Der Ort gehörte wahrscheinlich zum ersten Ausstattungsgut Eberhards III. von Eberstein für das Kloster Frauenalb, das also zur Zeit der Ersterwähnung Schielbergs schon die Ortsherrschaft innehatte.