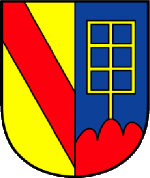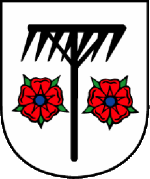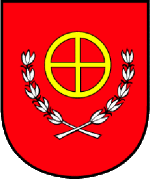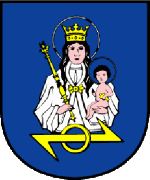In gespaltenem Schild vorne in Gold ein roter Schrägbalken, hinten in Blau aus rotem Dreifels wachsend ein goldener Rost.
Rotenfels, das 1041 erstmals urkundlich erwähnt ist, kann auf eine reichhaltige Geschichte zurückblicken. Von hier aus wurde das Murgtal buchstäblich christianisiert, denn in Rotenfels stand die erste Pfarrkirche der Region. Doch reichen die ersten Besiedlungsspuren noch viel weiter zurück bis ins frühe Mittelalter. Selbst auf die Römerzeit deuten Funde zurück, obschon eine direkte Linie zwischen der Antike und dem späteren Rotenfels nicht zu ziehen ist. Bei Winkel, das 1102 erstmals urkundlich erwähnt ist und zu Rotenfels gehört, reichen Lebensspuren gar bis in die mittlere Steinzeit zurück. Damit ist bewiesen, dass die roten Felsen, die Rotenfels den Namen geben, seit Urzeiten begehrter Siedlungsort sind.
Es gab Zeiten, da gehörten zur Pfarrei Rotenfels Forbach, Weisenbach, Gernsbach, Selbach, Ottenau, Michelbach, Sulzbach, Gaggenau und Bischweier. Erst als die Besiedelung immer weiter ins Murgtal vordrang, emanzipierten sich die wachsenden Orte von der Mutterpfarrei Rotenfels und wurden eigenständig. Ursprünglich gehörte Rotenfels zum Domstift Speyer, wechselte dann zu den Ebersteiner Grafen und dann zu den Markgrafen von Baden. Nachdem das markgräfliche Amt Kuppenheim für Rotenfels zuständig war, ging der Stab schließlich an das Oberamt Rastatt. Seit 1970 ist Rotenfels Stadtteil Gaggenaus. 1972 übernahm die Thermalstätte den schmückenden, ehrenvollen Titel „Bad“. Heute zählt Rotenfels 4.750 Einwohner.
Wirtschaftlich potent ist Rotenfels seit dem Mittelalter. Mühlen unterschiedlicher Art sind hier seit frühen Zeiten nachweisbar. So gab es Getreide-, Öl- und Sägemühlen. Die Fischerei spielte eine große Rolle. In der Frühindustrialisierung des 18. Jahrhunderts wurde in Rotenfels Eisenerz geschmolzen, um Nägel, Ringe, Gitter, Pflugscharen, Öfen, Pfannen und Löffel zu fertigen. Auch Steingeschirr wurde vorübergehend hergestellt. Doch nun zum Wappen, von dem an dieser Stelle die Rede sein soll.
Wir sehen einen gespaltenen Schild. In der linken Hälfte verläuft ein roter Schrägbalken von links oben nach rechts unten, während der Hintergrund golden ist. Damit ist die vormalige Zugehörigkeit zur Markgrafschaft Baden-Baden dokumentiert. In der rechten Hälfte des Wappens wächst aus drei roten Felsen (Reminiszenz an den Ortsnamen) ein goldener Rost. Der Hintergrund ist blau. Damit spricht das Wappen von einer räumlichen wie geistigen Prägung: Rotenfels ist badisch und christlich. Denn der Rost, der aus den roten Felsen ragt, ist das Kennzeichen des heiligen Laurentius, nach dessen Namen die Pfarrkirche vor Ort benannt ist.
Laurentius gehörte zu den frühen Christen in Rom. Er war ranghoher Mitarbeiter des Papstes Sixtus II., den Kaiser Valerian enthaupten ließ. Als der Imperator die Herausgabe des Kircheneigentums forderte, verteilte Laurentius das Vermögen an die Armen und Kranken mit dem Hinweis, diese seien der wahre Reichtum der Kirche. Das mutige Zeugnis von Laurentius erzürnte den römischen Gewaltherrscher dermaßen, dass er den Kirchenvertreter schlimm foltern ließ und auf einem Rost den Flammen übergab. So ist Laurentius mit dem Rost in die Kirchengeschichte und ins Rotenfelser Wappen eingegangen.
In seiner heutigen Form geht das Rotenfelser Wappen auf das 15. Jahrhundert zurück. Im 19. Jahrhundert war der badische Bezug vorübergehend aus dem Wappen verbannt. Dafür wurde der Rost von Lorbeeren umkränzt. 1901 kehrte die Gemeinde auf Vorschlag des Generallandesarchivs Karlsruhe allerdings zu ihren heraldischen Ursprüngen zurück. Der Kreis war geschlossen, und Rotenfels brach in die Zukunft auf, ohne eine seiner beiden Traditionen zu verleugnen – die Verwurzelung im Badischen und im Christlichen.
In Silber ein schwarzer Rechen, begleitet von zwei blau besamten roten Rosen.
Freiolsheim ist mit 495 Metern überm Meeresspiegel der höchstgelegene Stadtteil Gaggenaus. Eingebettet zwischen Eichelberg (535 Meter) und Mahlberg (611 Meter) stellt der Ort ein attraktives Ausflugsziel dar. 1219 erstmals urkundlich erwähnt, war Freiolsheim von Beginn an landwirtschaftlich geprägt. Das Wappen zeigt denn auch, soweit der Vorgang zurück verfolgt werden kann, einen Rechen – eindeutiger Hinweis auf den hier betriebenen Ackerbau und die hier praktizierte Viehzucht.
Auch das 1751 gestochene Freiolsheimer Gemeindesiegel ist zwar einerseits – dem barocken Zeitalter gemäß – fein verziert, trägt aber andererseits ebenfalls den Rechen im Zentrum. Im 19. Jahrhundert war vorübergehend über dem Rechen auch eine Krone angebracht. Als Freiolsheim 1900 darum bat, einen erneuerten Wappenentwurf anzufertigen, schlug das Generallandesarchiv Karlsruhe vor, den Rechen mit zwei Rosen zu ergänzen. Diese beiden Ebersteinschen Rosen sollten an die frühere Zugehörigkeit der Gemeinde Freiolsheim zur Grafschaft Eberstein erinnern. Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag des Generallandesarchivs zu. Als die Gemarkungen Moosbronn und Mittelberg 1925 und 1930 mit Freiolsheim vereinigt wurden, übernahmen sie das Freiolsheimer Gemeindesiegel.
Heinrich Langenbach, der in den 50er-Jahren eine Ortschronik über Freiolsheim schrieb, ist mit dem heutigen Freiolsheimer Wappen, wie es im Zuge der Umwandlung und Neuregelung der Badischen Orts- und Gemeindesiegel Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist, nicht zufrieden. „Wenn auch damit der Stempel des Dorfes lebhafter geworden ist, eine Urtümlichkeit oder eine glückliche Lösung stellt dies keinesfalls dar“, lautet sein Einwand. Die Ortsfarben Freiolsheims, so entnehmen wir der Chronik, sind rot und weiß. Daran ist ersichtlich, dass Freiolsheim ursprünglich Eigentum des Bistums Speyer war (die Farben des Bistums Speyer sind weiß und rot).
Langenbach, der die beiden Ebersteinschen Rosen lieber nicht im Freiolsheimer Ortswappen gesehen hätte, wollte sie auch aus einer Ortsflagge Freiolsheims verbannt wissen. Diese Ortsflagge sollte seiner Meinung nach von den Farben rot und weiß geprägt sein und als Wappensymbol lediglich eine goldene Zarge (Rechen) tragen: „Die Zarge weist auf die Urtümlichkeit einer frühen Landwirtschaft hin. Damit wird erkenntlich, dass Freiolsheim aus einer Bauernsiedlung hervorgegangen ist.“ Im Rechen allein erkannte der Ortschronist das Ursprüngliche Freiolsheims. Die Ebersteinschen Rosen waren für ihn nur Episode, wenn sie auch heute immer noch das Ortswappen zieren.
In Silber ein schräglinks liegendes blaues Sägeblatt (Zähne rechts), oben und unten begleitet von je einer blau besamten roten Rose.
2008 jährt sich zum 600. Mal, dass Hörden erstmals urkundlich erwähnt wurde. Seit dem 16. Jahrhundert stand der Ort ganz im Zeichen der Flößerei – dementsprechend hielt die Säge so gut wie automatisch auch Einzug in das Gemeindewappen. Im Zuge der großen Kreisreform wurde Hörden, das heute fast 2.300 Einwohner zählt, Stadtteil Gaggenaus.
Die Säge, so vermutet Chronist Heinrich Langenbach, sei nicht das erste Zeichen Hördens gewesen. „Die Hördener sind in ihren Anfängen Bauern und Weinbauern, sie haben mit der Säge bestimmt nichts zu tun.“ Erst nachdem sie sich der Flößerei verschrieben hatten, so vermutet Langenbach, sei die Säge zu ihrem Wappen geworden. Lange Zeit war dies eine Säge mit fünf Zähnen. Sie zierte die Grenzsteine des Ortes bereits im 18. Jahrhundert.
Damals erlebte der Holzhandel vor Ort seinen ersten Höhepunkt. In Hörden lebten bereits über 600 Personen, darunter auch etwa 20 jüdische Familien, die knapp ein Viertel der Bevölkerung stellten. Die Murgschifferschaft hatte in Hörden mehrere Sägemühlen. Ein großer Holzfang in der Murg stoppte das Stamm- und Scheitholz, das weiter oberhalb der Murg zu Tal geflößt worden war. Die Hördener machten aus dem Holz Schnittwaren, die dann weiter flussabwärts verflößt wurden, aber auch Fassdauben, Zuber, Kübel und Eimer. Manche Familien kamen so zu großem Wohlstand.
Als das Generallandesarchiv Karlsruhe im Jahre 1900 ein neues Gemeindewappen anlegen sollte, ergänzte es die jetzt mehrzähnige Säge mit zwei dunkelroten Rosen. Sie sollen – wie im Falle Freiolsheims – an die Zugehörigkeit der Gemeinde Hörden zur Grafschaft Eberstein erinnern. Der Gemeinderat stimmte diesem Entwurf 1911 zu. Die Krone, die noch Mitte des 19. Jahrhunderts über dem Gemeindewappen Hördens stand, war verschwunden. Die Säge allerdings blieb erhalten – und unterstreicht bis heute die bleibende Prägung Hördens durch eine längst vergangene Zeit.
Silbernes Hufeisen auf blauem Schild.
Michelbach gehört zu den frühesten Ansiedlungen des Murgtals. 1102 erstmals urkundlich erwähnt, reichen die Ursprünge des Ortes am Fuße des Mahlbergs und des Bernsteins weit ins frühe 11. Jahrhundert zurück. Der Name des Ortes geht nicht, wie man vermuten könnte, auf den Erzengel Michael zurück, wenn er auch der Patron der Kirche vor Ort ist. „michel“ bedeutet im Mittelhochdeutschen „groß“ und bezieht sich in dem heute knapp 2.000 Einwohner umfassenden Ort auf den Bach, der den – seit 1975 – Stadtteil Gaggenaus durchfließt.
Doch nun zum Wappen Michelbachs, das 1752 aus einem achtlöchrigen Hufeisen bestand. Das damalige „Michelpacher Gerichts Insigl“ war gemäß dem Zeitalter des Barock fein ausgearbeitet. Die Krone, die im 19. Jahrhundert über dem Hufeisen der Gemeinde Michelbach stand, musste weichen, als das Bezirksamt Gernsbach Einspruch gegen das „verbotswidrige Siegel mit einer Krone“ einlegte. Das mit einem Alternativvorschlag beauftragte Generallandesarchiv Karlsruhe riet am jahrhundertealten Hufeisen festzuhalten. Dem Vorschlag, fortan ein siebenlöchriges silbernes Hufeisen auf blauem Schild als Wappen Michelbachs zu führen, stimmte der Gemeinderat noch im Dezember 1900 zu.
Wie aber kam es, dass gerade das Hufeisen für Michelbach steht? Hier gibt es zwei Deutungsmöglichkeiten. Die erste führte Heinrich Langenbach ins Feld, als er 1958 den ersten Band seiner Michelbacher Chronik vorlegte. Demnach leitet der Ort seine Herkunft von „Waldhufen“ ab. Eine Hufe oder Hube, so erläutert Fridjoff Klarhof in dem Band „900 Jahre Michelbach“, sei jenes Stück Land gewesen, das eine mittelalterliche Bauernfamilie benötigte, um überleben zu können. Grenzte dieses Stück Land an den Wald oder schloss diesen gar mit ein, so war es eine „Waldhufe“.
Von eben solchen Hufen, argumentiert Langenbach, leite sich das Wappen Michelbachs ab, nur dass man der Hufe die Form eines Hufeisens gab, wie es der Schmied anfertigt. Reine Spekulation dürfte allerdings sein, von den ursprünglich acht Hufnagellöchern auf acht Waldhufenstücke zu schließen, die am Anfang Michelbachs gestanden haben sollen. Langenbach geht gar so weit, im Hinblick auf das Michelbacher Symbol von einem „redenden Wappenschild“ zu sprechen.
Eine zweite Interpretation führt Klarhof ins Feld. Er meint, dass die Adeligen auf dem Schlossberg von Michelbach früh schon von ihren Ebersteiner Lehensherren ermächtigt worden sein könnten, ein eigenes Wappen zu führen. Diese Adeligen waren Ritter. Weil lediglich Hochadelige ab dem Grafenstand Wappenbilder mit Ross und Reiter hätten führen dürfen, könnten die Michelbacher Ritter auf das Hufeisen zurückgegriffen haben, um es als Wappen zu führen.
Wie dem auch sei: Das schöne Fachwerkdorf Michelbach wurde 2003 Landessieger und ein Jahr später Silbermedaillengewinner auf Bundesebene im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden – unser Dorf hat Zukunft“. Und das alles im Zeichen des Hufeisens. Letztlich sollte man sich in diesem Zusammenhang vielleicht wirklich mit der Weisheit begnügen, die Klarhof ans Ende seines Textes über das Michelbacher Wappen stellte: „Manche Dinge muss man in Frieden lassen. Ohne Geheimnisse kann der Mensch nicht leben.“
In Silber ein blaues Rebmesser zwischen zwei grünen Lorbeerzweigen.
Das Kastaniendorf (Keschtedorf), das in einer Höhe von 183 Metern über dem Meeresspiegel unterhalb des 534 Meter hohen Eichelbergs liegt, wurde 1102 erstmals urkundlich erwähnt. Die Wurzeln der damaligen Siedlung reichen vermutlich allerdings noch einige Jahrhunderte weiter ins frühe Mittelalter zurück. Die Zivilisation freilich hielt schon im Altertum Einzug, zumal in unmittelbarer Nachbarschaft eine römische Villa lokalisiert werden konnte. Allerdings wäre es zu weit gegriffen, die römische Hofanlage aus dem dritten Jahrhundert im südlich des Ortes gelegenen Gewann Hasensprung als direkte Vorläuferin Oberweiers zu bezeichnen. Gleichwohl war das Aufsehen groß, als 1976 beachtliche Ruinen ausgegraben wurden. Zudem trägt Oberweier das lateinische Wort „villa“ in seiner althochdeutschen Form „wilari“ im Namen, zumal die erste urkundliche Erwähnung auf „Oberenwilri“ lautet.
Doch weg von der allgemeinen Geschichte und hin zur Wappenkunde: Bereits Anfang des 17. Jahrhunderts finden wir im Siegel „Oberweyers, am Aychelberg gelegen“, ein Weinmesser. Schön gearbeitet ist das Siegel aus dem 18. Jahrhundert, das ebenfalls von „Oberweyer am Eichelberg“ spricht. Als man 1900 in Baden daran ging, neue Siegel zu entwerfen, schlug das Karlsruher Generallandesarchiv für Oberweier ein blaues Weinmesser auf silbrigem (weißem) Hintergrund vor.
Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden, die den Vorschlag aus Karlsruhe anstandslos annahmen, widersprach der Gemeinderat aus Oberweier. Erst 1959 unterbreitete das Ortsgremium einen eigenen Vorschlag, der darin bestand, das Rebmesser nicht nur auf hellem Untergrund zu führen, sondern es – wie im 19. Jahrhundert schon geschehen – darüber hinaus mit herrschaftlichen Lorbeerzweigen zu umsäumen. Nun lag es am Generallandesarchiv, sein Veto einzulegen oder das Plazet zu erteilen.
Geschehen ist letzteres, zumal die Spezialisten aus der Fächerstadt die Originalität des neuen Entwurfs sogar begrüßten. Ihre Begründung lautete: Das alltägliche Werkzeug der Winzer kommt in vielen Wappen vor. Mit Lorbeeren umgrenzt, werde sich das Oberweierer Wappen aus der gleichmäßigen Vielzahl unverwechselbar hervorheben. Auch das baden-württembergische Innenministerium willigte noch 1959 ein, so dass Oberweier sein heutiges Emblem bekam und darüber hinaus auch noch das Recht, eine blau-weiße (blau-silberne) Flagge zu führen.
Heute hat Oberweier fast 1.200 Einwohner. Seit 1972 ist es Stadtteil Gaggenaus. Im Lauf der Jahrhunderte hielt das Dorf an einem immer fest: am Winzermesser – eine Verneigung vor dem hier seit eh und je betriebenen Weinbau.
In gespaltenem Schild vorne in Rot ein silbernes Rebmesser, hinten in Gold zwei schräggekreuzte schwarze Flößerhaken.
Urkundlich ist Ottenau, das 1243 erstmals erwähnt worden ist, genauso alt wie Gaggenau, und überhaupt blicken die beiden räumlich eng beieinander liegenden Nachbarn auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück. Ottenau ist der älteste Stadtteil Gaggenaus. Als das Badische Staatsministerium 1935 beschloss, dass Ottenau und Gaggenau zukünftig gemeinsame Wege gehen, hatte das auch Auswirkungen auf das gemeinsame Wappen, das fortan nicht nur aus dem Gaggenauer Sester, sondern auch aus dem Ottenauer Weinmesser bestand. Erst 1971, als Gaggenau Große Kreisstadt wurde und bereits eine Reihe weitere Eingemeindungen stattgefunden hatten, verschwand das Ottenauer Symbol aus dem Stadtwappen.
Doch zurück in die Vergangenheit. Schon die ersten Siegel Ottenaus, die weit ins 17. Jahrhundert zurück reichen, sprechen eine eindeutige Sprache: Sie zeugen von dem Weinbau, der hier seit eh und je betrieben wird. Gleichzeitig dokumentieren sie den hohen Stellenwert, den die Flößerei für Ottenau hatte. Winzermesser und gekreuzte Flößerhaken: Das war viele Jahrhunderte lang die Visitenkarte Ottenaus.
Heute zählt Ottenau 5.130 Einwohner. Eine eigene Identität wird in dem selbstbewussten Stadtteil groß geschrieben. Dementsprechend stolz tragen die Ottenauer ihr Wappen vor sich her. Das Generallandesarchiv Karlsruhe fasste es 1910 folgendermaßen zusammen: „In gespaltetem Schild vorn in Rot ein silbernes Rebmesser, hinten in Gold zwei schräg gekreuzte Floßhaken.“
Das Wappen ist auch eine Referenz an alte Zeiten, denn in diesem Zeichen waren auch die Richter angetreten, die im 17. Jahrhundert an der Gerichtsstätte Ottenau Recht sprachen. Weinbau wird in Ottenau heute noch betrieben. Die Flößerei freilich ist Bestandteil der Geschichte, nachdem die letzten beiden Vertreter dieser Berufssparte Anfang des 20. Jahrhunderts in Ottenau im Bild festgehalten worden sind.
In Rot zwischen zwei schräggekreuzten silbernen Lorbeerzweigen ein goldener Sester.
Seit 1970 Stadtteil von Gaggenau, zählt Selbach derzeit über 1.500 Einwohner. Urkundlich ist der lieblich gelegene Ort erstmals in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erwähnt. Er gehörte den Grafen von Eberstein, später den Markgrafen von Baden. Kirchlich betrachtet, war Selbach dem Domstift Speyer und der Pfarrei Rotenfels unterstellt. Zur Landwirtschaft, die die Bevölkerung hier vorrangig betrieben hat, gehörte seit eh und je auch der Weinbau, der namentlich auf südwärts ausgerichteten Hängen praktiziert worden ist.
Der 204 Meter über dem Meeresspiegel gelegene Ort, der den Namen des Baches trägt, der ihn durchfließt, verfügt über ein Wappen, das erstmals – meisterhaft gestochen – im 18. Jahrhundert erscheint. Das „Selbacher Dorffs Sigillum“ ist von klassizistischer Schönheit, Lorbeerzweige schmiegen sich vollendet um den kreuzförmigen Sester in der Mitte.
Als man im 20. Jahrhundert daran ging, das alte Dorfzeichen zu erneuern, fiel auf, dass zahlreiche Gemeinden namentlich im Landkreis Rastatt ebenfalls den Sester als Erkennungszeichen trugen. Um den Selbacher Sester von diesen Siegel abzuheben und unverkennbarer zu machen, besann man sich auf die Lorbeerzweige, die schon nach 1700 zum Dorfwappen gehörten.
Heinrich Langenbach sprach in seiner Selbacher Ortschronik von 1962 hinsichtlich des Ortswappens von einem „Kreis mit Kreuz“. Das Innenministerium Baden-Württemberg verlieh Selbach 1959 eine Flagge, die aus den Farben „Gelb-Rot (Gold-Rot)“ besteht. Gleichzeitig umschrieb es das Wappen, das Selbach fortan tragen sollte, mit den Worten: „In Rot zwischen zwei schräggekreuzten silbernen Lorbeerzweigen ein goldener Sester“. Der Ursprung des Sesters ist damit – ähnlich wie bei Gaggenau – nicht belegt, dürfte aber, weil ein Getreidemaß, in der landwirtschaftlichen Ausrichtung des Ortes zu suchen sein.
In Blau ein goldener Ring mit durchgestecktem goldenem Doppelhaken, daraus eine Madonna mit dem Kinde in silberner Gewandung mit goldenem Heiligenschein hervorwachsend. Sie trägt ein goldenes Szepter, der Jesusknabe hält eine goldene Taube in der Linken.
Sulzbach wird 1243 erstmals urkundlich erwähnt. Damals gehörte es zum Einzugsgebiet von Rotenfels. Von Beginn an war der Ort aller Wahrscheinlichkeit nach Besitz des Klosters Frauenalb, das die Grafen von Eberstein in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts gestiftet hatten. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts, als das Alte Reich unterging, im Zuge der Säkularisation die Klöster enteignet wurden und der Staat Baden sich bildete, hatte die Äbtissin von Frauenalb über gute 600 Jahre hinweg in Sulzbach das Sagen. Erst nach 1800 gelangte der von Nonnen regierte Ort an Baden.
Die heilige Muttergottes als Bestandteil des Wappens weist auf diese Zeiten zurück. Rätselhafter dürfte die Herkunft des Doppelhakens sein, der unterhalb der Madonna einen Ring durchläuft. Dieses Dorfzeichen stand ursprünglich senkrecht, während Maria mit dem Jesuskind es krönte. Der eifrige Chronist Heinrich Langenbach spricht in seiner 1959 erschienenen Dorfgeschichte Sulzbachs in dieser Hinsicht von einer „Wolfsangel“.
Das erste Dorfsiegel entstammt dem Jahre 1811 und benutzt noch die Initialen „S“ und „B“ für Sulzbach. Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Gemeindenamen dann zwar ausgeschrieben, dafür aber die unterhalb einer Krone angebrachte Muttergottes mit Kind bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet. Erst 1901 erstrahlt das Wappen in seiner bekannten Schönheit.
Heute ist Sulzbach Stadtteil von Gaggenau (seit 1973). Über 1360 Einwohner leben am Fuß der Hohen Wanne (734 Meter) und des Bernsteins (693 Meter). Die Zeiten klösterlicher Herrschaft sind längst vorbei. Geblieben ist naturgemäß die landwirtschaftliche Prägung des Ortes, wo der Weinbau schon immer eine wichtige Rolle gespielt hat.