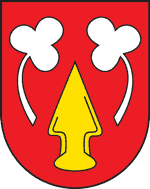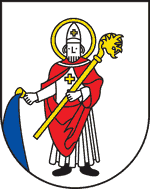In Rot auf einem durchgehenden silbernen Ast eine Silberne Taube.
Der Ort mit dem für seine Lage im ehemaligen Sumpfgebiet der Rheinniederterrasse charakteristischen Namen ist eine hochmittelalterliche Ausbausiedlung auf der Gemarkung Ettlingenweier. Mit dem Mutterort zusammen gehörte er seit etwa 1300 zum Stab Weier und wurde 1809/1819 selbständige Gemeinde.
Infolgedessen setzt die Siegelführung erst mit einem auf 1818 datierten Prägestempel ein. Er trägt die Umschrift GR.B.GERICHT BRUCHHAUSEN (=Großherzoglich Badisches Gericht Bruchhausen) und zeigt dasselbe aus dem badischen Staatswappen und der Stab Weierer Marke kombinierte Wappen, das auch im gleichzeitigen Ettlingenweierer Siegel begegnet. 1836 beschloss der Gemeinderat, das Zeichen des alten Stabs Weier aufzugeben und ein Jägerhaus - wohl als redendes Symbol für den Ortsnamen - in das Siegel aufzunehmen. 1902 wurde ein neues Siegel mit dem oben beschriebenen, vom Generallandesarchiv entworfenen Wappen angeschafft.
Das damals gewählte Wappenmotiv bezieht sich auf das Kloster Reichenbach im oberen Murgtal (Klosterreichenbach). Bruchhausen verdankt nämlich eine seiner frühesten urkundlichen Erwähnungen der Schenkung von Gütern durch den Edlen Luitfried an das Kloster im Jahr 1115. Einer der beiden Klosterpatrone war der heilige Gregor der Große, Papst und Kirchenlehrer (gestorben 604). Der Legende nach soll sein Schreiber gesehen haben, wie der Heilige Geist in Gestalt einer Taube sich, Gregor inspirierend, zu seinem Ohr neigte. Diese zur Kennzeichnung des Heiligen in den bildlichen Darstellungen bevorzugte Szene schmückt auch das alte Reichenbacher Klostersiegel.
Wenn auch zwischen der Taube als Symbol des Heiligen Geistes und der realen Tauben auf dem Ast nicht gerade ein direkter Zusammenhang erkennbar ist, hat Bruchhausen doch, gewissermaßen auf einem Umweg ein ansprechendes Wappensymbol erhalten. Die Bereinigung von den im Laufe der Zeit aufgetretenen Unklarheiten bezüglich des Wappenbildes und der Farben wurde zum Anlass genommen, das Wappen 1970 zusammen mit einer Flagge neu zu verleihen.
In Silber ein blauer Abtsstab, begleitet von zwei blaubesamten Rosen mit grünen Kelchblättern.
Ettlingenweier wird um 1100 als Owenswiler erstmals im Hirsauer Codex unter den Schenkungen und Erwerbungen dieses Klosters erwähnt. Ausser Hirsau erhielten und erwarben im Mittelalter hier noch die Kloster Reichenbach (heute Klosterreichenbach), Frauenalb und Lichtenthal Besitz. Der Ort kam über die Grafen von Eberstein im frühen 13. Jahrhundert an die Markgrafen von Baden. Diese bildeten zur Straffung der Verwaltung aus den driu Unswilre (das sind Ettlingenweier, Bruchhausen und Oberweier) den seit 1307 bezeugten Stab Weier. Als Gerichts- und Markgenossenschaftsbezirk, zu dem 1528 auch Schluttenbach geschlagen wurde, wurde er von Schultheiß und Gericht in Ettlingenweier geführt und bestand rund 500 Jahre. 1809 erfolgte die polizeiliche, Ende 1819 die wirtschaftliche Trennung der Stabsgemeinden.
Von Schultheiß und Gericht des Stabs Weier ist kein eigenes Siegel überliefert, die Urkunden wurden vom Amtmann zu Ettlingen besiegelt. Erst 1818 wurde für das mittlerweile selbständige Gericht Ettlingenweier ein Prägesiegel angeschafft. Es zeigt einen schräglinks geteilten Schild, in dessen oberem Feld einen Schrägbalken, im unteren Feld ein birnenförmiges Zeichen. Dieses Zeichen, das in Berichten an das Bezirksamt Ettlingen 1853 als verdrücktes Kettenglied bezeichnet wird, ist die Marke des Stabes Weier und wurde nach der Aufteilung des Stabs noch einige Zeit auch von den anderen ehemaligen Stabsgemeinden weitergeführt. Im übrigen ist das Wappen dieses ältesten Siegels von Ettlingenweier dem Mittelschild des badischen Staatswappens nachgebildet, das Großherzog Karl Friedrich 1807 eingeführt hatte. Der angebliche Zähringer Löwe im unteren Feld des Staatswappens ist im Gemeindesiegel durch das Ortszeichen ersetzt. Spätere Siegel enthalten die Dorfmarke und die Initialen E.W. ohne Wappenschild. Die älteste Abbildung der Dorfmarke findet sich auf der 1699 gegossenen ehemaligen Bürgerglocke der Pfarrkirche, die heute im Albgaumuseum Ettlingen aufbewahrt wird.
1902 schlug das Generallandesarchiv das vom Gemeinderat im gleichen Jahr angenommene, bis zur Vereinigung mit Ettlingen gültige Wappen vor. Der Krummstab soll auf den alten Besitz mehrerer Klöster im Ort, die ebersteinischen Rosen sollen auf die ehemaligen Ortsherren hinweisen.
In Rot eine gestürzte goldene Pflugschar, beseitet von zwei silbernen Kleeblättern.
Der um 1115 als Babinwilare erstmals erwähnte Ort, eine frühmittelalterliche Ausbausiedlung auf Ettlinger Gemarkung, gehörte bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts zum Stab Weier. Eine vor 1800 zurückreichende Siegeltradition gibt es daher nicht. Jedoch scheint Oberweier nach Erringung der Selbständigkeit als erster der ehemaligen Stabsorte ein eigenes Siegel angeschafft zu haben. 1812 begegnet es als Prägesiegel und zeigt zwischen den Initialen O und W und umgeben von einem ovalen Blätterkranz und zwei gekreuzten Palmzweigen das bekannte Stab Weierer Ortszeichen.
Nach der endgültigen Aufteilung des Stabes Weier wählte die Gemeinde im Jahre 1822 laut einem Bericht von 1853 eine Pflugschar und die Initialen O.W. als Ortszeichen, das ohne Wappenschild in den folgenden Siegeln des 19. Jahrhunderts verwendet wurde. Bei der Gestaltung des Gemeindewappens griff das Generallandesarchiv im Jahre 1900 auf dieses landwirtschaftliche Symbol zurück, bereicherte das Wappen jedoch zur Unterscheidung von den zahlreichen anderen dörflichen Pflugscharwappen um die beiden willkürlich gewählten Kleeblätter. Auch die Tingierung wurde frei festgesetzt. Ab 1902 stempelte die Gemeinde mit ihrem neuen Siegel.
In gespaltenem Schild vorn in Gold ein roter Schrägbalken, hinten in Blau das silberne Ortszeichen in Form eines Kettengliedes.
Dem Schluttenbacher Wappen war nur eine knapp fünfjährige Frist als Symbol kommunaler Eigenständigkeit gegönnt: Erst Ende des Jahres 1969 verliehen, verlor es mit der Vereinigung der Gemeinde mit der Stadt Ettlingen schon wieder seine amtliche Gültigkeit.
Das Wappen weist in seinem vorderen Feld auf die Zugehörigkeit des Ortes zu Baden hin. Schluttenbach war im Jahre 1528 nach fast 200 Jahren unter württembergischer Herrschaft durch einen Tauschvertrag an die Markgrafen gekommen, die den Ort noch im 16. Jahrhundert dem Stab Weier einverleibten. An diese Zeit als Stabsgemeinde erinnert die Marke des Stabs Weier im hinteren Wappenfeld.
Das Siegelbild des ersten, 1818 geschaffenen, wie auch der späteren Stempel der Gemeinde ähnelte mit dem zwischen gekreuzte Palmzweige gesetzten Stab Weierer Zeichen (Kettenglied) dem ältesten Oberweierer Siegelbild. Im Gegensatz zu den ehemaligen Stabsorten Bruchhausen und Oberweier hat Schluttenbach wie Ettlingenweier selbst auch nach der Trennung des Stabes die alte Stabsmarke als Ortszeichen weitergeführt. Auch auf Grenzsteine wurde dieses Zeichen eingehauen.
Der erste Versuch, der Gemeinde im Rahmen der Bereinigung der badischen Gemeindesiegel ein regelrechtes Wappen zu verschaffen, zeigte keinen Erfolg. Das Generallandesarchiv hatte im Jahre 1902 als Wappenbild in Blau einen goldenen Krummstab (wegen ehemaligen Besitzes des Klosters Frauenalb im Ort), belegt mit einem silbernen Wellenbalken (redend für den Ortsnamen) vorgeschlagen. Die Gemeindeverwaltung lehnte diesen wenig aussagekräftigen Entwurf aber ab. 1963 wurde die Wappenfrage dann erneut aufgegriffen und aus mehreren Entwürfen schließlich das vom Innenministerium verliehene Wappen ausgewählt. Die Tingierung des linken Feldes ist frei gewählt.
In Silber der golden nimbierte heilige Bonifatius in silbernem Gewand, rotem Umhang und mit golden besetzter silberner Mitra, in der Linken einen goldenen Krummstab haltend, mit der Rechten aus einem goldenen Kelch blaues Wasser gießend.
Das Wappen mit dem Kirchenpatron Schöllbronns ist der Gemeinde im Jahre 1902 vom Generallandesarchiv vorgeschlagen und vom Gemeinderat gebilligt worden. Der "Apostel der Deutschen" wurde in diesem Vorschlag auf grünem Boden stehend, mit blauem Gewand, roten Schuhen, rotgefütterter und golden bordierter silberner Mitra dargestellt. Mit der Rechten gießt er Taufwasser aus einem Gefäß, in der Linken hält er ein rotes Buch, die Bibel, und ein Schwert als Zeichen seines im Jahre 754 bei Dokkum in Friesland erlittenen Märtyrertodes.
Weil die komplizierte Wappenfigur nach dem zweiten Weltkrieg im Siegel verunstaltet gezeichnet war, bemühte man sich um eine Bereinigung des Wappenbildes, bei der auch die Tingierung der Kleidung des Heiligen entsprechend seinem Bild in der Pfarrkirche gewählt wurde. Wegen dieser Veränderung am bisher gültigen Wappen war eine amtliche Neuverleihung notwendig, bei der auch die Flaggenfarben erstmals festgelegt wurden.
Das Ortszeichen Schöllbronns ist ein Herz. Es findet sich auch heute noch eingehauen in Grenzsteinen und schmückte neben den Initialen S.B. oder SCHB. die Siegel der Gemeinde im letzten Jahrhundert. Frühere Siegel sind nicht bekannt und waren wohl auch nicht vorhanden. Das Ortszeichen wurde bei der Wappengestaltung 1902 nicht berücksichtigt, kam aber zwischen 1937 und 1945 wieder zur Geltung, als man gemäß den Anordnungen des Reichsinnenministeriums bestrebt war, kirchliche Symbole aus den Gemeindewappen zu entfernen, und das Gemeindewappen im Siegel wieder durch das Herz und die Initialen S.B. ersetzte.
In Rot ein schwebender gestürzter goldener Sparren, darüber ein silbernes Kleeblatt.
Kleeblatt und Sparren oder Schleife, wie dieses Zeichen in der Gemeinde genannt wird, sind die Ortsmarken Spessarts. Sie sind auf den Grenzsteinen eingehauen und erscheinen auch in den Siegeln des letzten Jahrhunderts. Für die Zeit vor 1802 ist eine Siegelführung der Gemeinde nicht bezeugt, und damit unterscheidet sich Spessart, das seit Ende des 13. Jahrhunderts bis 1803 dem Kloster Frauenalb gehörte, nicht von den übrigen ehemals frauenalbischen Klosterdörfern.
Das älteste Typar, ein nachweisbar von 1802 bis 1833 benutztes, recht grob gearbeitetes Prägesiegel, zeigt die Initialen S.P., darüber den gestürzten Sparren und darunter das Kleeblatt. Das Ganze ist von Zweigen und Sternen umgeben. 1819 oder kurz zuvor ist das Siegel mit der Umschrift GH.B. GERICHTSPESARTH (=Großherzogliches Badisches Gericht Spessart) angeschafft worden. Es enthält einen schräglinks geteilten Wappenschild, der wie in den ersten Siegeln von Bruchhausen und Ettlingenweier aus dem oberen Teil des badischen Staatswappens von 1807 (Schrägbalken) und den beiden übereinandergestellten Ortszeichen im unteren Feld zusammengesetzt ist. Weitere Siegel des vorigen Jahrhunderts kombinieren wieder Sparren und Kleeblatt mit den Initialen S.P. ohne den Wappenschild.
1902 wurde das Wappen mit freigewählter Tingierung geschaffen, nachdem der Gemeinderat auf dem Dienstweg über das Bezirksamt Ettlingen das Generallandesarchiv um einen Vorschlag gebeten hatte, allerdings unter der Voraussetzung, dass der neue Siegel die bisherigen Zeichen, Schleife, Kleeblatt, wieder enthält wie der jetzige, damit keine Kosten an den Grenzsteinen der Gemarkung entstehen.