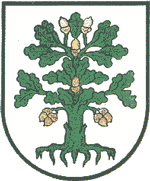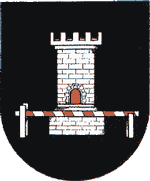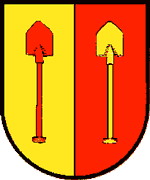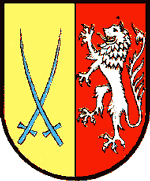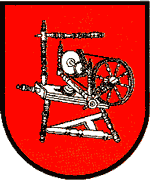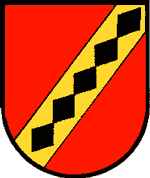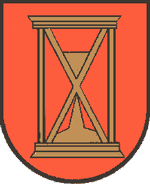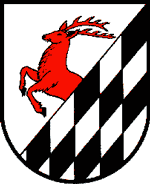Auf silbernem Feld eine grüne Eiche mit 8 goldenen Eicheln.
Die mächtige Eiche im Ahstedter Wappen steht heute noch an der Straße, die am Westrand der Ortschaft entlangführt. Sie ist als Naturdenkmal gesetzlich geschützt und stellt den letzten Baum des einstmals 30 Meter breiten „Hagen“ oder „Knicks“ dar, der das Dorf vom Westen her schützte. Die Eiche gehört zum heutigen Wehrspohnschen Hofe, dem Stammsitz der Familie des Heimatdichters Wilhelm Kaune.
Auf schwarzem Schild ein silberner Wachturm mit Schlagbaum.
Als Hildesheimer Bürger im Jahre 1429 von Bischof Magnus die Erlaubnis zur Anlage der Landwehr von Itzum bis zum Bruchgraben erhielten, wurde Bettmar der östlichste Stützpunkt dieser Befestigung. Am Ausgang des Dorfes wurde als Durchlaß der Heerstraße nach Braunschweig der „Bettmarer-Paß“ errichtet. Das Wappen nimmt Bezug auf diesen mittelalterlichen Paß und zeigt einen Wachturm mit Schlagbaum.
Gespaltenes Schild von Rot und Gold, darin zwei senkrechte Spaten mit Schaufel nach oben in verwechselten Farben.
Das Wappen ist nach dem Siegel des Konrad von Elvede aus dem Jahre 1334 gestaltet und zeigt zwei senkrechte Spaten mit der Schaufel nach oben. „Elvede“ im Jahre 1132 und „Elvethe“ im Jahre 1151 waren die ursprünglichen Namensformen für Dingelbe. Die Erinnerung an ein Landthing, einen großen Gerichtstag des Bistums im Jahre 1232, wird dazu geführt haben, den Namen in Dingelbe umzuwandeln.
Gespaltenes Schild von Rot und Gold. Links in Rot ein silberner aufrechter Löwe, rechts in Gold zwei gekreuzte blau Schwerter.
Der denkwürdigste Tag in der Geschichte Dinklars ist der 3. September 1367, an dem der Hildesheimer Bischof Gerhard den Herzog Magnus von Braunschweig und dessen Verbündete, Erzbischof Diedrich von Magdeburg und Bischof Albert von Halberstadt, besiegte. Zur Erinnerung an diese Schlacht hat das Wappen im linken Feld zwei gekreuzte Schwerter. Der Löwe im rechten Feld stammt vom Siegel des Heinrich von Dinklar aus dem Jahre 1323.
In Rot ein silbernes Spinnrad.
Der größte Teil der Feldmark von Farmsen wurde im 13. Jahrhundert Eigentum des Magdalenenklosters in Hildesheim. Zwischen 1265 und 1295 wird ein Rittergeschlecht erwähnt, das den Namen „von Farmsen“ führt. Das Spinnrad im Ortswappen erinnert an die Zeit, als der Flachsanbau von großer Bedeutung war und viele arme Leute durch die Verarbeitung des Flachses ihren Lebensunterhalt verdienten.
In Rot ein schräglinker golderner Balken, belegt mit 5 schwarzen Rauten.
Garbolzum wird 1 187 erstmals als „Gerboldesheim“, Garmissen 1240 als „Germwardessen“ erwähnt. Die Bezeichnungen gehen auf die altdeutschen Namen „Gerbold“ und „Germward“ zurück. 1230 wird erstmals das Rittergeschlecht „von Garmissen“ erwähnt. Das Familienwappen zeigt fünf auf einem Schrägbalken liegende Rauten und diente als Vorbild für das Ortswappen.
In Rot ein goldener Kamm mit fünf Zacken.
Die Ortschaft Kemme gehört zu den am frühesten bezeugten Orten in Niedersachsen. Die erste Nachricht geht auf das Jahr 1025 zurück und spricht von einem Landgut „Kemnium“. Das Wappen zeigt einen Kamm entsprechend dem Siegel des Bernward von Kemme aus dem Jahre 1265. Der letzte Angehörige dieses Rittergeschlechtes war am Ausgang des 14. Jahrhunderts der Knappe Heinrich von Kemme.
In Blau eine silberne Friedenstaube mit einem 7-blättrigen Ast im Schnabel.
Die Ortschaft Oedelum, die schon 1125 eine Kirche besaß, war Jahrhunderte hindurch Streitobjekt zwischen den Ämtern Steinbrück und Peine. Im Jahre 1722 wurde eine Grenzlinie mitten durch das Dorf gezogen. Aber auch dann hörten die Streitigkeiten nicht auf. In Erinnerung an diese Verhältnisse und im Hinblick auf die Friedenssehnsucht der Menschen wurde die Friedenstaube in das Wappen aufgenommen.
Gespaltenes Schild, links in Grün zwei silberne gekreuzte Lilienstäbe, rechts in Rot r goldenen waagerechte Balken.
Die Ortschaft Ottbergen wird erstmals 1154 in der Zeugenreihe einer vom Herzog Heinrich dem Löwen in Goslar ausgestellten Urkunde durch einen Berthold von Ottberch als „Othberge“ erwähnt. Das Wappen der Ritter von Tossum, die den Taufstein in der Pfarrkirche stifteten - drei waagerechte Balken - und das Wappen der Ritter von Bortfeld - zwei gekreuzte Lilienstäbe - zieren das Wappen von Ottbergen.
Auf Rot schräglinks ein schwarzer Treppengiebel mit goldenem Rand, belegt mit zwei goldenen gekreuzten Schlüsseln.
Im 15. Jahrhundert erworben Hildesheimer Bürger, darunter die Familie von Harlessem, Grundbesitz in Schellerten. Das Ortswappen ist dem Wappen der Familie von Harlessem, die in Hildesheim das „Templerhaus“ errichtet hat, nachgebildet. Das Giebelfeld trägt zwei gekreuzte Schlüssel. Den Anlass dazu gab das Kirchensiegel, das einen Schlüssel zeigt.
In Rot eine goldenen Sanduhr.
Zur Vermählung seiner Nichte Philippine Willich mit dem späteren landwirtschaftlichen Reformator Dr. Albrecht Thaer am 19. April 1786 in der Kirche zu Wendhausen schenkte der damalige Gutspächter Amtsrat Deichmann der Gemeinde eine Sanduhr. Sie symbolisiert den wechselvollen Ablauf der Geschichte von Wendhausen und den Beginn einer neuen Zeit der Landwirtschaft, eingeleitet durch Dr. Thaer.
Schräglinks gespalten. Oben rechts in Silber (Weiß)ein roter, aus der Teilungslinie wachsender steigender Hirsch. Unten links von schwarz und Silber (Weiß) schräggerautet.
Mit Hilfe des Gutsherrn von Nettlingen, Freiherr Franz Johann von Rudolf von Wobersnow, wurde 1717 die Kirche zu Wöhle erbaut. An der Außenseite wurde das Wappen derer von Wobersnow angebracht, das von Wöhle übernommen wurde. Wöhle wurde in der Bestätigungsurkunde des Klosters Lamspringe durch Bischof Adelog im Jahre 1178 erstmals als „Walete“ und später als „Wolethe“ erwähnt.