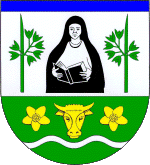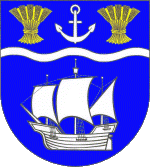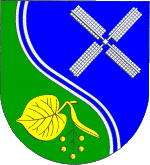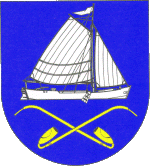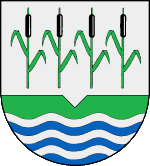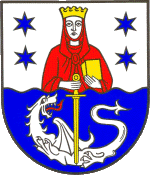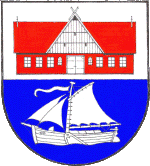Unter einem schmalen blauen Schildhaupt oben wachsend in Silber eine im schwarzen Habit gekleidete silberne Nonne, in beiden Händen ein geöffnetes schwarzes Buch haltend und beiderseits begleitet von einer grünen Binse. Im erhöhten grünen Schildfuß über einem silbernem Wellenfaden ein goldener Ochsenkopf, beiderseits begleitet von einer goldenen Sumpfdotterblume.
Die Gemeinde Aebtissinwisch liegt am Rande der Naturräume Wilstermarsch und Kudenseemoor. Im Westen grenzt der Nord-Ostsee-Kanal und im Norden und Osten die Wilster-Au an das Gemeindegebiet.Der Ortsname war zunächst einfach "Wisch = Wiese", dann "Aebtissinwisch", weil es dem Kloster Itzehoe und dessen Äbtissin gehörte (Quelle: W. Laur, Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig Holstein, 1992). Die Hauptfigur des Gemeindewappens ist daher eine Äbtissin. Die Binse gilt als sogen. "Zeigerpflanze" für grundwassernahe Standorte. Die beiden grünen Binsen beidseitig der Äbtissin beschreiben die typischen feuchten Böden einer Region in Schleswig-Holstein, die unterhalb des Meeresspiegels liegt. Die Sumpfdotterblume gehört zu den markantesten Blütenpflanzen der feuchten Wiesen und Weiden. Sie erinnert an eine einstmals intakte bäuerliche Kulturlandschaft, in der diese reizvolle Blütenpflanze einen geeigneten Lebensraum fand und sich großflächig ausbreiten konnte. Der goldenen Kuhkopf erinnert an die Bedeutung der Viehwirtschaft in dieser von Wiesen und Weiden geprägten Landschaft. Der blaue Balken im Schildhaupt weist auf den Nord-Ostsee-Kanal hin, der silberne Wellenfaden im Schildfuß bezieht sich auf die Wilster-Au. Die Hindergrundsfarbe Grün symbolisiert den Ortsnamensteil "Wisch".
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Blau ein erhöhter silberner Wellenbalken, darüber ein silberner Anker zwischen zwei goldenen Getreidegarben, darunter ein silberner dreimastiger Holk mit voller Beseglung.
Die Gemeinde liegt an der Stör in der Holsteinischen Elbmarsch. Die Schifffahrt auf der Stör und der nahen Elbe hatte und hat für die Gemeinde von je her eine wichtige wirtschaftliche Bedeutung. Das aus dem 15. Jahrhundert stammende Lastschiff (Holk) soll an die historische, aber auch aktuelle Bedeutung dieses Wirtschaftszweiges erinnern. Der Anker ist eine Reminiszenz an den heiligen Nikolaus, die Wappenfigur der Kirchengemeinde Beidenfleth. Die Ährengarben verweisen auf die Bedeutung der Landwirtschaft.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Blau ein schräggestellter, silberner fliegender Fisch über zwei silbernen Wellenfäden im Schildfuß.
Die von der Gemeinde Brokdorf für ihr Wappen gewählten Symbole sind sowohl auf historische als auch geographische Gegebenheiten zurückzuführen. Der fliegende Fisch ist fast "wörtlich" aus dem Wappen der Familie Brockdorff zitiert. Dieses alte holsteinische Adelsgeschlecht hatte in diesem Kirchdorf wahrscheinlich seinen Stammsitz und nannte sich nach ihm. Die Wellen im Schildfuß zeigen die Nähe des in der Wilstermarsch am Deich gelegenen Ortes zur Elbe. Der vorzügliche Marschboden ermöglichte eine ertragreiche Landwirtschaft, die Wassernähe einen bescheidenen Schiffsverkehr. Die blaue Schildfarbe steht für das Wasser. Die Lage an der Elbe barg auch die Gefahr häufiger Überflutungen. Besonders die Flut vom 25. Dezember 1717 fügte dem Dorf großen Schaden zu.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Grün und Blau durch einen silbernen Pfahl, belegt mit einem schmalen blauen Faden, im Kurvenschnitt gespalten. Oben links vier silberne schräg gestellte Windmühlenflügel, unten rechts ein goldenes Lindenblatt mit Fruchtstand.
Der Ortsname der Gemeinde Dammfleth lässt sich mit "Wasserlauf bei einem Damm" deuten (Quelle: W.LAUR, 1992, Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig Holstein). Das Wappenschild wird durch einen schräg angeordneten silberne Wellenfaden geteilt, der mit einem blauen Wellenfaden belegt ist. Dieser bezieht sich auf einen Fleet, ein wesentlicher Bestandteil der Entwässerung dieser grundwassernahen Grünlandflächen. Die beiden weißen Wellenfäden stellen die beidseitigen Dämme dar, die sich als natürliche Erhöhung der Uferränder, für die Besiedlung dieser Landschaft besonders eigneten. Die Mühlenflügel erinnern an die Bedeutung der Kornmühlen sowie an die für die Marsch typischen Entwässerungsmühlen, die vor der Einführung elektrisch betriebener Schöpfwerke für die Trockenlegung der landwirtschaftlichen Nutzflächen sorgten. Das mit einem Fruchtstand versehene goldene Lindenblatt weist auf die landschaftstypischen "Hausbäume" hin. Nach alter Tradition wurden diese vor das Wohnhaus gepflanzt, um damit seine Bewohner vor Armut und Krankheit zu schützen. Der Linde wurde die Kraft zugesprochen, das Schicksal "gelinde", d.h. milde und sanft zu stimmen. Die Hintergrundfarben Blau und Grün symbolisieren Wasser und Land und weisen auf die wechselvolle Geschichte der Gemeinde hin, die durch Überflutungen, Bedeichungen, Entwässerung, Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung geprägt wird.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Grün über blau-silbernem Wellenschildfuß drei mit den Stängeln sich überkreuzende silberne Eichenblätter über zwei goldenen Eicheln.
Die Gemeinde Ecklak liegt an der Peripherie der Naturräume Wilstermarsch und Kudenseemmoor. Der Wappeninhalt bezieht sich auf den Namen der Gemeinde, der sich von "Eicheln" (nd. eek) und seichten Gewässern (mnd. lake) herleitet. Der grüne Hintergrund bezieht sich sowohl auf die Bedeutung der Landwirtschaft als auch auf die natrurämliche Lage der Gemeinde am Westrand der Wilstermarsch.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Blau ein links gewendetes silbernes einmastiges Boot mit voller Besegelung, darunter zwei gekreuzte goldene Pfeifen.
Die Gemeinde Kudensee wurde erstmals 1454 unter dem Namen "Uth dem Kudensee" urkundlich erwähnt. Ihre Geschichte ist eng verbunden mit eingreifenden wasserwirtschaftlichen Maßnahmen und Veränderungen. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts kamen die ersten Siedler, die zunächst die Wiesen am Ufer des flachen Kudensee in Besitz nahmen. Sie bauten kleine reetgedeckte Katen auf das an den See angrenzende Moor. 1765 wurde der Bütteler Kanal zur Entwässerung des Kudensees gebaut. Durch den Bau des Nord-Ostsee-Kanals wurde das Gemeindegebiet in der Randlage durchschnitten. Um 1700 wurden Torftransporte auf dem Wasserwege vom Kudensee u.a. in den Hafen des nahegelegenen Brunsbüttel durchgeführt. Hierzu diente der "Kudenseer Kahn", ein neun m langer Lastkahn, der bis zu 7000 Soden Torf fasste. Dieses und eine damals verbreitete Tradition, nach der die Frauen des Dorfes pfeiferauchend vor ihren Haustüren zum Kartenspielen saßen, wird im "Kudenseer Leed" (Hans Kock) besungen. Darin heißt es: "Wat weer dat vörn Leben, wat weer't vörn Hallo, wenn die Törpkahns no Büttel sei'n to,... ...De schmökenden Frunslüd, de sitt nun nich mehr mit de Piep an Kanol vör de Dör,... Der "Kudenseer Kahn" im Gemeindewappen soll an die einstmals wirtschaftliche Bedeutung des Torfes und dessen Transport erinnern, die gekreuzten Pfeifen im Schildfuß an die im "Kudenseer Lied" besungenen rauchenden Frauen. Die blaue Hintergrundsfarbe bezieht sich auf die vielfältigen Beziehungen Kudensees zu den Gewässern und auf die Abhängigkeiten der Gemeinde von den naturräumlichen Gegebenheiten und den wasserwirtschaftlichen Maßnahmen, die ihre Jahrhunderte lange Entwicklung maßgeblich beeinflusste.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Rot über silberner Steinmauer ein schräglinker silberner Wellenbalken, dieser belegt mit einem blauen Wellenbalken, oben ein silberner Habichtkopf, unten eine silberne nach links geöffnete Klappbrücke.
Die Gemeinde Landrecht liegt im Landesteil Holstein im Naturraum "Wilster Marsch" und wird geprägt durch feuchte Wiesen, Weiden und Gewässer. Die Gemeinde wird durch die Bundesstraße 5 und die Bahntrasse Hamburg/Westerland in drei Teile zerschnitten. Ein idyllischer und sehr beliebter Weg führt entlang der Wilster-Au von Wilster zur Schleuse Kasenort. Die Wappenfiguren nehmen Bezug auf die Ortsteile: Die Steinmauer im Schildfuß bezieht sich auf den Steindamm, die Wellenfäden auf den Ortsteil Bischof sowie die Wilster-Au, der Habichtskopf auf Klein Hackeboe und die abstrahierte Klappbrücke bezieht sich auf Kasenort. Die Farben Blau, Weiß und Rot sind zugleich die Landesfarben von Schleswig-Holstein.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Über silbernem, mit drei blauen Wellenfäden belegten Wellenschildfuß ein mit Gegenspitze ausgeschnittener grüner Balken, darüber in Silber 4 grüne Rohrkolben mit schwarzem Kolben.
Die Gemeinde Landscheide ist durch die Zusammenlegung dreier so genannter Duchten entstanden, so bezeichnet man in den Elbmarschen die Unterbezirke eines Kirchspiels. Dieses waren die Flethseer Ducht, die Nordbünger Ducht und die Wetterndorfer Ducht. Der Ortsname entstand nach der Kirchspielgrenze." (W.LAUR,1992) Die Flethseer Ducht hat ihren Namen von den in den Elbmarschen typischen Wasserläufen (Fleeth, mnd.vlet = Fließ). Die Nordbünger Ducht weist auf eine im Norden liegende Landstelle hin (Bunge, mnd. buwinge = "Bau, Baugut, Landstelle") und Wetterndorf lässt sich mit "Dorf am Abzugs- oder Entwässerungsgraben" übersetzten. Die Gestaltung des Wappens soll an die drei Ursprungsbezirke des Kirchspiels erinnern. Die eingekerbte Teilungslinie bezieht sich auf die Brake, die sich mit "Stelle wo früher ein Deich von der Flut durchbrochen ist" deuten lässt. Diese Flethseer Brake ist bei der Dezemberflut des Jahres 1720 eingerissen worden. (W.LAUR, 1992) Die vier Rohrkolben im Schildhaupt symbolisieren die vier Ortsteile von Landscheide und stellen zudem einen Bezug zur Flethseer Brake her. Der blau-weiße Wellenschildfuß symbolisiert die drei Duchten. Der Wechsel von Blau, Silber und Grün soll zugleich die Abhängigkeit dieser Landschaft von den Überflutungen, Bedeichungen, der Entwässerung und der Landgewinnung widerspiegeln.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Grün zwischen blau-silbernem Wellenschildhaupt und schmalem silbernen Schildfußbord ein durchgehender goldener Kreuzknoten, darunter ein schräggestelltes silbernes Flügelkreuz einer Windmühle.
Die Gemeinde Neuendorf-Sachsenbande entstand im Jahre 2003 durch die Zusammenlegung der beiden ehemals selbständigen Gemeinden Neuendorf und Sachsenbande. Die beiden miteinander verbundenen Seile sollen dieses symbolisieren. Die Gemeinde liegt im Norden des Naturraumes Wistermarsch im Übergangsbereich zum Naturraum Kudenseer Moor. Die Wilster Au ist der südliche Grenzfluß der Gemeinde. Neuendorf-Sachsenbande liegt unter dem Meeresspiegel, hier befindet sich mit 3,539 m unter NN die tiefste Landstelle Deutschlands. Mit den silbernen und blauen Wellenfäden im Schildhaupt und der abstrahierten Senke im Schildfuß soll auf diese topografische Besonderheit hingewiesen werden. Der blaue Wellenfaden symbolisiert zugleich die Wilster Au. Die silbernen Mühlenflügel sollen an die landschaftstypischen Schöpfmühlen erinnern und somit an die historische Entwässerungstechnik, mit deren Hilfe diese charakteristische Marschenlandschaft, nach deren Eindeichung trocken gelegt und landwirtschaftlich nutzbar gemacht wurde.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Grün über blau-silbernem Wellenschildfuß eine silberne Windmühle, darunter sechs goldene Ziegelsteine 1:2:3.
Die Gemeinde Nortorf liegt im Naturraum Wilster Marsch. Die Hintergrundsfarbe "Grün" bezieht sich auf diese durch landwirtschaftliche Grünlandflächen geprägte Landschaft. Die Bockmühle weist auf die umfangreichen Entwässerungsmaßnahmen hin, durch die eine großflächige Besiedlung dieser Landschaft erst möglich wurde. Die goldenen (gelben) Ziegelsteine erinnern an die einstige Ziegelei in Nortorf und deren wirtschaftliche Bedeutung für die Region. Der Ortsname lässt sich mit "das nördliche Dorf" übersetzen. (W.LAUR.1992) und er leitet sich her von seiner Lage nördlich des ehemaligen Sladensees. Der Wellenschildfuß soll dieses symbolisieren.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Silber und Blau im Wellenschnitt geteilt. Oben wachsend die rot gekleidete heilige Margaretha mit goldener Märtyrerkrone, in der Rechten ein gesenktes goldenes Schwert, in der Linken ein goldenes Buch haltend und beiderseits begleitet von jeweils zwei sechsstrahligen blauen Sternen übereinander. Unten ein auf dem Rücken liegender, rot gezungter silberner Drache, mit der Spitze des Schwertes überdeckt.
Die Heilige im Wappen der Gemeinde St. Margarethen bezieht sich sowohl auf den auf sie zurückgehenden Namen des Ortes als auch auf dessen Vergangenheit. Der Ort lag vermutlich ursprünglich an anderer Stelle und hieß "Elredesfleth". Wegen häufiger Überschwemmungen wurde er im 16. Jh. an seinen heutigen Platz verlegt und hinfort nach der Schutzpatronin seiner Kirche, der hl. Margaretha, genannt. Die Märtyrerin Margaretha wurde wegen ihres christlichen Glaubens in einen römischen Kerker geworfen und gemartert. Den Versuchen, sie dem Heidentum zurückzugewinnen, widerstand sie; dieser Kampf wird im Wappen durch den Drachen symbolisiert. Der Widerstand der Einwohner gegen die zerstörenden Gewalten des Wassers ist mit dem Kampf der Margaretha gegen den Drachen der Versuchung vergleichbar. Die vier Sterne im Wappen vertreten die Gemeindeteile Heideducht, Kirchducht, Osterbünge und Stuven. Zugleich spricht die Vierzahl die engen Beziehungen zwischen St. Margarethen und den Nachbargemeinden Büttel, Kudensee und Landscheide an. Die untere, blaue Schildhälfte symbolisiert das Wasser der Elbe. Im übrigen sind die im Wappen dominierenden Farben Blau, Silber und Rot die Landesfarben Schleswig-Holsteins.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Grün und Blau durch zwei schmale vierwellige silberne Wellenbalken gesenkt geteilt. Oben eine silberne Bockmühle, unten ein silberner Stör.
Der Ortsname der Gemeinde Stördorf lässt sich mit "Dorf an der Stör" deuten. Die Gemeinde besteht aus vier Ortsteilen, nämlich Kasenort, Honigfleth, Käthen und dem Namen gebenden Stördorf. Die Bockmühle, eine landschaftstypische Windmühle, erinnert an die Bedeutung der Entwässerungsmühlen, die vor der Einführung elektrisch betriebener Schöpfwerke für die Trockenlegung der landwirtschaftlichen Nutzflächen sorgten. Der blaue und die beiden weißen Wellenfäden über einem Stör beziehen sich auf die drei Fließgewässer, die Stör, die Bekau und die Wüster Au, durch die die Gemeinde Stördorf wesentlich geprägt wird. Die vier Wellen der Wellenfäden symbolisieren die vier Ortsteile. Die grüne Hintergrundfarbe weist auf die Bedeutung der Landwirtschaft für die Entwicklung dieser Region hin.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Silber und Blau geteilt. Oben die rote Straßenfront eines Wilstermarscher Bauernhauses mit silbernem, in drei Stufen verbrettertem, oben mit einer Hinkklaue abschließendem Giebel. Unten ein einmastiger silberner Störewer unter vollen Segeln.
Die Gemeinde Wewelsfleth besteht bis heute aus zwei wirtschaftlich und sozial unterschiedlich strukturierten Siedlungsteilen, dem durch städtisches Gewerbe gekennzeichneten Kirchort und dem agrarwirtschaftlich geprägten Umland. Dieses wird insbesondere durch die Ortsteile Dammducht und Uhrendorf repräsentiert. Das Wappen nimmt auf diese sowohl topographisch als auch wirtschaftlich und sozial deutlich greifbaren Unterschiede Bezug. Das Schiff in der unteren Hälfte vertritt den Kern der Gemeinde, den eigentlichen Kirchort, der sich in früheren Jahrhunderten durch Schiffahrt und lebhaften Handel auszeichnete, aber auch namhaftes Gewerbe, darunter insbesondere die Schiffszimmerei, beherbergte. Die vielbeschäftigte Werft legt bis heute Zeugnis von dieser Vergangenheit ab. Die Figur des Störewers mit Schonertakelage und seitlichem Schwert, der auch zwei Masten aufweisen konnte, gibt das typische Transportmittel der einst von Wewelsfleth aus betriebenen Flußund Küstenschiffahrt wieder. Die ländlichen Distrikte werden repräsentiert durch das typische Hufnerhaus der Wilstermarsch, dessen der Straße zugekehrter Wohnteil in der oberen Wappenhälfte des Wappen gezeigt wird. Die Farben des Wappens sind die Landesfarben.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen.