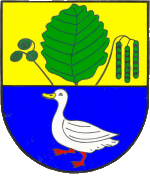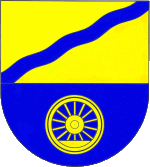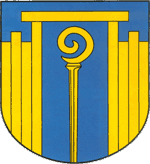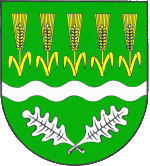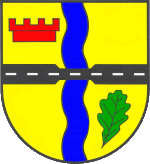Beschreibung der Wappen der amtsangehörigen Kommunen vom
Amt Arensharde Gesenkt geteilt von Gold und Blau. Oben drei aufrechte grüne Eichenblätter nebeneinander, das mittlere mit zwei Eicheln, unten an der Teilung ein unterhalbes, achtspeichiges silbernes Mühlrad.
Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Bollingstedt und Gammellund. Von besonderer Bedeutung für den Ort war seit dem Mittelalter die Wassermühle an der Bollingstedter Au mit dem ausgedehnten Mühlenteich, der wohl als Teil einer Burganlage anzusehen ist. Als erster Besitzer von Burg und Mühle überliefert ist die Familie "Porsfeld" (Postfeld), die ein Mühlrad im Wappenschild führte. Das halbe Mühlrad im Wappen von Bollingstedt bezieht sich deshalb sowohl auf die Mühle selbst als auch auf deren erste nachweisbare Besitzer. Es kennzeichnet den Gemeindeteil Bollingstedt auch insofern, als die Ortserweiterung neuerdings nördlich um den Mühlenteich herum erfolgt ist. Die Eicheln und die Eichenblätter nehmen "redend" Bezug auf den Ortsteil Gammellund. Der Namensbestandteil "gammel" bedeutet im dänischen "alt" und "lund" "Wald oder Hain". Gammellund bezeichnet also einen "alten Wald", und dies ist der heute noch im Gemeindegebiet vorhandene Eichenwald. Das Wappen ist in den Farben des Landesteil Schleswig und zugleich des Kreises Schleswig-Flensburg, Gold und Blau, gehalten, um die Zugehörigkeit der Gemeinde zu diesem Landesteil und zu diesem Kreis zu dokumentieren.
Das Wappen wurde am 6.2.1984 genehmigt. Entwurfsverfasser war Uwe Nagel, Bergenhusen.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Geteilt von Gold und Blau. Oben ein grünes Erlenblatt zwischen einem grünen Fruchtstand rechts und einem grünen Blütenstand links, unten eine schreitende silberne Ente mit goldenem Schnabel und roten Füßen.
Die Figuren des Gemeindewappens von Ellingstedt, Erle und Ente, beziehen sich beide auf den Namen der wappenführenden Gemeinde und setzen volkstümliche Namensdeutungen bildlich um. Die Wahl der Figur für die obere Hälfte des Wappens stützt sich auf die niederdeutsche Bezeichnungsform der Erle (Eller, Ellerboom), die der unteren nimmt die von Pastor J. R. F. Augustiny aus Hollingstedt 1852 in seiner Chronik des Kirchspiels Hollingstedt vorgeschlagene Ableitung des Ortsnamens von "Elling" oder "Alling" als dänische Bezeichnung für kleine Ente auf. Wildenten waren den Nachrichten des Chronisten zufolge an der das Gemeindegebiet berührenden Rheider Au als Brutvögel sehr verbreitet. Die Erle ist noch heute die für die Gemeinde typischste Baumart, die nicht nur im Niederungsgebiet der Rheider Au häufig anzutreffen ist, sondern neuerdings auch als Knickbepflanzung weitgehend Verwendung gefunden hat.
Das Wappen wurde am 11.11.1985 genehmigt. Entwurfsverfasser war Lothar Leissner, Itzehohe.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Gold ein blauer Schrägwellenbalken, begleitet oben von einem schreitenden Storch in natürlichen Farben, unten von einem schwarzen wikingerzeitlichen Schiff mit gerefftem roten Segel.
Die Motive für das Hollingstedter Wappen haben ihren Ursprung in der Geschichte dieser Gemeinde und in ihrer heutigen Bedeutung als Brutplatz des Weißstorchs. Im oberen Teil des Wappens ist ein schreitender Storch in natürlichen Farben als Wahrzeichen des "Storchendorfes" Hollingstedt wiedergegeben. Die Gemeinde gehört zu den wenigen Orten des Landes Schleswig-Holstein mit namhaftem Bestand an Horsten. Die Vögel finden ihre Nahrung in den Feuchtgebieten der Treenemarsch und der benachbarten Landschaft Stapelholm. Der blaue Schrägwellenbalken stellt die Treene dar, die unmittelbar an Hollingstedt vorbeifließt. Das Schiff in der unteren Hälfte des Wappens erinnert an die Bedeutung Hollingstedts zur Zeit wikingischer Kaufleute. Damals befand sich zwischen der großen Siedlung Haithabu an der Schlei und Hollingstedt an der Treene ein Haupthandelsweg der Wikinger. Hier wurden die Frachten auf dem Landweg zwischen den beiden Hafenorten befördert. Von Hollingstedt gelangten die Frachten auf der Treene und über die Eider in die Nordsee. Bei dem Schiff handelt es sich deshalb um ein Handelsfahrzeug und nicht um ein Kriegsschiff.
Das Wappen wurde am 21.5.1981 genehmigt. Entwurfsverfasser war Uwe Nagel, Bergenhusen.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Silber und Grün schräglinks geteilt. In verwechselten Farben oben eine altertümliche Eiche, unten ein Steingrab mit offener Vorder- und geschlossener Rückseite.
Das Wappen der bereits 1196 erstmals erwähnten Gemeinde Hüsby vereinigt ein Kultur- und ein Naturdenkmal, die als örtliche Besonderheiten im Bewußtsein der Einwohner fest verankert sind. Der Eichbaum stellt einen im Volksmund als "Brauteiche" bezeichneten, landesweit bekannten Baum im Gemeindegebiet dar: unter ihm sollen in früherer Zeit die Brautpaare auf ihrem Weg zur Trauung in der Michaeliskirche in Schleswig, der Pfarrkirche für Hüsby, einen Imbiß genommen haben. Bei dem Steingrab handelt es sich um eine denkmalpflegerisch wiederhergerichtete vorgeschichtliche Grabstätte. Sie steht stellvertretend für über dreißig vorgeschichtliche Grabhügel in der Gemarkung von Hüsby.
Das Wappen wurde am 18.10.1995 genehmigt. Entwurfsverfasser war Uwe Nagel, Bergenhusen.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Geteilt von Gold und Blau. Oben ein schräglinker Wellenbalken, unten ein Lokomotivrad in verwechselten Farben.
Die historische Entwicklung des Ortes von der Gründung bis zur Neuzeit wird durch die beiden Symbole des Wappens "gleichsam" eingefaßt. Der Name Jübek bedeutet "Jütenbach". Der damit zunächst bezeichnete Wasserlauf markiert nach Ansicht der Forschung die Südgrenze der jütisch-dänischen Besiedlung. Dieser Name der Au, die den Gammellunder See mit der Treene verbindet, ist später auf den hier entstandenen Ort übertragen worden. So steht der Wellenbalken im Wappen einerseits sowohl für den das Gemeindegebiet durchfließenden Bach als auch "redend" für den zweiten Namensbestandteil des Ortes, andererseits für dessen älteste, nur im Namen faßbare Vergangenheit. Im Jahr 1869 hielt die Neuzeit Einzug mit dem Anschluß des Ortes an das Schienennetz. Jübek wurde zu einem Bahnknotenpunkt, repräsentiert durch das Lokomotivrad im Wappen. Diese Entwicklung trug wesentlich zur Vergrößerung der Ortschaft und dem Zuzug von Gewerbe und Handel bei und verschaffte Jübek dadurch das Gesicht einer modernen Mittelpunktsgemeinde. Die Farben des Wappens zeigen die Zugehörigkeit zum Landesteil Schleswig.
Das Wappen wurde am 12.5.1980 genehmigt. Entwurfsverfasser war Heinz Reinhold, Stenderupfeld.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Blau ein wachsender goldener Bischofsstab, eingeschlossen von einem wachsenden goldenen Holztor.
Das Tor verweist auf eine historische Wasserburg, deren Gräben und Wälle noch heute auf dem Gemeindegebiet sichtbar sind. Der goldene Hirtenstab erinnert an ihre Funktion als Fluchtburg für die Bischöfe von Schleswig. Die beiden Säulen des Burgtores stehen für die ehemaligen Dörfer Arenholz und Lürschau, die zur heutigen Gemeinde Lürschau wurden. Der verbindende Querbalken ist das Symbol für diese Vereinigung. Die blaue Farbe steht für den die beiden Dörfer verbindenden Arenholzer See, die goldene Farbe für den geschichtsträchtigen Sand der Lürschauer Heide.
Das Wappen wurde am 27.7.2001 genehmigt. Der Entwurfsverfasser ist unbekannt.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Unter silbernem Schildhaupt in Grün eine scheibenförmige Fibel mit blauem Mittelfeld, breitem goldenen Rand und vier mit ihrem Scheitel dem Mittelpunkt zugewendeten goldenen Bögen; oberhalb und unterhalb der Teilungslinie fünf Eichenblätter - die beiden äußeren gestürzt, in verwechselten Farben.
Schuby ist als Ortsname dänischen Ursprungs und bedeutet "Walddorf". Für diese Bezeichnung stehen die Eichenblätter "redend" im Wappen. Die Region war noch im Mittelalter von dichten Eichen- und Laubmischwäldern bedeckt. Das ehemals königliche Pöhler Gehege auf dem Gemeindegebiet spiegelt noch heute diesen Naturzustand wider. Das Bronzeschmuckstück im Zentrum des Wappens ist Symbol für die durch Ausgrabungen erschlossene Frühgeschichte des Ortes. Gemessen an der Vielzahl und der Qualität der Fundstücke hat Schuby an den Handelsverbindungen des nahe gelegenen Haithabu offenbar partizipiert. Die Musterung der Fibel weist sie als Teil der Kleidung bereits christianisierter Bevölkerung aus. Die Fibel wurde zum Zusammenhalten der Gewänder benutzt. Die grüne Schildfarbe verweist neben der Naturlandschaft auf die Landwirtschaft, die mehr als Handel und Handwerk die hauptsächliche Existenzgrundlage des Ortes gewesen ist. Heute ist Schuby weitgehend Wohnvorort des nahegelegenen Schleswig.
Das Wappen wurde am 2.7.1986 genehmigt. Entwurfsverfasser war Gerd Guse, Schuby.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Grün ein silberner Wellenbalken, begleitet oben von fünf goldenen Ähren nebeneinander, unten von zwei schräg gekreuzten silbernen Eichenblättern.
Die Gemeinde Silberstedt entstand 1976 durch den Zusammenschluß der Gemeinden Esperstoft und Silberstedt und umfaßt deshalb heute neben diesen beiden auch die Ortsteile Hünding (früher Esperstoft) sowie Holm und Rosacker (früher Silberstedt). Durch die Vereinigung erhielt die Gemeinde die Funktion eines ländlichen Zentralortes. Wegen ihres nach wie vor überwiegend agrarwirtschaftlichen Charakters werden die fünf Ortsteile durch fünf Kornähren vertreten. Auf die herkömmliche wirtschaftliche Struktur und die damit verbundene ländliche Lebensform bezieht sich auch die grüne Tinktur des Wappens. Das silberne Band der Silberstedter Au teilt das Wappen in zwei Hälften. Zu denken ist aber auch an die Treene, die durch Esperstoft fließt und die Au weiter südlich aufnimmt. Die zwei Eichenblätter rufen den in früheren Jahrhunderten vorhandenen Waldreichtum des Gemeindegebietes in Erinnerung, beziehen sich durch die Zahl aber auch auf die beiden Ursprungsgemeinden und deren eigene Geschichte vor der Zusammenlegung.
Das Wappen wurde am 26.9.1985 genehmigt. Entwurfsverfasser war Uwe Nagel, Bergenhusen.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Gold ein blauer Wellenpfahl, überdeckt mit einem in der Mitte beidseitig eingekerbten schwarzen Balken. Rechts oben ein schwebender roter Zinnenbalken, links unten ein grünes Eichenblatt.
Der Wellenpfahl im Wappen von Treia repräsentiert die Treene, die mitten durch den Ort fließt. Der Flußname "Treja", dänische Variante für Treene, ist auf den Ort übertragen worden. Vielleicht kann man den Namen auch als das dänische Wort "Træ-Aa" auffassen, in der Bedeutung "Holz-Au". In Vergangenheit und Gegenwart ist Treia von Wäldern umgeben gewesen, angedeutet durch das Eichenblatt im Wappen. In wesentlichen Teilen bezieht sich das Wappen auf die Geschichte des Ortes. Seit dem 13. Jh. war Treia im Besitz des Bischofs von Schleswig, der hier eine befestigte Burganlage unterhielt. Der rote Zinnenbalken erinnert an das heute nur als Burghügel mit Grabenläufen erhaltene Schloß. Da in Treia die wichtige Handelsstraße von Osten nach Westen über eine Brücke führte, erhob der Bischof hier Wegezoll auf alle sowohl zu Land als auch zu Wasser transportierten Waren. Die Einkerbungen auf dem die Straße und die Brücke darstellenden schwarzen Balken symbolisieren den "Engpaß" der Zollstelle. In dem aus Wellenbalken und Straßenband gebildeten Kreuz mag man auch einen Hinweis auf die St. Nikolaikirche im Ort und die lange Tradition als Kirchspielort sehen.
Das Wappen wurde am 26.9.1985 genehmigt. Entwurfsverfasser war DIETER Raudies; Treia.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen.