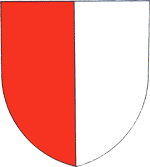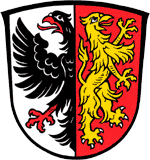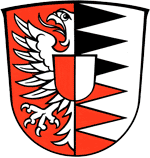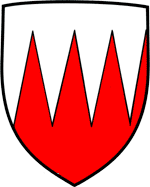Gespalten von Rot und Silber.
Das älteste, erstmals an einer Urkunde vom 13. 1. 1500 erscheinende Siegel zeigt als Wappen einen gespaltenen Schild mit der Umschrift +S+CIVIVM+DE+PVOCHLVN. Um die Verschiedenheit der Farben in den beiden Schildhälften anzudeuten, ist das linke Feld stark erhöht. Ein undeutlicher Siegelabdruck von 1512 hat zu den späteren Mißverständnis geführt, im Wappen sei ein Kreuz erkennbar. Ein nach der Jahreszahl über dem Schildrand 1529 angefertigtes 2.Siegel wiederholt unverändert Umschrift und Wappen des Vorgängers. In einem 3.Siegel von 1634 erscheinen erstmals in der vorderen Schildhälfte feine Arabesken (Damaszierungen), die nichts anderes sind als der barocken Heroldskunst gemäße bedeutungslose Verzierungen zur Belebung einfarbiger Flächen. Lipowsky hat dem Marktwappen 1812 noch die richtigen Farben Rot und Silber gegeben, war ja Buchloe 1311 durch Tausch an das Hochstift Augsburg gekommen, das diese Farben führte. In dieser Farbengebung und Form wurde das Wappen von Buchloe durch das StMdI. am 22.11.1836 ausdrücklich anerkannt. Damals war aber der Sinn der Wappenfarben schon in Vergessenheit geraten, die Arabesken hielt man für ein besonderes Wappenbild. Raisers Wappentafel (1834) gab erstmals dem in seiner Schlichtheit würdigen Gemeindewappen völlig grundlos die Farben Gold und Silber und setzte in das goldene Feld Blätter, die man für einen Buchenzweig in Anlehnung an den Ortsnamem hielt. Mehr als 100 Jahre schleppte sich, auch in den gemeindlichen Dienstsiegeln, der Irrtum fort, dem sogar noch Hupp (Sammlung HAG) zum Opfer fiel. Erst in neuester Zeit führten Nachforschungen des HstA. zur Anregung, wieder zum geschichtlich begründeten Wappen zurückzukehren. Die Entschl. des StMdI. Nr. I B 1-3008/29 vom 31. 5. 1950 gab Buchloe sein ursprüngliches Wappenbild zurück.
Zu Buchloe gehören noch die Ortsteile und früher selbständigen Gemeinden Honsolgen und Lindenberg. Honsolgen, führte früher ein eigenes Wappen.
Stadtteil von Buchloe
In von Rot und Silber gespaltenem Schild die Halbfigur des geharnischten hl. Mauritius mit umgürtetem Schwert, in der Rechten die Lanze, in der Linken die Märtyerpalme haltend.
Dieses Wappen wurde vom StMdI. Durch Entschl. Nr. 3008 c 19 am 17. 11. 1924 verliehen. Von Prof. Hupp entworfen, bezieht es sich in den Feldfarben auf die einstige Zugehörigkeit des Ortes zum Hochstift Augsburg, während der Heilige den alten Ortspatron darstellt.
Honsolgen führte das Wappen bis zur Eingemeindung nach Buchloe.
Wappen gespalten von Silber und Rot; vorne am Spalt ein roter bewehrter halber schwarzer Adler, hinten ein linksgewendeter goldener Greifenlöwe.
Das Gebiet von Jengen gehörte früher zum Fürstbistum Augsburg. Das Gemeindewappen übernimmt daher die Spaltung von Silber und Rot aus dem alten Hochstiftswappen. Als historisch bedeutsame Grundherr im Gemeindegebiet ist das Spital um das Franziskanerinnenkloster der Reichsstadt Kaufbeuren sowie das Kloster Steingaden nachweisbar. Der halbe Adler am Spalt ist dem Wappen der Reichsstadt Kaufbeuren, der Greifenlöwe dem Wappen des Klosters Steingaden entnommen.
Zu Jengen gehören noch die Ortsteile und früher selbständigen Gemeinden Eurishofen, Ummenhofen, Weicht, Weinhausen und Beckstetten.
Wappen gespalten, mit Herzschild gespalten von Rot und Silber. Vorne in Rot ein halber silberner Adler am Spalt. Hinten in Silber drei schwarze und drei rote Spitzen am Spalt.
Der Adler stammt von dem Kapitel des Stiftes St. Peter in Augsburg, das 1360 in den Besitz des Ortes kam. Die Wappen der Ortsteile Klein- und Großkitzighofen rühren von den Herren von Rorbach her, die im 13.Jahrhundert Besitzer dieser beiden Ortschaften waren. Der Ortsteil Dillishausen wurde als Tochtersiedlung der Stadt Buchloe gegründet und führt deshalb auch das Wappen der Stadt, das des Domkapitels Augsburg.
Zu Lamerdingen gehören noch die Ortsteile und früher selbständigen Gemeinden Dillishausen, Großkitzighofen und Kleinkitzighofen. Die beiden letzteren führten früher ein eigenes Wappen
Ortsteile von Lamerdingen
In Silber dreieinhalb aufrechtstehende rote Spitzen.
Das der Gemeinde durch das StMdI. Am 31. 1. 1951 (Nr. I B 1-3008/65) verliehene Wahrzeichen lehnt sich an das Stammwappen der Edlen v. Rorbach an, die zum altbayerischen Uradel gehörten. Wie das benachbarte Kleinkitzighofen (s. dort) war auch Großkitzighofen schon im 13. Jahrhundert im Besitz der Rorbacher. Um die Gleichartigkeit der grundherrschaftlichen Verhältnisse und die Ähnlichkeit der Namen der beiden Orte auch im Wappen zu versinnbilden, die Abzeichen aber doch voneinander zu unterscheiden, wurde auf Vorschlag des HstA. die Schildfigur beiden Orten zugebilligt, jedoch für Großkitzighofen unter Änderung ihrer Stellung im Schild und der Farben (Silber und Schwarz) des Rorbacher Wappens. Rot und Silber im Wappen von Großkitzighofen sind geschichtlich begründet, da seit 1303 das Augsburger Domkapitel durch Gutskäufe immer mehr Fuß in der Ortsflur faßte und 1308 auch das Dorfgericht an sich zog. Wappenentwurf von E. Werz.
Großkitzighofen führte das Wappen bis zu Gebietsreform (Zusammenlegung mit Lamerdingen,Kleinkitzighofen und Dillishausen.
In Silber dreieinhalb waagrechte linke schwarze Spitzen.
Das am 6. 11. 1950 durch Entschl. Des StMdI. Nr. I B 1 – 3008/69 verliehene Gemeindewappen entspricht dem Stammwappen der Edlen v. Rorbach, die seit 1296 als älteste bekannte Ortsherrschaft nachweisbar sind. Offenbar ist die aus dem Altbayerischen (Rorbach bei Wolnzach) stammende Familie durch Einheirat in das Allgäu gekommen. 1328 ging die Vogtei zu Kleinkitzighofen an Johann v. Langenmantel aus Augsburg über, der Margaretha von Rorbach geheiratet hatte. Das Familienwappen überliefern außer den Siegeln auch ein Schlußstein und ein Epitaph in der Kirche zu Waal und Philipp Apians Wappensammlung (1562). Die künstlerische Gestaltung des Gemeindewappens besorgte E. Werz. Über die Verwandtschaft der Wappen von Klein- und Großkitzighofen siehe dort!
Die Gemeinde führte das Wappen bis zur Gebietsreform.
In Silber aus silbernen Wolken wachsend der hl. Nikolaus in rotem Ornat, in der Rechten den Bischofsstab, in der Linken ein Meßbuch, darauf drei goldene Kugeln, haltend.
In Silber aus silbernen Wolken wachsend der hl. Nikolaus in rotem Ornat, in der Rechten den Bischofsstab, in der Linken ein Meßbuch, darauf drei goldene Kugeln, haltend.
Ortsteil von Waal
In Blau ein sechsspeichiges goldenes Rad, auf dem ien goldenes Tatzenkreuz steht.
Auf Vorschlag des HstA. Und nach einer Zeichnung von E. Werz verlieh das StMdI. mIt Entschl. Nr. I B 1- 3008/64 vom 13. 10. 1950 das auf die Wappen ehemaliger Grundherren des Ortes zurückgehende Wahrzeichen. Das schwäbische Uradelsgeschlecht v. Nordholz, das bis 1360 Burg und Ort Emmenhausen besaß, führte ein Rad als Schildfigur, das Augustinerchorherrenstift Hl. Kreuz in Augsburg, welches von 1609 bis 1803 Grundherrschaft war, seit Probst Lorenz Velman (1489 bis 1515) ein goldenes Kreuz in Blau als Klosterwappen. Das silberne Rad im Stammwappen der Nordholz wurde aus heraldischen Grunde im Gemeindewappen ebenfalls in Gold tingiert.
Die Gemeinde führte das Wappen bis zur Gebietsrefom (Zusammenlegung mit Waal, Waalhaupten und Bronnen).