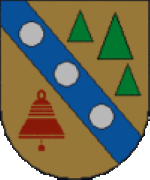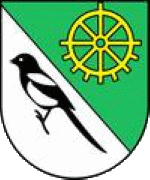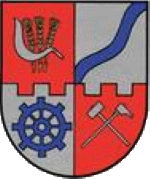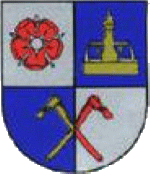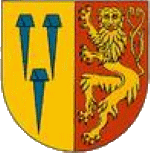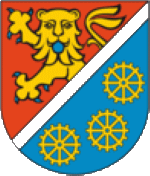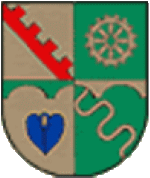In Gold ein blauer Schrägbalken, belegt mit drei silbernen Kugeln, oben drei stilisierte grüne Bäume, unten eine rote Glocke.
Der blaue Schrägbalken mit den drei silberfarbigen Kugeln deutet auf die ehemalige zugehörige Herrschaft hin. Das Adelsgeschlecht der Schönhals zu Albrechtenrode, nachweisbar bis in das Jahr 1277, führte drei Kugeln in seinem Wappen.
Die Kugeln symbolisieren die drei Ortsteile in der Gemeinde Alpenrod:
Alpenrod, Dehlingen und Hirtscheid.
Eine Urkunde aus dem Jahre 1469 besagt, dass eine Kirche an diesem Platz bis ins hohe Mittelalter hinauf reiche. Die Adeligen Schönhals trugen einen beachtlichen Betrag zum Guss der größten Glocke bei und stifteten den Liebfrauen-Altar. Die Kirche an sich wurde von den Grafen zu Sayn gestiftet. Die Kirche wird durch die Glocke symbolisiert.
Die drei stilisierten Bäume verweisen auf den reichen Waldbestand der Gemeinde.
Die Grundfarbe Gold und die rote Glocke symbolisieren die einstmalige Zugehörigkeit zur ehemaligen Grafschaft Sayn.
Wappen durch silbernen schräglinken Wellenbalken geteilt, oben in Rot schräggekreuzt, silberner Dachdeckerhammer und Rodehacke, unten in Blau drei goldene Ähren aus dem Schildrand wachsend.
Die drei goldenen Ähren symbolisieren die Bedeutung der Landwirtschaft als fast ausschließliche Ernährungsgrundlage in den vergangenen Jahrhunderten. Während das blaue Feld auf die ehemalige Zugehörigkeit zu Nassau (1806 – 1866) verweist, hebt das rote Feld die jahrhundertelange Zugehörigkeit zur Grafschaft Sayn und Sayn-Hachenburg (bis 1799) hervor.
Die Rodehacke deutet hin auf den Ortsnamen Astert-Asterode als Rodungsdorf und der Dachdeckerhammer auf die hier im 16. und 17. Jahrhundert zahlreich ansässigen Leyendecker und die Schiefergruben in der Gemarkung.
Schließlich symbolisiert das silberne Wellenband die Große Nister, die in vielen Windungen die Gemarkung durchschneidet.
Im schräggeteilten Feld vorne in Silber eine schwarze Elster mit silberner Brust und silberner Armdecke, den Schnabel geöffnet, hinten in Grün eine zweigeteiltes goldenes Rad, die obere Hälfte als Wagenrad, die untere Hälfte als unterschlächtiges Mühlenrad ausgebildet.
Der Ortsname wurde 1442 erstmals mit dem Schöffen Tilgin Hane von Hatzelgufte erwähnt (Struck: Das Cistercienserkloster Marienstatt im Mittelalter, Nr. 933). Übereinstimmend findet man bei verschiedenen Namenkundlern (Dittmeier, Kluge, Kehrein, Grimm) die Deutung des Namens als "Wo die Elstern schreien". So ist für Atzel die Elster zu setzen und gift oder guft ist das mittelhochdeutsche "die oder der guft" = lautes Schreien, von goufen = rufen, schreien.
Die halbe obere Radhälfte symbolisiert als Wagenrad die bisher wichtigste Ernährungsgrundlage, die Landwirtschaft, aber auch als Teil eines Förderturmes den einstigen Bergbau in der Gemarkung. Hier wurde schon seit Jahrhunderten Erz gefunden und verarbeitet, dies bezeugen auch die Flurnamen "In der Waldschmiede" und "Am Hüttenstück". Die untere Radhälfte zeigt auch die Mühlen in der Gemarkung: die ehemalige Ölmühle und die Atzelgifter Mühle. Letztere wird als Luckenbacher Mühle schon im 15. Jahrhundert oft erwähnt.
Durch Zinnenschnitt geteilt. Oben von Rot und Silber, unten von Silber und Rot gespalten. Oben vorn drei goldene Ähren, überdeckt von einer silbernen Sichel, hinten ein schräglinker blauer Wellenbalken. Unten vorn ein achtspeichiges blaues Mühlrad, hinten gekreuzt silbern ein Schlegel und eine Rodehacke.
Die rote Tinktur erinnert an die jahrhundertelange Zugehörigkeit zur Grafschaft Sayn-Hachenburg, während die blaue Farbe auf die zeitweise territoriale Zugehörigkeit zum Herzogtum Nassau hinweist. Die drei goldenen Ähren, die mit einer silbernen Sichel belegt sind, symbolisieren die herausragende Bedeutung der Agrarwirtschaft in der Gemeinde. Das blaue Mühlrad symbolisiert die Knochenmühle an der Wied.
Die blaue Wellenleiste versinnbildlicht die Wied, den größten Fluss des Westerwaldes, der durch die Gemarkung verläuft. Die silbernen Schlegel erinnern an Schieferabbau und Eisenverarbeitung in der Gemarkung.
Der Burgzinnenschnitt in der Mitte des Wappens verweist auf eine herausragende Besonderheit in der Geschichte Borods: Borod war um 1782 mit einer Dorfmauer umgeben, die im Gebiet der Verbandsgemeinde Hachenburg einmalig ist.
In Gold eine eingebogene blaue Spitze, darin: eine silberne Wellenleiste, über ihr eine silberne Kirche (zwischen linkem und rechtem Seitenschiff ein Turm mit Apsis), unter ihr ein silberner Fisch; vorne drei rote Schräglinksbalken, hinten drei rote Schrägrechtsbalken.
Geviert von Silber und Blau. 1: eine rote Rose mit silbernem Butzen, 2: ein goldener Brunnen mit zwei silbernen Wasserstrahlen, der eine nach rechts, der andere nach links. 3 und 4: zwei schräg auf dem Spalt sich kreuzende Rodehacken, in 3 silbern, in 4 rot.
Die Gemeinde Gehlert besitzt seit 1993 ein eigenes Ortswappen. Sowohl die dargestellten Gegenstände als auch die gewählten Farben des Wappens beziehen sich auf Fakten aus der Geschichte Gehlerts:
Die Farben gehen auf die landesherrliche Zugehörigkeit Gehlerts zurück. Rot und Gold waren die Wappenfarben der Grafen von Sayn und Sayn-Hachenburg, in deren Grafschaft Gehlert Jahrhunderte lang lag. Blau und Gold weisen auf die Zugehörigkeit Gehlerts ab 1799 zur Grafschaft Nassau-Weilburg bzw. ab 1806 zum Herzogtum Nassau hin.
Die rote Rose wurde dem Wappen des Klosters Marienstatt entnommen. Sie steht stellvertretend für den bis Anfang des 19. Jahrhunderts bestehenden Wirtschaftshof des Klosters Marienstatt. Die Abtei hatte in Gehlert nach ihrer Gründung einen umfangreichen Grundbesitz an sich gebracht und über Jahrhunderte das landwirtschaftliche Leben im Ort mit geprägt.
Die Rodungshacken im unteren Teil des Wappens dokumentieren die Besiedelungsgeschichte Gehlerts. Der Ort zählt zu den Dörfern, die in der vom 9. bis 14. Jhdt. währenden Siedlungsperiode nach Rodung auf vorherigen Waldflächen entstanden. Die Darstellung dieser Geräte bezeugt außerdem die bis in jüngste Vergangenheit anhaltende, das Dorf prägende Bedeutung der Landwirtschaft.
Der goldene Brunnen schließlich weist auf den Wasserreichtum der Gemarkung Gehlert hin. Wassergewinnungsanlagen in den Wäldern der Gemeinde versorgen nicht nur die örtliche Bevölkerung, sondern auch die Stadt Hachen-burg sowie die Westerwald-Brauerei in Hachenburg.
Spätgotischer Rundschild von einer gold-blau geteilten Leiste schräglinks geteilt, oben in Rot eine silberne Pflugschar, unten in Gold ein grüner Zweig mit drei grünen Buchenblättern.
Die Wappenfarben Rot und Gold der Reichsgrafschaft Sayn-Hachenburg sind als Feldfarben in das Ortswappen aufgenommen. Die geteilte Schrägleiste in den nassauischen Farben Blau und Gold dokumentiert die Grenze des Sayn-Hachenburgischen gegen Sayn-Altenkirchen und den noch heute sichtbaren Grenzwall mit Grenzweg. Dies war auch die Grenze zwischen dem Herzogtum Nassau und Preußen und ist heute die Kreisgrenze des Westerwaldkreises zum Landkreis Altenkirchen. Der geteilte Schild steht aber auch für die "Giesenhausener Höhe". Sie teilt als Wasserscheide die Wasserläufe zur Nister und zur Wied. Die silberne Pflugschar steht für die Landwirtschaft und der grüne Zweig mit den drei Buchenblättern symbolisiert den Wald.
Das Wappen zeigt in einem roten Schild ein Stadttor in Gelb aus regelmäßigen Quadersteinen, zwischen zwei jeweils im Obergeschoss mit zwei Fenstern versehenen Rundtürmen, von grünen, schiefergedeckten mit gelben Lilien gekrönten Turmhelmen bedeckt, dazwischen über dem spitzbogigen Tor mit hochgezogenem dreizackigen Fallgatter, drei Zinnen. Über diesen schwebt in einem gelben Schildrahmen ein doppelschweifiger, nach rechts gewendeter, springender, hersehender, blaubezungter und blaubewehrter Löwe, das Wappentier der Grafen von Sayn.
Das Doppelturmtor steht für das Obertor von 1292 der alten Stadtbefestigung mit den vier Toren Obertor (Osten), Untertor (Nordwesten), Notpforte (Norden) und Rahmpforte (Süden), der Löwe ist das Wappentier der Grafen von Sayn, dessen zwei Schweife die Verbundenheit der Adelshäuser Sayn und Wittgenstein symbolisieren.
Gespalten von Gold und Rot, vorn drei blaue Nägel, hinten ein goldener blaubewehrter rotgezungter herschauender Löwe.
Als erster Landschultheiß von Hattert wird Gerhaed Nayl genannt. Dieser Name lief durch vier Generationen, denen mittlerweile der Adelstitel verliehen wurde. Sie führten den Titel: "Denß Monhard Nayl von Hattenrode" und führten zuletzt das vorliegende Wappen. Die Nägel weisen redend auf den Namen "Nayl" hin.
In Gold ein blauer Wellensparren. Oben links ein offener roter Visierhelm. Oben rechts ein roter Erlenzweig. Unten ein roter Röhrenbrunnen.
Das Wappen der Gemeinde Heimborn wird durch einen blauen Wellensparren dreigeteilt, der den in der Gemarkung Heimborn gelegenen Zusammenfluss der "Kleinen Nister" und der "Großen Nister" zum Fluss "Nister" verdeutlichen soll. Es zeigt im unteren Teil einen roten Brunnen in Gold, dessen Ursprung wie schon im Eigennamen "Heimborn" enthalten, auf eine frühere Brunnenanlage im Ort hinweist. Begleitet wird er oben links von einem roten Helm auf goldenem Grund, der für das Geschlecht derer "von Holdinghausen" steht, die durch Eberhard von Lützelau dem Ortsteil Lützelau seinen Namen gegeben haben. Die Farben des Wappens Blau, Rot und Gold entsprechen denen des Wappens derer "von Holdinghausen", wodurch das Wappen geschichtlich begründet ist. Oben rechts ist ein roter Erlenzweig mit zwei Erlenfrüchten auf goldenem Grund abgebildet, der sinnbildlich für den Ortsteil Ehrlich steht, der aus dem früheren Namen für Erle - Irle - Irlich - Ehrlich entstanden ist.
Durch schräglinke silberne Leiste geteilt, vorn in Rot ein goldener, blau bewehrter und gezungter wachsender Leopard, hinten in Blau drei achtspeichige goldene Mühlräder bordweis.
In der linken oberen Hälfte steht der Sayn'sche Löwe und kennzeichnet die Zughörigkeit nach Hachenburg. Der Sayn'sche Löwe ist immer gold auf rot, blau gezüngt und bewehrt (blaue Zunge und blaue Krallen), doppelschwänzig und hat den Blick nach vorn.
In der rechten unteren Hälfte wurden die Naussauischen Farben Gold und Blau verwendet. Mehrere Mühlenräder symbolisieren die vier Mühlen, die einst um Heuzert an der Nister gelegen waren.
Zwischen den beiden Hälften ein silberner Streifen für die Nister.
Das Wappen zeigt in gespaltenem Schild vorn in Silber einen grünen, rot bezungten Drachen, durchbohrt von einem roten, spitz zulaufenden Kreuz; hinten in Rot einen herschauenden blau bewehrten goldenen Löwen.
Das Wappen ist aus dem Jahr 1958. Die vordere Hälfte des Wappenbildes zeigt die Symbole des Schutzpatrons von Höchstenbach, des heiligen Georg; die hintere Hälfte das Wappen-Tier des für die Ortsgeschichte entscheidenden Landesherren, des Grafen von Sayn. In ähnlicher Weise war das Gerichtssiegel von Höchstenbach von 1555/64 gestaltet.
In Schwarz ein goldener Kelch mit roter Innenwand und mit einem roten, blauen und roten Edelstein besetzten sechsseitigen Fuß.
Durch einen silber-blau geteilten Wellenbalken geteilt von Blau und Silber. Oben links und rechts je zwei silberne Ähren schräggekreuzt, unten ein blauer Hammer und eine blaue Rodungshacke schräggekreuzt.
Der Wellenbalken verweist auf die Lage des Dorfes im Einzugsgebiet von Lauterbach, Selbach und Erchebach, die alle in der Gemarkung entspringen. Die Rodungshacke verdeutlicht die Einordnung Kunderts als Rodungsort, der in der Ausbauphase des 9. bis 11. Jahrhunderts entstand.
Die Farbe Blau ist eine der beiden nassauischen Farben und erinnert an die Zugehörigkeit zum Herzogtum Nassau 1806 bis 1866. In der Anschlussphase bis zum Ende des zweiten Weltkrieges war Kundert Bestandteil der preußischen Provinz Hessen-Nassau, weshalb sich Silber als eine der preußischen Farben im Wappen wiederfindet.
Die beiden gekreuzten Ähren stehen für Landwirtschaft und der Hammer verweist auf die im Zeitraum 1896 bis 1926 betriebene Kupfererzgrube "Steinchen".
Im von Silber und Blau gespaltenen Schild schräglinks eine Wellenleiste, in der Mitte überdeckt von einer zweibogigen Brücke, beide in verwechselten Farben. Vorn oben ein blaues Mühlrad. Hinten unten schränglinks ein silberner Schieferhammer.
Die Wellenleiste erinnert an die Lage der Ortsgemeinde an der Kleinen Nister und den namensgebenden Lehmbach. Die blaue Farbe weist auf die kurzzeitige Zugehörigkeit von Limbach zum Herzogtum Nassau hin. Die Mühle steht für zwei Drahtzüge, die zu Beginn des 19. Jahrhundert entstanden, ein Eisenblechwalzwerk, eine Knochen- und eine Mahlmühle. Der Schieferhammer weist auf die Schiefergrube, die in Limbach betrieben wurde, hin. Die dargestellte Brücke ist das Wahrzeichen der Ortsgemeinde.
Das Wappen von Linden ist durch eine schräglinke Linie in Grün und Silber aufgeteilt, wobei den linken grünen Bereich eine goldene Linde mit Ast- und Blattwerk ziert und auf der rechten silbernen Seite eine blaue Fontäne aus einer silbernen Brunnenschale emporschießt.
Die Goldene Linde verweist auf die frühgeschichtlichen Aspekte, denn schon bei den Germanen spielte die Linde (lat.Tilia, gehört zur Gattung der Laubbäume) als "heiliger Baum" im Volksbrauchtum eine entscheidende Rolle. Feste, Trauungen, Versammlungen und Gerichte fanden bevorzugt unter Dorflinden statt. Durch die Grenzlage von Linden ist es aber eher unwahrscheinlich, dass die Gemeinde nach einer Gerichtslinde benannt wurde.
Die blaue Wasserföntäne deutet auf die Wied, die in Linden entspringt. Dabei ist auch von Bedeutung, dass zahlreiche Mühlen der Region die Wied als Antriebsquelle nutzten. Zudem bildete der Fluss im Jahr 948 die Grenze zwischen den Erzbistümern Trier und Köln.
Silberner Schild durch schräglinke, blaue Wellenleiste geteilt. Rechts oben ein grüner Eichenbaum mit 5 Blättern und 4 goldenen Früchten; links unten ein grüner Bergkegel, von rechts nach links ansteigend, aus dem Schildrand wachsend zum oberen Rand hin Basaltsäulen bildend.
Der Eichenbaum steht für die Deutung des Ortnamens Lochum: Ort am Lohe- oder Eichenwald. Der Bergkegel "Welterstein" ist ein Wahrzeichen der Gemeinde. Er besteht aus Basaltgestein und wird im Volksmund "Hänsel's Häuschen" genannt. Die Wellenlinie beschreibt den Lochumer Bach, der heute kanalisiert ist. Er war die Grenze zwischen dem Kurfürstentum Trier und der Reichsgrafschaft Sayn-Hachenburg, was gleichzeitig auch die konfessionelle Grenze war.
Wappen durch silbernen schräglinken Wellenbalken geteilt, oben in Rot zweigeteiltes goldenes Rad, als halbe Haspel nach oben und halben Mahlstein nach unten weisend. Unten in Blau in Halbkreisform angeordnet links oben anfangend: Ein silberner Würfel, ein silbernes Fünfeck und ein 2. silberner Würfel.
Die obere, halbe goldene Haspel erinnert an die bergbaulichen Tätigkeiten, die schon 1685 im Katzenbruch erwähnt und bis ins 20. Jahrhundert in den Gruben Edelstein, Philppszeche und anderen fortgeführt wurden. Der untere, halbe goldene Mahlstein weist auf die Mühlen in Luckenbach, die Bannmühle im 15. Jahrhundert und die Kind'sche Mühle im 19. Jahrhundert.
Das silberne Wellenband symbolisiert den Luckenbach (heute Rosbach), der in vielen Windungen die Gemarkung und das Dorf durchquert.
Die 2 silbernen Würfel deuten Basaltpflastersteine und das silberne Fünfeck einen Basaltsäulenkopf an und erinnern an die lange Basaltgewinnung in der Luckenbacher Ley. Des Weiteren symbolisieren diese drei Steine die drei Ortsteile: das größere Fünfeck den heutigen Ort und die zwei kleineren Würfel das ehemalige Niederdorf südlich und den Ortsursprung in der Wüstung Luckenbach nordöstlich des heutigen Ortes zwischen Struth und Nürst.
Das Rot des oberen Feldes dokumentiert die jahrundertelange Zugehörigkeit zur Grafschaft Sayn und das Blau des unteren Feldes diese zum Herzogtum Nassau.
Schild durch silbernen Schrägbalken, belegt mit einem grünen Eichblatt und zwei grünen Ähren oben und unten, jeweils schräggeteilt; oben in Rot ein herschauender blaubewehrter und -gezungter goldener Löwe, unten auf schwarzem Schiefer schräggekreuzt silberner Hammer und Schlägel.
Die Schrägbalken mit den 2 Ähren deuten die Landwirtschaft und das Eichblatt die Waldwirtschaft an. Der Löwe verweist auf die Zugehörigkeit zur Grafschaft Sayn bis 1799. Schiefer, Hammer und Schlägel verweisen auf den ehemaligen Dachschieferbergbau.
In Blau ein goldbedachtes silbernes Kapellentürmchen und zwei linke silberne Schrägfußwellenleisten.
Die blaue und goldene Tinkturen erinnern an die zeitweilige Zugehörigkeit der Gemeinde zum Herzogtum Nassau, das in seinem Wappen einen goldenen Löwen im blauen Feld führte.
Das Kapellentürmchen soll zum einen an die alte Sage um die Kapelle Marienbuchen und die Entstehung des Dorfes Merkelbach erinnern, zum anderen verweist es auf die heutige Herz-Jesu-Kapelle der Gemeinde.
Unter goldenem Schildhaupt, darin eine rote Wellenleiste, in Gold eine gestürzte eingebogene grüne Spitze, darin wachsend eine goldene Heugabel, begleitet von zwei schrägwachsenden Ähren; vorne und hinten je eine rote Rose mit grünen Kelchblättern und goldenen Butzen.
Die Gemeinde Mörsbach liegt im Gebiet des ehemaligen Auelgaues und gehörte zum Territorium der Grafschaft Sayn bzw. Sayn-Hachenburg. Die Wappenfarben der saynischen Grafen sind Rot und Gold.
Die vier Ortsteile Obermörsbach, Niedermörsbach, Burbach und Wintershof sind im Ortswappen durch die Teilung des Schildes in vier Felder symbolisiert.
In der Gemarkung Obermörsbach entspringt der zur Großen Nister hin fließende "Mörsbach", von dem der Ortsname abgeleitet ist. Er ist im goldenen Schildhaupt als rote Wellenleiste aufgenommen und die Farben Rot und Gold bezeugen die lange Zugehörigkeit zur saynischen Landesherrschaft.
Die Landwirtschaft ist im Ortswappen durch eine goldene Heugabel, als Urform bauerlichen Geräts, zwischen den beiden goldenen Ähren in der eingebogenen gestürzten grünen Spitze dargestellt. Die grüne Feldfarbe steht aber auch für den Gemeindewald, der ca. 1/4 der Gemeindefläche ausmacht und für das Landschaftsschutzgebiet "Kroppacher Schweiz", zu dem Mörsbach gehört. Die beiden roten Rosen in Gold stehen für den blühenden Dornenbusch im Wappen des Klosters Marienstatt. Sie erinnern somit an die erste urkundliche Erwähnung Mörsbachs mit dem Kloster Marienstatt.
Gespalten von Silber und Blau. Über einer gesenkten Wellenleiste in verwechselten Farben vorn ein blaues Kleeblatt, hinten eine silberne Säule. Unten ein Mühlrad in verwechselten Farben.
Die gesenkte Wellenleiste verweist zum einen auf Mudenbach als -bach-Ort, ferner auf die Wied als Grenzfluss der Gemarkung. Daneben deutet die Wellenleiste ebenso auf die etymologische Deutung des Namens Hanwerth hin (1358 erstmalig als "Hanuort"erwähnt). Der Ortsname endete auf -furt/vort und weist auf die Anlage der Siedlung an einer Furt (=seichte Übergangsstelle in Gewässern) hin.
Die silberne Säule symbolisiert den Steinernen Pfeiler, eine Säule, die sich am alten Kirchweg nach Kroppach befindet.
Das Mühlrad in verwechselbaren Farben hat eine ambivalente Bedeutung. Zum einen symbolisiert es eine 1672 in Hanwerth gebaute Ölmühle, zum anderen weist es auf die ehemalige Pulvermühle Mudenbachs hin.
Das Kleeblatt verweist auf die Bedeutung der Landwirtschaft in der Gemeinde Mudenbach. Die Farbe Blau deutet auf die frühere Zugehörigkeit der Gemeinde Mudenbach zum Herzogtum Nassau (1806-1866) hin, dessen Löwenwappen ein blaues Feld aufwies.
Gespalten von Rot und Silber. Vorn ein gestürztes silbernes Schwert mit schwarz-silbernem Griff, rundem goldenem Knauf und mit runden schwarzen Knöpfen an der goldenen Parierstange. Hinten eine blaue Wellenleiste, darüber eine schwarze Glocke, darunter ein achtspeichiges schwarzes Mühlrad.
Die Gemeinde Mündersbach wird erstmalig im Rahmen einer Besitzübergabe der Herren von Isenburg im Jahre 1247 urkundlich als "Mumdersbach" erwähnt. Die rote Tinktur erinnert an die Herren von Isenburg und die lange Zugehörigkeit zu den Grafschaften Wied und Sayn. Das silberne Schwert symbolisiert ein Lehnsgericht der Isenburg-Grenzauer.
Die schwarze Glocke deutet auf die St. Antonius-Kirche zu Mündersbach und die ehemaligen Glocken "1423" und "Ave-Maria, Johannes 1440" hin.
Die blaue Wellenleiste verweist auf den namensgebenden Mündersbach und das schwarze Mühlrad trägt der Ansiedlung mehrerer Mühlengewerbe in der Vergangenheit Rechnung.
Gespalten von Blau und Rot durch eine eingebogene, goldene Spitze, darin drei rote Rauten in Pfahlstellung; vorn ein silberner Hagedornzweig mit vier Blättern und einer Blüte mit goldenem Butzen; hnten ein steigender, doppelschwänziger, blaubewehrter, goldener Leopard.
Die drei Rauten verweisen auf das Wappen der Edelfreien von Nister. Sie waren bis zum Ende des 12. Jahrhunderts Grundherren auf Burg Nister in der Gemarkung Müschenbach.
Der silberne Hage- oder Weißdornzweig ist das Symbol der dicht vor der östlichen Gemarkungsgrenze gelegenen, 1222 an dieser Stelle angesiedelten Abtei Marienstatt. Sie hatte über 400 Jahre lang ein Hofgut zu Müschenbach.
Der blaubewehrte, herschauende Löwe = Leopard in Rot ist das Wappen der Grafen von Sayn. Müschenbach gehörte bis 1799 zur Grafschaft Sayn-Hachenburg. Das vordere, blaue Feld steht für die Zugehörigkeit zum Herzogtum Nassau bis 1866 und zur preußischen Provinz Hessen-Nassau seit 1866, deren Löwenwappen ebenfalls ein blaues Feld aufweisen.
In Gold ein schrägrechter blauer Wellenbalken, belegt mit drei aneinandergereihten goldenen Rauten; oben ein nach links gerichteter schwarzer Eisenhammer über schwarzem Amboss; unten ein grünes Eichenblatt mit Eicheln.
Der blaue Wellenbalken verweist auf den 879 erstmals erwähnten Bach Nister, nach dem die Gemeinde benannt ist. Die drei goldenen Rauten deuten auf die Edelherren von Nister hin. Der schwarze Eisenhammer mit Amboss symbolisiert das Hammerwerk in Nister. Das grüne Eichenblatt mit Eicheln verweist auf den Nauberg, 1460 als "die Nuwburg" erstmals urkundlich erwähnt.
In silbernem Feld ein grüner Berg im Schildfuß belegt mit 3 aufrechtstehenden, balkenweise angeordneten silbernen Spitzbarren, wovon der mittlere etwas größer ist; aus dem Berg wachsend ein schwarzer romanische Rundbogen, ein rotes, aus dem Schildfuß wachsendes Kreuz umschließend.
Der Berg im Schildfuß steht für den Prangenberg an der westlichen Gemarkungsgrenze, dessen Name zur Lokalisierung und Datierung einer ersten Kirchenweihe in Roßbach im Jahre 876 beitrug.
Das Grün des Berges und die aufgelegten Spitzbarren weisen auf die beiden wesentlichsten Erwerbszweige der Einwohner seit den frühesten Zeiten hin: Land- und Waldwirtschaft sowie Erzgewinnung.
Spitzbarren waren einst eine Form, in der rohes Eisen gehandelt wurde.
In einem Walddistrikt östlich des Dorfes fanden sich Reste von spätmittelalterlichen Schmelzöfen. Von 1788 bis 1898 gab es in Roßbach eine Erzgrube. Der schwarze Rundbogen symbolisiert die ehemalige romanische Kirche aus dem 13. Jahrhundert, die einem Bergschaden zum Opfer fiel und heute als Ruine dasteht.
Das rote Kreuz verweist auf den ersten Kirchenpatron. St. Maximin, und auf die erste Weihe durch Bischof Bertholph von Trier.
Darüber hinaus erinnern Rundbogen und Kreuz an die Gedenkstätte, die für die Toten beider Weltkriege im Innern der Ruine errichtet wurde.
Gespalten von Gold und Grün. In der Mitte von Schildrand zu Schildrand eine Brücke von vier Pfeilern und drei Bögen in verwechselten Farben Grün und Gold. Vorn oben schrägrechts ein viermal nach oben gezinnter roter Balken. Vorn unten eine blaue Rodehacke. Hinten oben ein goldenes Mühlrad mit rautenförmiger Nabe. Hinten unten ein goldener Flusslauf mit vier stark ausgeprägten Windungen.
Für die Burganlage, dem geschichtlichen Ursprung der Gemeinde, steht im Ortswappen der rote Schrägzinnenbalken in Gold. Seine vier Zinnen symbolisieren die vier Ortsteile, die Farben Rot und Gold die ehemalige saynische Landesherrschaft. Die grüne Feldfarbe steht für das Nistertal, den Wald und für die Kroppacher Schweiz. Die Nister ist als goldener Flusslauf mit vier ausgeprägten Windungen dargestellt, die wieder auf die vier Ortsteile verweisen. Für eine Mahl- und Ölmühle steht das goldene Mühlrad, dessen rautenförmige Nabe an die Grundherren zu Nister erinnern. Auf eine Rodungssiedlung deutet der Ortsname Wingert, der 1433 als Wyngenrode erwähnt wird. Dies wird durch die blaue Rodehacke in Gold symbolisiert, die aber auch gleichzeitig für die Landwirtschaft steht. Blau und Gold sind die nassauischen Farben. Im Mittelpunkt des Ortswappens befindet sich in verwechselnden Farben Grün und Gold die Nisterbrücke, die das Wappen in vier Felder teilt, die wiederum für die vier Ortsteile stehen.
Von Gold und Blau gespalten; vorne ein rotes Halbständerkreuz, hinten eine silberne Wellenleiste, darauf ein goldener, schwarzgefugter (hochgotischer) Spitzbogen, darunter aus dem Schildrand wachsend ein dreiblättriger goldener Buchenzweig.
Im Ortswappen ist vorne in abgewandelter Form als rotes Halbständerkreuz in Gold das im Wappen derer von Steinebach geführte gezähnte Ständerkreuz aufgenommen. Es symbolisiert gleichzeitig die Vereinigung der vier Ortsteile Steinebach, Schmidthahn, Langenbaum und Seeburg zur Ortsgemeinde Steinebach an der Wied. Die Farben Rot und Gold sind die wiedischen, aber auch die saynischen Wappenfarben. Der Ort gehörte "über der Bach" (Steinebach) zur Grafschaft Sayn, unterhalb zur Grafschaft Wied. Die silberne Wellenleiste steht für die Wied. Der goldene, schwarzgefugte Spitzbogen auf der silbernen Wellenleiste steht für die sagenumwobene Talburg, dem Wahrzeichen Steinebachs, von der noch der Turmstumpf mit seinem hochgotischen Torbogen erhalten ist.
Die beiden wellenförmigen blauen Felder stellen symbolisch den Hoffmannsweiher und den Haidenweiher dar. Der dreiblättrige goldene Buchenzweig erinnert an den im 13. Jahrhundert erwähnten Wald "Smiterhan", steht aber auch für die naturgeschützten "Hainbuchen" im Ortsteil Langenbaum.
Durch Wellenschnitt schrägrechts geteilt von Gold und Blau; vorne drei rote Rauten, hinten eine goldbesamte silberne Rose mit Stiel und Blättern.
Halb geteilt und gespalten; vorne oben in Silber ein schwarzes Kreuz, unten von Rot über Silber durch einen Spitzenschnitt des silbernen Feldes in das rote Feld übergreifen. Im hinteren Wappenteil ein goldener Löwe. Er steht in Rot und ist ‚ein linkssteigender, herschauender blaubewehrter und gezungter‘. Blaue Krallen, eine blaue Zunge und doppelgeschwänzt.
Liest man eine Wappenbeschreibung, wird man unwillkürlich an eine etwas altertümlich klingende, ja fast zopfige Sprache erinnert. Auch die Sprache der Jäger enthält solche Idiome, und in manchen Gerichtsurteilen tauchen ebenso rudimentäre Floskeln auf. „Halb geteilt und gespalten; vorne oben in Silber ein schwarzes Kreuz, unten von Rot über Silber durch einen Spitzenschnitt des silbernen Feldes in das rote Feld übergreifen“. Damit ist die linke Hälfte des Wappens heraldisch korrekt beschrieben, und wir können gleich wieder zur Geschichte zurückkommen. Die drei Spitzen haben eine doppelte Bedeutung. Einmal weisen sie auf die frühere Zugehörigkeit Wahlrods zum Stammesherzogtum der Franken hin (Engersgau). Solche Spitzen finden wir heute noch im bayerischen Wappen, wo sie auf die Zugehörigkeit Frankens zu Bayern hindeuten. Im Bayern-Wappen sind es gleich vier Spitzen, im Wahlroder Wappen indessen nur drei. Sie sollen gleichzeitig auf die drei Basaltkegel des Naturdenkmals „Beilstein“ hinweisen. Das schwarze Kreuz indessen deutet auf die Zugehörigkeit zum Erzbistum Köln hin, das im 13. Jahrhundert ein Machtvakuum ausnutzte und Wahlrod geschickt an sich brachte. Kommen wir nun zum rechten Wappenteil mit dem goldenen Löwen. Er steht in Rot und ist „ein linkssteigender, herschauender blaubewehrter und gezungter“. Das muß den Heraldikern ja regelrecht auf der Zunge zergehen. Blaue Krallen also, eine blaue Zunge und „doppelgeschwänzt“, wie es sich für einen echt Saynisch-Wittgensteiner Löwen gehört, und wie er auch auf dem Hachenburger Marktbrunnen als Skulptur Wache hält.
Unter silbernem Schildhaupt, darin schräggekreuzt ein schwarzer Schlägel und ein schwarzer Hammer, schräglinks geteilt durch eine silberne Wellenleiste von Rot und Grün. Ob ein gestürztes silbernes Eichenblatt mit Eicheln. Unten schräg aufgerichtet eine silberne Rodungshacke.
Hammer und Schlägel verweisen auf den Bergbau. Die silberne Wellenleiste symbolisiert den Welkenbach, nach dem die Gemeinde im Verlauf des 16. Jahrhunderts umbenannt wurde. Das silberne Eichenblatt verweist auf den hohen Waldbestand der Gemarkung. Die grüne Tinktur symbolisiert die Land- und Forstwirtschaft und die rote Tinktur die jahrhundertelange Zugehörigkeit zur Grafschaft Sayn. Die silberne Rodungshacke verweist auf Welkenbach als ursprünglichen Rodungsort.
Schild durch schräglinke silberne Wellenleiste geteilt. Vorne in Rot ein goldener, blaubewehrter, herschauender Löwe, hinten in Blau ein silberner, steigender Halbmond, überhöht von drei silbernen, sechsstrahligen Sternen.
Die silberne Wellenleiste symbolisiert die Wied, die dem Ort den Namen gab. Der goldene, blaubewehrte Löwe in Rot dokumentiert die Zugehörigkeit zur Grafschaft Sayn. Der silberne Mond mit den drei silbernen Sternen in Blau ist Teil des Wasserzeichens des in der Region einmaligen Papiermühle hergestellten Papiers und steht symbolisch für die insgesamt drei Mühlen, die im Ortsbereich betrieben wurden.
Gespalten durch einen silbernen Wellensparren bis zum Schildhaupt von Grün und Rot. Oben links drei goldene Ähren. Unten ein goldener Leopardenkopf.
Die drei goldenen Ähren in Grün verweisen auf die Land- und Forstwirtschaft, während der silberne Wellensparren - ein Bach, der einen Winkel bildet - als Sinnbild für den Ortsnamen steht.
Die Ortsgemeinde Winkelbach liegt im ehemaligen Herrschaftsgebiet der Grafen von Sayn. Deren Wappen - ein goldener, blaubewehrter Löwe in Rot - ist im Ortswappen angedeutet.