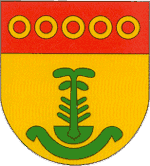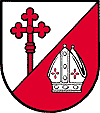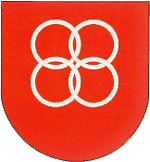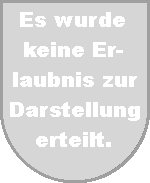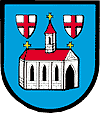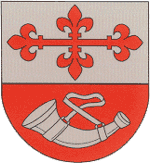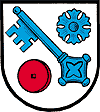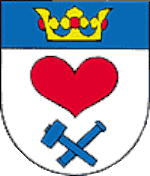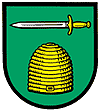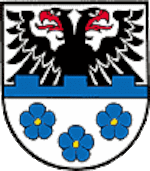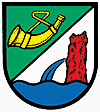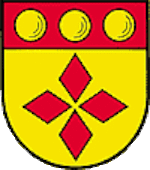Schräglinks geteilt von Silber und Blau, vorne ein rotes Kleeblattkreuz, hinten ein silbernes Hufeisen.
Bis zur Französischen Revolution gehörte Badem in der Prostei Bitburg zum Herzogtum Luxemburg; kirchenrechtlich zur Erzdiözese Trier. Der in Badem geborene Trierer Bischof Wilhelm Arnoldi (1842 - 1864) führte im Amtswappen ein rotes Kleeblattkreuz. Es kehrt hier in den kurtrierischen Farben wieder. Orts- und Kirchenpatron ist St. Egilius; sein Symbol ist ein Hufeisen. Es stht hier in den Farben Blau und Weiß, zugleich die landesherrliche Zugehörigkeit des Ortes in der Feudalzeit anzeigend.
Durch Spickelschnitt von Silber über Rot geteilt, oben drei rote Lilien, unten die silberne Krümme eines Bischofssstabes.
Im Jahre 893 wird Balesfeld erstmals als "Baldenshart" erwähnt (Bayer-Urkunden-Buch). Auch in Eiflia illustrata heisst er in der Version von 1498 "Baleshardt". Die ersten beiden Silben des Ortsnamens gehen zurück auf den Personennamen Baldin; die letzte Silbe "hardt" bedeutet Bergwald. Bergweide (Müller = ON II. S. 46).
Bis zum Ende der Feudalzeit, um 1800, gehörte Balesfeld in der Schultheisserei Seffern zum Fürstentum der reichsunmittelbaren Abtei Prüm. Hierfür steht die Krümme des Bischofsstabes.
Im Jahre 1775 baut Balesfeld eine Kapelle zu Ehren des heiligen Antonius von Padua (de Lorenzi S. 624). Seitdem wird der Heilige auch als Ortspatron verehrt. Er führt als Attribut eine Lilie (Pfleiderer S. 109).
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Ortsteil von Brimingen
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Von Silber über Rot schräglinksgeteilt, oben ein aufsteigendes rotes Vortragekreuz, unten eine silberne Mitra.
Burbach gehörte während der Feudalzeit bis um 1800 im Hof Seffern zur Fürstabtei Prüm. Die Zugehörigkeit zur Abtei Prüm ist symbolisiert durch eine Mitra.
Kirchen- und Ortspatron von Burbach ist seit altersher die heilige Margareta. Sie führt als Zeichen einen Kreuzstab. Ihr Zeichen ist im oberen Schild in der Form des Vortragekreuzes wiedergegeben.
In rot vier ineinander greifende silberne Ringe.
Dahlem gehörte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zum Amt Welschbillig im Kurfürstentum Trier. Dafür steht der Schildgrund, für den man eine Ausführung in roter Farbe wählte. Der Schöffe des Hochgerichtes Dahlem führte ein Siegel mit vier ineinandergreifenden Ringen. Diese sind in Schildmitte silbern symbolisiert.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
In Rot ein nach links schauender silberner, blau bewehrter und bezungterLöwe mit einer godenen Krone.
Das Wappentier geht auf das Wappen von Jakob Dudilndorf zurück, bezeugt im Balduineum aus den Jahren 1340–1345. Es handelt sich um den silbernen böhmischen Löwen aus Luxemburg.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Unter silbernem Schildhaupt mit 7 blauen Schrägrechtsleisten, in Rot ein goldenes, sechsarmiges Kreuz.
Gindorf zählt während der Feudalzeit unter luxemburgischer Landeshoheit zur Probstei Bitburg. Als Hinweis auf die geschichtliche Zugehörigkeit wurde die Tingierung der Leisten in den luxemburgischen Farben gewählt.
Kirchen- und Ortspatron seit altersher ist der hl. Urban. Das kath. Pfarramt Gindorf hat mitgeteilt, dass es sich dabei um den Papst Urban I. handelt (222-230), der als Patron verehrt wird.
Als Hinweis auf den Ortspatron ist das sechsarmige Kreuz (Ferula) im unteren Schildteil aufgenommen.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
In Rot ein silberner Schräglinksbalken, belegt mit zwei ineinandergeschlungenen roten Ringen. Oben eine silberne Kirche im Umriss der ehemaligen Pfarrkirche. Unten eine goldene Krone.
Bis zur Neugliederung der Pfarreien war Gransdorf der Sitz einer Mutterpfarrei mit zahlreichen Filialen. Wahrzeichen von Gransdorf ist auch heute noch die hoch über dem Ort gelegene ehemalige Pfarrkirche.
Kirchenpatron der alten Pfarrkirche ist die Himmelskönigin und Gottesmutter Maria, als deren Symbol die Krone im unteren Schildteil gewählt wurde. Bereits De Lorenzi schrieb: "Schon hieraus ist ersichtlich, dass wir in einem Abschnitt von hoher lokalgeschichtlicher Bedeutung stehen. In der Tat haben wir in der uralten Marienkirche von Grandesdorp die Mutterkirche einer ganzen Anzahl von neueren Pfarreien vor uns".
Obwohl die nahegelegene Zisterzienserabtei Himmerod nur bis 1212 am Patronat der Pfarrkirche teilhatte, war sie als Grundherrin bis zum Ende des Ancien Régime in Gransdorf gebütert. Ihr Symbol, zwei ineinandergeschlungene Ringe, befindet sich rot dargestellt im silbernen Schräglinksbalken.
Alle drei Wappenbilder sind auf ausdrücklichen Wunsch der Bürgerversammlung vom 17.12.1991 und des nachfolgenden Gemeinderatsbeschlusses in das Wappen aufgenommen worden.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
In Blau eine silberne Kirche mit rotem Dach und rot gedecktem Dachreiter; beiderseits desselben je ein schwebender silberner Schild mit durchgehendem rotem Kreuz.
Das Wappen der Stadt Kyllburg geht zurück auf das frühgotische Schöffensiegel von 1347, das einer Lehensurkunde von Jakob von Kirchberg anhängt. In dem Bauwerk wird die Stiftskirche im damaligen Bauzustand vermutet. Die Stadtfarben sind Rot und Weiss.
Unter silbernem Schildhaupt, darin ein blaues Schwert mit goldenem Griff, in Schwarz ein schrägrechter, rot-weiss geschachteter Balken.
Die Grundherrschaft über Kyllburgweiler übte bis zum Ende der Feudalzeit das adelige Zisterzienserkloster St. Thomas aus. (Becker, das Kyllburger Land, S. 327). Als Hinweis hierauf ist im unteren Schild das Wappen der Zisterzienser (St. Bernhardswappen) aufgenommen.
Die alte Kapelle in Kyllburgweiler führte das Patrozinium der Hl. Lucia. Sie war Kapellen- und Ortspatronin. 1749 wurde die Kapelle umgebaut. Heute führt sie den Hl. Wendelin als Patron. Aber noch bis zum Ende des 19.Jahrhunderts wurde das Lucia-Fest (13. Dez.) in der Kapelle feierlich begangen. Dabei wurden Hanf, Flachs und Korn geopfert, und deren Erlös für die Kapelle verwendet. (de Lorenzi. S. 300; Becker a.a.O..S. 327). In Wahren dieser Tradition wurde ihr Symbol in das Gemeindewappen aufgenommen. Sie führt als Attribut ein Schwert. (Pfleiderer. S. 152).
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
In von Blau über Silber geteiltem Schild oben 9 (5:4) goldene Kugeln, unten ein rotes Schildchen.
Bereits das Gerichtssiegel von Malberg aus dem Jahre 1565 zeigt als Siegelbild einen Ritter, der als St. Quirinus identifiziert wurde. Der heilige Quirinus ist seit Jahrhunderten Orts- und Kirchenpatron von Malberg. Sein Zeichen sind 9 goldene Kugeln, sie kehren wieder im oberen Schildteil des Gemeindewappens. Das rote Schildchen in Weiß führen die Herren von Malberg bereits seit dem 14. Jahrhundert. In allen Wappen derer von Malberg kehrt es wieder, auch im Wappen von Veyder. Es ist das Zeichen von Malberg und wurde daher auch in das Gemeindewappen aufgenommen. Das Wappen wurde 1974 durch die Regierung genehmigt. Fahne: rot-weiß.
In silbernem Schild ein roter, mit 3 goldenen Kugeln belegter Schräglinksbalken, oben ein rotes Schildchen, unten eine blaue Pflugschar.
Seit langer Zeit ist Kirchen- und Ortspatron von Malbergweich der Hl . Nikolaus. Sein Attribut sind 3 goldene Kugeln. Sie sind im roten Schrägbalken als Symbol des Ortspatrons Nikolaus wiedergegeben.
Malbergweich ist der alte "vicus iuxta Malberg", der bis um 1800 ein Teil der Herrschaft Malberg war. Als Hinweis auf diese alte geschichtliche Tradition, ist im oberen Schildteil das Zeichen der Herren von Malberg, ein rotes Schildchen auf silbernem Grund aufgenommen.
Die Wirtschaftsstruktur von Malbergweich ist seit jeher landwirtschaftlich bestimmt gewesen. Auch in einer Zeit in der sich weithin ein Strukturwechsel in den Gemeinden bemerkbar macht, ist Malbergweich noch immer überwiegend landwirtschaftlich orientiert. Als Hinweis auf diese alte und noch gültige Wirtschaftsstruktur ist ein antikes Pflugschar im unteren Schild wiedergegeben.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Geteilt, oben in silber ein rotes Glevenkreuz, unten in Rot ein silbernes Jagdhorn.
Das Glevenkreuz ist dem Wappen des Klosters Echternach entlehnt. Das Jagdhorn ist Attribut des Ortspatrones Hubertus.
In Silber ein blauer, schrägrechts gewendeter Schlüssel, vorn ein roter Schleifstein, hinten eine blaue Kornblume.
Als Symbol des Orts- und Kirchenpatrons St. Petrus steht dessen Symbol, der Schlüssel, im Wappenschild. Das Patronat besteht seit Jahrhunderten, bestätigt auch im Visitationsprotokoll von 1576. Auf Wunsch der Gemeindevertretung soll das Wappen in den weiteren Symbolen die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde widerspiegeln. So steht der rote Schleifstein für die schon sehr alte und ausgedehnte Sandsteinindustrie, die blaue Kornblume für den Wirtschaftsfaktor Landwirtschaft. Die Schildfarbe Weiß mit den Symbolfarben Rot und Blau sin Hinweis auf die Farben von Kurtrier (rot-weiß) und des Herzogtums Luxemburg (blau-weiß), unter die Neidenbach geteilt war. Genehmigung des Wappens durch die Regierung 1977.
Unter blauem Schildhaupt mit goldener Krone und roten Steinen, in Silber blauer Schlegel und Meißel gekreuzt, überhöht von einem roten Herzen.
Im Jahre 1960 wurde Neuheilenbach autonom. Bis zum Ende der Feudalzeit gehörte es zum Fürstentum der Reichsabtei Prüm. Als Hinweis darauf ist im Schildhaupt eine Krone aufgenommen.
Bis um 1950 war die Wirtschaftsstruktur des Ortes wesentlich durch die Sandsteinbearbeitung bestimmt. Schlegel und Meissel deuten darauf hin.
Die Kapelle von Neuheilenbach steht unter dem Patronat des Herzens Mariae. Dies ist zugleich auch das Ortspatrozinium. Durch die Wiedergabe eines Herzens ist darauf Bezug genommen.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
In Gold ein roter Sparrenbalken, begleitet oben von zwei roten sechsstrahligen Sternen, unten von einer roten Rose mit goldenem Butzen.
Am Landeshauptarchiv Koblenz konnte ein altes Gerichtssiegel für Oberkail festgestellt werden. Es befindet sich an einer Urkunde vom Jahre 1584 und enthält die gleichen Symbole. Es ist anerkennenswert, dass die Gemeindevertretung an diese alte Siegel- und Wappentradition anknüpfte und den Siegelinhalt als Gemeindwappen übernahm. Ohne Zweifel ist der Sparren- oder Zickzackbalken im alten Gerichtssiegel dem Wappen der Grafen von Manderscheid-Kail entnommen, denen die Herrschaft Oberkail über Jahrhunderte gehörte. Fahne: gelb-rot. Genehmigung durch die Regierung 1977.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
In Silber ein durchgehendes rotes Kreuz, im Schildhaupt belegt mit einem rechtsgewendeten blauen Schlüssel.
Während der Feudalzeit gehört Orsfeld bis um 1800 im Amt Kyllburg zum Kurfürstentum Trier. Grundherr war das Domkapitel Trier (Fabricius S. 151). Als Hinweis auf diese jahrhundertelange Landeszugehörigkeit wurde das kurtrierer Kreuz in den Schild aufgenommen.
Schutzheiliger von Orsfeld und Patron der Kirche war immer St. Petrus. Dieses Patronat wird bereits im Visitationsprotokoll vom Jahre 1570 bestätigt. Eine zusätzliche Bestätigung gibt die Figur des hl. Petrus über den Eingang zum Vorraum der Kirche mit dem darüber befindlichen Chronogramm vom Jahr 1781 (vgl. Becker, Kyllburger Land, S. 458).
Das Symbol des hl. Petrus ist der Schlüssel. Er wurde als Zeichen des Schutzpatrons von Orsfeld in den oberen Schildteil aufgenommen.
In Rot ein goldener Dornenbalken. Oben ein wachsender golden gekrönter, blau bewehrter, doppelt geschwänzter silberner Löwe. Unten ein silberner, mit goldenem Reisegepäck belandener Bär; das Reisegepäck wird durch einen schwarzen Gurt gehalten.
Bis zum Ende der Feudalzeit war Pickließem in die Herrschaften Dudeldorf und Seinsfeld geteilt und gehörte insgesamt zum Herzogtum Luxemburg. Bis zur kommunalen Neugliederung am 6. November 1970 wurde Pickließem von der Bürgermeisterei/Verbandsgemeinde Dudeldorf verwaltet. Als Hinweis auf die enge Verbindung zu Dudeldorf befindet sich oben der wachsende Löwe aus dem Dudeldorfer Wappen.
Als Kirchenpatron ist der Heilige Bischof Maximin von Trier im Visitationsprotokoll des Jahres 1570 erwähnt. Sein Symbol, ein mit Reisegepäck beladener Bär, ist im unteren Feld übernommen worden. Bereits in der im 8. Jahrhundert verfassten Vita St. Maximins wird berichtet, dass ein Bär auf der Reise des Heiligen nach Rom das Lasttier Maximins gefressen habe. Daraufhin habe der Heilige dem Bären befohlen, des Dienst des Lasttieres zu übernehmen und das Reisegeäck zu tragen.
Als Hochgerichts- und Grundherren waren mindestens seit 1323 die Inhaber der Herrschaft Seinsfeld in Pickließem vertreten. Der Galgen des Hochgerichts Seinsfeld befand sich in der Gemarkung Pickließem.
Die Lontzen, gen. Roben, besaßen von vor 1511 bis 1646 die Herrschaft Seinsfeld als Manderscheid-Blankenheimisches Afterlehen von Luxemburg. Ein Familienzweig derer von Lontzen scheint in Pickließem gewohnt zu haben, denn Bärsch schreibt: "Hans Ludwig von Lontzen genannt Roben, zu (Pick-) Lissem, heirathete, 1603, Maria Elisabeth von Gunderstorf und, nach deren Tode, eine Schenk von Nydeck. Er hinterließ zwei Töchter: a. Anna Johannetta wurde die Gattin Arnolds Deutsch von der Kaulen, der durch sie einen Antheil an (der Herrschaft) Seinsfeld erhilet (...)". Aus dem Wappen derer von Lontzen, (in blauem Schild ein durchgehendes goldenes Dornenkreuz), ist der goldene Dornenbalken in das Ortsgemeindewappen integriert worden.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
In Grün ein goldener Bienenkorb, darüber ein rechts gewendetes, silbernes Schwert mit goldenem Griff.
St. Thomas führt den Namen des Bischof und Märtyrers Thomas Becket. Das Schwert ist das Zeichen von St. Thomas Becket. Zugleich war er auch Patron des um 1185 gegründeten Zisterzienserklosters. Diese Klostergründung prägte den Ort. Seit der Neugründung des Zisterzienserordens hat der heilige Bernhard von Clairvaux das kirchlich-religiöse Leben maßgelich beeinflußt und selbst 68 Klöster gegründet, darunter das benachbarte Himemerod, dessen Jurisdition die Abtei St. Thomas unterstand. Sein Zeichen, der Bienenkorb, ist übernommen, da St. Thomas über Jahrhunderte durch das Zisterzienserkloster weithin geprägt und gestaltet wurde. Die grüne Schildfarbe ist Hinweis auf die Lages des Ortes inmitten grüner Waldungen.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Durch blauen Zinnenbalken geteilt, oben in Silber ein wachsender, doppelköpfiger, schwarzer Adler, unten 3 (2:1) blaue Flachsblüten mit goldenen Butzen in Silber.
Die Burg Seinsfeld war Jahrhunderte bestimmend für den gleichnamigen Ort. Sie ist die einzige, noch bewohnte Wasserburg in Rheinland-Pfalz. Als Hinweis auf sie steht der blaue Zinnenbalken.
Grundherr von Seinsfeld war die bedeutende Abtei St.Maximin Trier. Sie erbaute auch 1739-41 die heutige Pfarrkirche. Später kam Seinsfeld an die Abtei St.Thomas. Dennoch behielt die Abtei Maximin zwei Drittel des Zehnten und das Präsentationsrecht. Die Abtei St.Maximin führt im Siegel einen doppelköpfigen Adler.
Die Wirtschaftsstruktur von Seinsfeld ist auch heute noch weithin landwirtschaftlich bestimmt. Für sie stehen die Flachsblüten im unteren Schildteil.
Über blauem Wellenschnitt-Schildfuß schräglinks von Grün über Silber geteilt, vorn ein goldenes Jagdhorn, hinten ein roter Steinbrunnen mit Wasserauslauf rechts.
Der Ortsname Steinborn geht mit dem Wortstamm "brunn", "bronn" zurück auf das althochdeutsche "brunna" und das mittelhochdeutsche "brunne". "Born" gehört vorwiegend dem fränkisch-hessischen Sprachgebiet an. Es bedeutet Brunnen, Quelle. So ist das Wappen von Steinborn ein sogenanntes "redendes Wappen". Das Jagdhorn im oberen Schildteil weist hin auf den Kirchen- und Ortspatron St. Hubertus, der bereits im Jahre 1570 im Visitationsprotokoll von Seinsfeld als Patron von Steinborn angegeben ist. Die Verleihung des Wappens durch die Regierung erfolgte im Jahr 1977.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Von Silber über Rot geteilt, oben ein roter Sparrenbalken, unten drei goldene Ähren.
Usch gehörte bis zum Ende der Feudalzeit im Amt Kyllburg zum Kurfürstentum Trier. Ende des 18. Jahrhunderts wird eine Kapelle erbaut, deren Patronin die hl. Walburga wird. (KD Kr. Bitburg; S. 239). Seitdem gilt sie auch als Patronin des Ortes.
Usch wird in Beyer, Urkundenbuch 1144 und 1193 als "Hussa" angegeben. (Müller, ON, S. 52). Im 14. Jahrhundert ist ein Conrad Husch Burgmann des Erzbischofs Balduin genannt (Hontheim, Historia Treverensis). Offenbar derselbe, der von Gruber in Wappen des mittelrheinisch-moselländischen Adels S. 90/91 um 1340 als "Conrad Husch, trierischer Burgmann zu Manderscheid" genannt ist. Sein Wappen, ein Sparrenbalken steht im oberen Schildteil.
Das Attribut der Ortspatronin St.Walburga, 3 Ähren, ist im unteren Schildteil wiedergegeben.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Unter rotem Schildhaupt mit 3 goldenen Kugeln, in Gold ein rotes Rautenkreuz.
Während der Feudalzeit gehört Wilsecker im Amt Kyllburg zum Kurfürstentum Trier. Es ist bereits 893 erstmals urkundlich erwähnt.
Sehr früh ist auch eine Kirche in Wilsecker urkundlich belegt. Bereits im Prümer Güterverzeichnis von 1222 erwähnt sie Caesarius als "sita in uilla appellatur willesacger", (gelegen in dem Ort der Willesacer genannt wird). Patron der Kirche und des Ortes ist St. Nikolaus. Er führt als Attribut 3 goldene Kugeln.
In der Heimatgeschichte erscheinen seit der Mitte des 13. Jahrhunderts die Ritter von Wilsacker/Wilsecker. Ihre Grablege hatten sie offenbar in der Stiftskirche Kyllburg; dort sind noch verschiedene Epithaphien mit dem Wappen der von Wilsecker erhalten.
Das Geschlecht von Wilsacker/Wilsecker, so auch von Cono von Wilsacker 1356, führte als Wappenzeichen in Gold 5 (3:2) rote Rauten (Gruber, S. 140/141).
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir nicht vor.
Von Silber über Rot durch 3 flache Spitzen geteilt, oben 2 grüne Buchenblätter, unten eine silberne Lilie.
Zendscheid wird im Jahre 1036 bei Goertz, Mittelrheinische Regesten als "Cinceith" erstmals erwähnt. Mittelhochdeutsch "sceit", "sceid", neuhochdeutsch "scheid" bezeichnet jede Art von Grenze. Zunächst bezieht es sich auf Bergrücken und Bergwälder; oft ist es auch "geradezu mit Berg Synonym". (Müller, II 61). Dittmaier deutet es als "bewaldete Erhöhung" (Rheinische Flurnamen. S. 262).
Als Hinweis auf die Etymologie des Ortsnamens stehen daher im Entwurf drei flache Spitzen, von 2 grünen Buchenblättern überhöht.
Seit 1887/98 hat Zendscheid eine eigene Kapelle; Patronin von Kapelle und Ort ist die hl. Jungfrau Maria. Als Hinweis darauf steht im unteren Schildteil ihr Attribut, eine silberne Lilie.
Zendscheid gehört bis zum Ende der Feudalzeit im Amt Kyllburg zum Kurfürstentum Trier. (LHA Koblenz, 1 C, 14913 ff.). Als Hinweis hierauf sind die Schildfarben Rot und Silber gehalten.