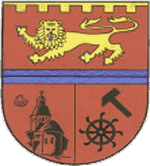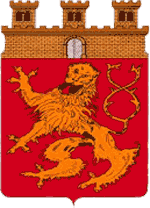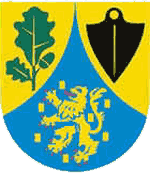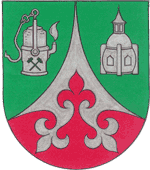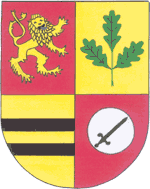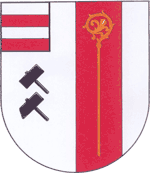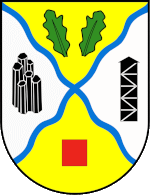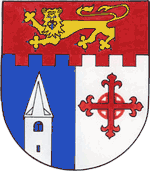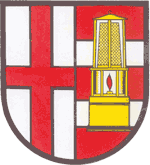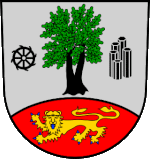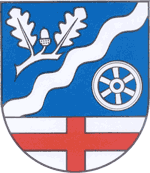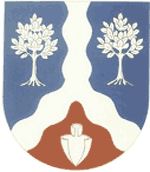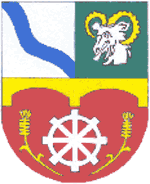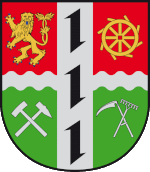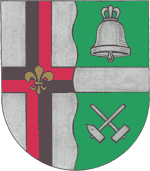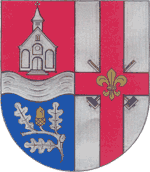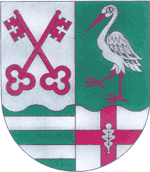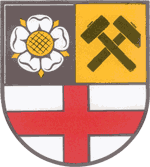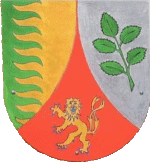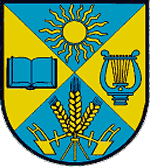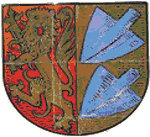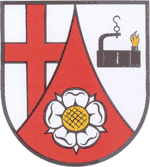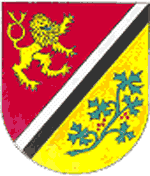Unter goldenen Zinnenschildhaupt von Rot über Gold durch einen silber-blauen Wellenbalken geteilt, oben ein blau bewehrter und gezungter goldener leopardierter Löwe, unten ein betagleuchteter roter Kirchturm, begleitet vorn von einem roten Hammer, hinten von einem roten Mühlrad.
Die sieben Zinnen am oberen Rand des Wappens symbolisieren die Stadtrechte, die Almersbach im Jahre 1357 von Kaiser Karl 4. erhielt. Die Original-Urkunde befindet sich im Landeshauptarchiv Koblenz.
Der Löwe darunter auf rotem Grund stellt den Saynischen Löwen dar. Es handelt sich hierbei um einen blaubewehrten und gezungten, golden leopardierten, doppelschwänzigen Löwen.
Die beiden Flüsse Wied und Almersbach wurden als doppelte, blaue Linien horizontal in das Wappen aufgenommen. Sie sind in blauer Farbe gehalten, um das Wasser zu symbolisieren.
Der untere Teil des Wappens ist in der Mitte geteilt.
Auf der linken Seite ist die spätromanische Kirche als ältestes Bauwerk des Ortes dargestellt. Hierbei wurde eine Grafik von Herrn Kurt Wind aus Altenkirchen übernommen. Die links oben neben der Kirche etablierte „Jakobsmuschel“ spiegelt im Innenraum der Kirche befindliche Freske wieder.
Die rechte Seite trägt zwei Symbole. Im unteren Bereich steht das Wasserrad für die alte Papiermühle.
Der Hammer darüber symbolisiert das alte Hammerwerk im Hoffnungsthal. Auch hier wurde die Farbe Rot der Grundherrschaft Sayn gewählt.
Die Symbole wurden in neutralem Schwarz gezeichnet.
Die Genehmigungsurkunde wurde am 25. März 2004 ausgestellt.
In rotem Schild ein doppelgeschweifter leopardierter goldener Löwe mit vollem Antlitz; auf dem Schild eine dreitürmige Sandsteinfarbige Mauerkrone.
Das Wappen wird schon seit 1907 von der Stadt geführt.
Schild durch eingebogene blaue Spitze, darin ein rotgezungter und –bewehrter goldener Löwe, begleitet von goldenen Schindeln, gespalten; vorne in Gold zwei grüne Eichblätter mit grüner Eichel, hinten in Gold ein schwarzes Rodehackenblatt.
Alle drei Dreistellungen sind bewusst in historischen Zusammenhang mit dem Ortsnamen Berod gestellt.
Das Eichenlaub als Symbol der früher im Westerwald vorherrschenden Baumart und für den großen Bestand an Gemeindewald.
Das nassauische Wappen als Symbol der historischen Zugehörigkeit zum Herzogturm Nassau im 19. Jahrhundert und als Hinweis auf die heute noch übliche Beziehung der Einwohner als „Nassauer“.
Die Rodehacke als Hinweis auf die Entstehung des Ortes im 9. Jahrhundert aus einer Rodung, worauf auch der Ortsname hindeutet.
Die Genehmigungsurkunde wurde am 29. März 1985 ausgestellt.
In Grün eine eingebogene silberne Spitze und ein zu einem Liliendreipaß (1:2) ausgezogener roter Schildfuß. Vorne mit silberner Flamme eine silberne Grubenlampe, die unten schräggekreuzt und schwarz mit Hammer und Schlegel belegt ist. Hinten ein silbernes Glockentürmchen mit zwei Schallfenstern.
Die Gemeinde Bürdenbach besteht aus den 3 Ortsteilen Bürdenbach, Grube Louise und Bruch.
Bürdenbach ist als Borthellenbac in den Heberollen des Herforder Marienstiftes "bald vor 1250" erstmals urkundlich erwähnt, insbesondere auch die Rechte am Eisenberg (Hyserenberch), die der Äbtissin allein zustanden.
Für das Stift, und somit auch für die urkundliche Erwähnung, steht im Ortswappen das Mariensymbol, die Lilie, als Zeichen der Reinheit und Jungfräulichkeit - dargestellt durch den zu einem Liliendreipaß (1:2) ausgezogenen roten Schildfuß in Silber.
Diese 3 Lilien symbolisieren gleichzeitig die 3 Ortsteile, die so im Ortswappen harmonisch vereint sind.
Rot und Silber sind die Wappenfarben der Isenburger Grafen und der Kurfürsten von Trier, zu deren Grundherrschaften Bürdenbach lange Zeit gehörte.
Auch die Dreiteilung des Ortswappens weist auf die 3 Ortsteile hin.
Der Ortsteil Grube Louise ist im Ortswappen vorne durch die Grubenlampe, hier als typische Karbidlampe, dargestellt. Sie ist Zeuge für den bedeutenden Erzbergbau, der hier am Eisenberg schon in karolingischer Zeit begonnen hat und von 1800 bis 1930 mit der Förderung von rd. 3 Mio. Tonnen Erz über lange Zeit die Haupterwerbsquelle der Bürdenbacher war.
Der Ortsteil Bruch war im 13. Jhdt. Standort einer Burg. Nach ihrer Zerstörung wurde hier um 1515 wiederum von den Isenburgern das "Hochgräfliche Wasserschloß Bruch" erbaut. Die barocke Haube des Rundturms, der an der Südostecke des späteren Renaissance-Schlosses stand, ist im Ortswappen als silbernes Glockentürmchen dargestellt und steht somit für das ehemalige Wasserschloß und den Ortsteil Bruch.
Grün, als heraldische Farbe der Freiheit, Fröhlichkeit und Hoffnung, steht für die Lebensart der Menschen. Sie symbolisiert aber auch die Land- und Forstwirtschaft sowie die "Gemarkung Bürdenbach", die mit ihren Tälern und Höhen zwischen Grenzbach, Lahrbach und der Wied im Naturpark "Rhein-Westerwald" liegt.
Das Wappen der Ortsgemeinde Bürdenbach ist somit historisch, handwerklich und landschaftlich bezogen.
In Silber über einer erniedrigten blauen Wellenleiste und zwischen den Enden eines in der Mitte unterbrochenen, schräglinken roten Zwillingsbalkens, der aber einen flacheren Neigungswinkel hat, so daß er rechts knapp unter und links knapp über der Mitte des Schildrandes anstößt, steht ein schwarzer Turm mit zwei Zinnen und einer silbernen Fensteröffnung.
In der Mitte des Wappens ist die „Burg Laer" dargestellt. Der Burgturm ist noch heute erhalten und weithin sichtbar.
Beidseitig der Burgdarstellung befinden sich je zwei schräge rote Balken, die auf die frühere Herrschaft des Hauses Isenburg deuten.
Das Wappen der Isenburger enthält zwei rote waagerecht verlaufende Balken.
Unterhalb der Burgdarstellung deutet die blaue Wellenlinie auf die Wied hin, die den Ort Burglahr quert.
Geviert, 1 und 4 rot, 2 und 3 gold; 1: ein linksgewendeter, blaugezungter und -bewehrter goldener leopardierter Löwe; 2: ein dreiblättriger grüner Eichenzweig; 3: zwei schwarze Balken; 4: eine silberne Scheibe, belegt mit einem schräglinken schwarzen Dolch.
Der Löwe für die Zugehörigkeit zur Grafschaft Sayn, Verbandsgemeinde Flammersfeld, Kreis Altenkirchen. Eichenlaub für den Namen Eichen, schwarze Balken auf goldenem Grund für das Adelshaus Düsternau, das in Eichen einen Hof besaß (1405 Ersterwähnung) und auch Rechte hatte. Der Teller mit Messer aus dem alten Wappen derer von Güllershoben.
Über grünem Dreiberg, belegt mit gekreuzten goldenen Hammer und Schlägel in goldenem Feld eine auf einem schwarzen Ast sitzende schwarze Eule.
Das Wappen Eulenberg ist ein redendes Wappen. Hammer und Schlägel im Dreiberg weisen auf den ehemaligen Bergbau der Gemeinde.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir leider nicht vor.
Im geteilten Schilde oben in Rot ein wachsender goldener (gelber) blaubewehrter, herschauender Löwe, unten in Gold (Gelb) drei rote Wolfsangeln.
Schreiben des Staatsarchivs Koblenz an den Amtsbürgermeister von Flammrsfeld vom 20.11.1947:
„Der Name Flammersfeld ist nicht von Flamme abzuleiten, sondern soll auf Vlamen deuten. Ganz abgesehen aber ist der eingereichte Entwurf zu unruhig. Wie sollten dann die Streifen unter den Flammen, die mit den drei Wolfsangeln belegt sind, gefärbt sein? Sollte das Wappen für die Gemeinde und das Amt gelten?
Ein Wappen soll möglichst schlicht, einfach und einprägsam, in möglichst wenig Felder geteilt und ohne unechtes heraldisches Beiwerk gestaltet werden. Das ergibt dann auch das wirksamste Siegelbild.
Flammersfeld gehörte Jahrhunderte hindurch zur Grafschaft Sayn. Außerdem gab es einstmals ein adeliges Geschlecht von Flammersfeld. Ich habe aus dieser beider Wappen ein neues gebildet, eins für die Gemeinde: im geteilten Schilde oben in Rot ein wachsender goldener (gelber) blaubewehrter, herschauender Löwe, unten in Gold (Gelb) drei rote Wolfsangeln. Das andere Wappen ist mit einem schwarzen Schildbord versehen und soll als Amtswappen verwandt werden, da der Amtssitz sich auch in Flammersfeld befindet. Auch im Siegelstempel wird das Wappen gut wirken. So hoffe ich, daß auch Sie damit einverstanden sind.
Rot wird durch senkrechte, blau durch waagerechte Striche und Gold oder Gelb durch Punkte wiedergegeben.
gez. Dr. Hirschfeld“
Mit Schreiben vom 19.3.1948 an die Bezirksregierung Koblenz hat der Minister des Innern des Landes Rheinland Pfalz wie folgt zugestimmt:
„Ich bin damit einverstanden, dass das der Gemeinde Flammersfeld verliehene Gemeindewappen auch von dem Amt Flammersfeld geführt werden darf, wobei zur Unterscheidung der Wappenschild von einem schwarzen Bord eingerahmt sein soll.
Abschrift dieses Schreibens für den Amtsbürgermeister Flammersfeld ist beigefügt.
gez. Steffen“
In Silber ein rechtes Obereck dreimal silbern-rot geteilt, darunter übereinander zwei schräggestellte schwarze Bergmannswerkzeuge: Schlägel und Eisen, daneben ein roter Linkspfahl, belegt mit einem goldenen Äbtissinnenstab.
Güllesheim wird erstmals 1250 als „Curia Gundelshagen“ in den Heberollen des Herforder Stifts erwähnt. Die Stift-Herforder Beziehungen zu Güllesheim werden durch den Äbtissinnenstab kenntlich gemacht.
Gerlach von Isenburg (1246-1303) gelingt es, das Meieramt der Herforder-Beziehungen in Güllesheim an sich zu bringen.
Salentin von Isenburg trug 1425 den Hof Güllesheim und den nahegelegenen Isenberg von Herford zu Lehen. In der Folgezeit entfremden die Isenburger den Güllesheimer Besitz dem Herforder Stift zunehmend bis zur völligen Inbesitznahme.
Auf die Isenburger verweist das dreimal silbern-rot geteilte rechte Obereck, welches das Isenburger Wappen (in Silber zwei rote Balken) leicht abgewandelt aufnimmt.
Bis Ende 1965 ging in Güllesheim der Eisenerzbergbau um; Spuren des Bergbaues lassen sich sehr weit zurückverfolgen. In einem Stollen im ehemaligen Grubengelände Nöchelchen wurde 1929 ein altes Bergbaugerät gefunden und der Nachweis einer frühen Eisenverhüttung erbracht.
Als Symbol des Bergbaues, der Güllesheim über viele Generationen Arbeit und Brot brachte, sind vorne unten in Silber schwarze Schlägel und Eisen dargestellt.
Geviert, 1 rot, 2 und 3 gold, 4 grün, in 1 ein blaugezungter und -bewehrter goldener leopardierter Löwe, in 2 ein schräglinker blauer Wellenbalken, in 3 ein schwarzes Mühlrad, in 4 silberne gekreuzte Hammer und Schlägel.
Der Leopard auf rotem Grund stellt die frühere Zugehörigkeit der Ortsgemeinde Helmeroth zur Grafschaft Sayn und zur Grafschaft Sayn-Altenkirchen dar. Der blaue Wellenbalken vor gelbem Hintergrund symbolisiert den Fluss Nister in der Ortsgemeinde. Das Mühlrad nimmt Bezug auf die Helmerother Mühle. Darüber hinaus wird die Bergwerkstradition in Helmeroth anhand der Werkzeuge Hammer und Schlägel herausgestellt. Das grüne Feld, Symbol für Feld und Wald zugleich, steht für die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft im Westerwald. Letztlich bringt der blaue Wellenbalken auf goldenem Grund die Zugehörigkeit der Ortsgemeinde zu Nassau am Anfang des 19. Jahrhunderts zum Ausdruck.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir leider nicht vor.
Durch blaue Wellenleisten schräggeviert. Oben in Gold 2 grüne Eichenblätter nebeneinander, rechts in Silber sechs schwarze Basaltsäulen, links in Silber ein schwarzer Aussichtsturm und unten in Gold ein rotes Quadrat.
Hintergrund:
Vier Dreieckfelder jeweils gegenüberliegend in den Metallen weiß (Silber) und gelb (Gold)
Die Felder werden von einem als Schrägkreuz angelegten blauen, gewellten Band getrennt, das die beiden die Gemarkung durchfließenden Bäche darstellt.
Rechts:
Außergewöhnlich geformter Basaltfelsen im stillgelegten und offengelassenen Steinbruch.
Oben:
Diese zwei Eichenblätter symbolisieren zwei starke und markante Eichen im Ortsbereich.
Links:
Der 34 m hohe hölzerne Aussichtsturm auf dem rund 389 m hohen Beulskopf.
Unten:
Grundriss eines saynischen Grenzsteins. Daneben beschreibt diese Zusammenstellung noch die Farben der ehemaligen Grafschaft Sayn – rot und gelb (gold).
Unter rotem, von fünffachem Zinnenschnitt geteiltem Schildhaupt, darin ein blaubewehrter und -gezungter goldener leopardierter Löwe, gespalten von blau und silber, vorn ein silberner betagleuchteter Kirchturm, hinten ein rotes Lilienkreuz.
Der Löwe auf rotem Grund soll den saynischen Löwe darstellen. Er soll die Gemeinde beschützen.
Die Zinnenlinie darunter soll an die ehemalig Mauerbefestigung um das Dorf erinnern.
Der Kirchturm auf blauem Grund ist das älteste Gebäude des Dorfes.
Das Lilienkreuz auf der rechten unteren Seite steht für die älteste Kirchenglocke die Hilgenroth hat.
Die Farben es unteren Abschnitts wurde mit Absicht so gewählt, da blau-weiß die Farben des Männergesangsvereins sind. Die Farben sollen das lebendig Vereinsleben der Gemeinde repräsentieren.
Die Genehmigungsurkunde wurde am 31. Oktober 2001 ausgestellt.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir leider nicht vor.
Von Silber und Rot gespalten, vorn das kurtrierische Kreuz, hinten zwei silberne Balken mit goldener Grubenlampe belegt.
Horhausen als „Horhusin“ urkundlich erstmals im Jahre 1217 genannt, bildete als Kirchspiel Horhausen zusammen mit dem Kirchspiel Peterslahr die Herrschaft Horhausen. Landesherr war bis zur Französischen Revolution das Erzstift Trier. Diese über Jahrhunderte währende Landeszugehörigkeit ist durch das kurtrierischeKreuz symbolisiert.
Die Herrschaft war von Kurtrier zu Lehen übertragen an die Grafen von Isenburg. Als 1664 die Linie Isenburg mit Graf Ernst ausstirbt, wird die Herrschaft Herschbach mit Herhausen und Peterslahr von Kurtrier eingezogen. Sie bleibt künftig als Amt Herschbach unter Trierer Verwaltung bis zum Ende der Feudalzeit. Für die isenburgische Lehensherren-Zeit steht deren erstes Wappenzeichen: zwei rote Balken in Silber, hier aus heraldischen Gründen in verwechselten Farben.
Die Wirtschaftsstruktur von Horhausen und die Arbeit vieler Generationen wurde bis vor wenigen Jahren bestimmt durch die Erzgrube St. Georg. Der Erinnerung daran sollen als Symbol des Bergbaues die Grubenlampe dienen.
Das Landeshauptarchiv hat mit Verfügung Az. 2/270-Horhausen/zi vom 27.4.1976 diesem Entwurf den Vorzug gegeben.
Der Ortsgemeinderat Horhausen hat in seiner Sitzung am 2. Juni 1976 einstimmig beschlossen, diesen Entwurf anzunehmen und künftig als Gemeindewappen zu führen.
In Gold schreitender, rot bewehrter schwarzer Hahn mit rotem Kamm und rotem Halslappen.
„In einem Buch zur Geschichte von Hachenburg fand der Ortsbürgermeister Klaus Brag einen Hinweis auf das Siegel eines Gerd von Ingelbach, der von 1355 bis 1372 Stadtschultheiß in Hachenburg war. Das Siegel habe einen stolzdahinschreitenden Hahn gezeigt. Die „von Ingelbach“ hätten vom 14. bis 16. Jahrhundert dem niederen Landadel angehört.
Im Hessischen Hauptarchiv in Wiesbaden entdeckte Brag schließlich das Siegel – in einer Urkunde des Klosters Marienstatt vom 26. Dezember 1428.Ein Entwurf wurde vorgelegt und fand Zuspruch.“
Quelle: Rhein-Zeitung von 06. Februar 1992
Die Genehmigungsurkunde wurde am 4. Dezember 1991 ausgestellt.
In roter und silberner Teilung oben ein goldenes, betagleuchtetes zweigeschossiges Haus mit mittiger Tür über drei Treppenstufen und fünf umliegenden Fenstern mit kreuzförmigen Sprossen und Fensterbänken sowie einer aufgehenden ungebildeten Sonne rechts und einem goldenen, blaubezungten Leopardenkopf links oben, unten ein schwarzer Hammer und eine schwarze Rodungshacke schräggekreuzt.
Das Wappen der Ortsgemeinde Isert versinnbildlicht im unteren Teil den Namen der Ortsgemeinde in einem ?redenden Wappen". Der Ortsname läßt sich auf eine mittelalterliche Rodung im Westerwald an einem Ort mit Eisenvorkommen beziehen. Durch den Berghammer und die Rodungshacke, die durch ihre schräggekreuzte Anordnung eine unzertrennliche Einheit bilden, wird zum einen der Abbau des Eisens im Ort und zum anderen die Anlegung der Siedlung durch Rodung symbolisiert und somit die beiden Bestandteile des Ortsnamens zum Ausdruck gebracht und anhand der damit verbundenen Tätigkeiten der Name ?Isert" symbolhaft dargestellt. Darüber hinaus wird die Entstehung und mithin die Siedlungsgeschichte der Ortsgemeinde Isert auf diese Weise angedeutet. Durch die Rodungshacke als Werkzeug für die Waldarbeit wird zudem ein regionaler Bezug zum Westerwald geschaffen, wo der Siedlungsplatz gerodet wurde und die Ortsgemeinde liegt.
Das Haus in der Mitte des oberen Teiles stellt das Iserter Schulhaus dar, das 1860 erbaut wurde und dem als ?Haus in der Sonne" eine historische Bedeutung für die Schulreformen im Westerwald als Wirkungsstätte des Pädagogen Wilhelm Kircher (1898-1968) als Landschulreformer zukommt. Die schräg darüber strahlende Sonne stellt nochmals symbolisch das ?Haus in der Sonne" heraus, in dem reformpädagogische Prinzipien, wie beispielsweise Arbeitsunterricht, Selbständigkeit in Schülermitverantwortung oder Projektlernen im Rahmen einer kleinen Landschule im Westerwald modellartig erprobt wurden. Überdies steht die Sonne als Garant für das Leben und ist Voraussetzung für das Gedeihen der Ernte in der Landwirtschaft, in der über Generationen hinweg die Einwohner von Isert überwiegend tätig waren. Auf diese Weise wird indirekt die Landwirtschaft im Westerwald, die Isert geprägt hat, angedeutet.
Der Leopardenkopf im oberen Feld ist dem Wappen der Grafen von Sayn entlehnt, die einen goldenen gelöwten Leoparden mit gespaltenem Schwanz auf rotem Grund im Wappen führten, er bringt als Pars pro toto des saynischen Wappens die territoriale Zugehörigkeit der Ortsgemeinde Isert zur Grafschaft Sayn und nach der Landesteilung im 17. Jahrhundert zur Grafschaft Sayn-Altenkirchen zum Ausdruck. Somit greift er symbolisch den territorialen Bezug der Ortsgemeinde während des Mittelalters und der Frühen Neuzeit auf.
Die Tingierung des Wappens bezieht sich auf die territoriale Zugehörigkeit der Ortsgemeinde Isert im Laufe der zurückliegenden Jahrhunderte. Die zugrundeliegenden Wappenfarben Rot und Gold der Grafen von Sayn, ein goldener Leopard auf rotem Feld, nimmt im oberen Teil des Wappens Bezug auf die Grafschaft Sayn und die Grafschaft Sayn-Altenkirchen, zu denen Isert während des Mittelalters und der Frühen Neuzeit zählte. Die Farben Silber und Schwarz des Königreiches und Freistaates Preußen, die im silbernen Feld einen schwarzen Adler führten, stellen im unteren Teil des Wappens einen Bezug zu Preußen her und verweisen auf die territoriale Zugehörigkeit der Ortsgemeinde Isert zu Preußen als Teil der preußischen Rheinprovinz seit dem Wiener Kongreß bis zur Gründung des Landes Rheinland-Pfalz. Durch die Tingierung des Wappens wird sinnbildlich die geschichtliche Entwicklung der Ortsgemeinde Isert aufgezeigt und die Kommune zugleich in den Rahmen der regionalen Geschichte gestellt.
Das Wappen wurde Isert 2018 verliehen.
In Silber auf einem roten, mit einem goldenen, blaugezungten und blaubewehrten Löwen belegten, aufgebogenen Schildfuß, eine grüne Eiche mit schwarzem Stamm, begleitet rechts von einem schwarzen Mühlrad und links von 5 schwarzen Basaltsäulen.
Über silbernem Schildfuß, darin das rote Kurtrierer Kreuz, in Blau eine silberne schräglinke Wellenleiste, oben zwei silberne Eichenblätter mit Eichel, unten ein silbernes Förderrad.
Krunkel besteht aus den Ortsteilen Krunkel und Epgert. Bis um 1800 gehörte es zum Kurfürstentum Trier. Deshalb steht im Schildfuß das Kurtrierer Kreuz.
Einer der Haupterwerbszweige war bis um 1960 der Erzbergbau in Willroth. Als Erinnerung hieran ist das silberne Förderrad aufgenommen.
Eine alte, zum Naturdenkmal bestimmte Eiche, bildet heute noch einen Grenzpunkt zwischen Hümmerich und dem Krunkeler Ortsteil Epgert. Durch die Aufnahme des Eiche-Symbols ist auch der Ortsteil Epgert im Gemeindewappen symbolisiert.
Der silberne Wellenbalken steht für den Lahrbach, der das Landschaftsbild der Gemarkung Krunkel bestimmt.
Das Landeshauptarchiv Koblenz (LHA) hat mit Schreiben 2 Zi/270-Krunkel, vom 25.04.1988 mitgeteilt, daß der Entwurf den heraldischen Farbregeln entspricht. Die außerdem gegebene Empfehlung, „...den Wellenbalken nach links ...zur Wellenleiste (zu) verringern" wurde berücksichtigt.
Der Bürgermeister der Ortsgemeinde Krunkel hat am 11.05.1988 mitgeteilt, daß der Gemeinderat den ausgeführten Entwurf angenommen habe. Das ausgeführte Wappen soll künftig als Gemeindewappen Krunkel geführt werden.
Durch einen silbernen Wellengöpel geteilt. Oben vorn und hinten in Blau je eine silberne Linde. Unten in rot eine silberne Pflugschar.
Im Gemeindewappen kommt diese Zusammenfassung dreier vorher selbstständiger Kommunen durch die drei Felder des Schildes sowie durch die Vereinigung dreier Bachläufe im Wellengöpel zum Ausdruck. Dieser erinnert zudem daran, dass jeder der Ortsteile im Einzugsgebiet eines Flüsschens – Mäusbach, Sörther Bach Reufelbach – liegt.
Die rote Tinktur verweist auf die lange Zugehörigkeit zu Sayn bzw. Sayn-Altenkirchen, während Blau an die kurze landesgeschichtliche Zuordnung zu Nassau erinnert. Silber ist eine der beiden preußischen Farben, die ebenfalls territorialhistorisch belegbar sind.
Die Waldinteressenschaft wird als besondere ortstypische forstwirtschaftliche Erscheinung durch die beiden silbernen Linden im Wappen dargestellt.
Die silberne Pflugschar soll auf die herausragende Rolle der Landwirtschaft in der Wirtschaftsgeschichte der drei Ortsteile hinweisen.
Die Genehmigungsurkunde wurde am 29. Mai 1995 überreicht.
Gespalten von Grün und Blau durch eine goldene Spitze, darin eine schwarze Kirche in Rückansicht mit Fachwerkabschluß und Turm. Vorn eine goldener Krug mit schwarzer Aufschrift GR unter schwarzer Krone. Hinten ein silbernes Medaillon mit durchbrochener schwarzer Kreuzblume mit Krabben, beidseits begleitet von je einem Paar gekreuzter schwarzer Schlüssel.
Das Gotteshaus im romanischen Stil stellt den Mittelpunkt des Ortes Mehren und des Kirchenspiels Mehren im Mehrbachtal dar. Der in diesem Raume einmalige Fachwerk-Chorüberbau krönt das sogenannte „Fachwerkdorf“ mit seiner schönen Gliederung in schwarz-weiß zum heimischen Bruchstein des Kirchbaues.
Der Krug mit den Initialen des englischen Königs „Georg Rex“ deutet auf die Töpferei im Ort hin, die um 1700 bestanden hat. Krüge dieser Art, die aus Mehren stammen, befinden sich heute im Museum des Kannenbäckerlandes.
Das Medaillon im rechten oberen Feld des Wappens entstammt einer Schiefergrabplatte, die vor dem Chor innerhalb der Kirche eine Grabstätte abdeckt. Dabei soll es sich um das Grab des Johann von Mehren handeln.
Die Kreuzblume mit Krabben und den gekreuzten Schlüsseln soll die Schlüsselgewalt und den Bann des Lebens darstellen.
Die Farben deuten im linken Feld die grüne Landschaft des Westerwaldes, im Mittelteil das Gold der Ährenfelder mit der Kirche im Vordergrund und im rechten Feld das Wasser des Mehrbaches.
Die Genehmigungsurkunde wurde am 25. Januar 1993 ausgestellt.
Oben gespalten und durch eine goldene, zweibogige Brücke geteilt; vorn in silber ein blauer Wellenschrägbalken, hinten in grün ein abgeschnittener silberner, golden gehörnter Widderkopf, unten in rot ein silbernes Mühlrad, begleitet vorn und hinten mit je einer goldenen Ähre bordweis.
Im Feld 1 ist auf silbernen Grund die Wied als blauer Fluss dargestellt.
Im Feld 2 ist für den Ortsteil Widderstein auf grünem Hintergrund der Widderkopf aus dem Wappen der adligen von Widderstein in Silber mit goldenen Hörnern dargestellt. In der Mitte ist als Trennung die historische Wiedbrücke in Gold abgebildet.
Im unteren Feldsollen die goldenen Ähren auf die Landwirtschaft und das silberne Mühlrad, auf den heute noch bedeutenden Mühlenstandort Michelbach hinweisen.
Die Symbole sind auf rotem Hintergrund dargestellt, wobei die Ähren und das Mühlrad angeordnet sind.
Die Genehmigungsurkunde wurde am 13. Juli 2004 ausgestellt.
Das Wappen wird senkrecht gespalten durch einen silbernen Pfahl, belegt mit drei schwarzen Wolfsangeln untereinander, zudem noch waagerecht durch eine silberne Wellenlinie geteilt. Oben rechts in Rot ein blaubezungter und -bewehrter golderner aufrechter Löwe, oben links in Rot ein goldenes Mühlrad. Unten rechts in Grün gekreuzter silberner Hammer und Schlägel, unten links in Grün gekreuzt eine silberne Sense und ein silberner Rechen.
Zum 01. Januar 2021 fusionierten die beiden Ortsgemeinden Neitersen und Obernau. An der Schnittstelle der früheren Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld entstand somit eine neue Ortsgemeinde mit über 1100 Einwohnern. Mit dem Fusionsvertrag wurde beschlossen, dass die neue Ortsgemeinde Neitersen auch ein neues Wappen erhält. Dieses sogenannte „Allianzwappen“ sollte Elemente beider Wappen der Vorgängergemeinden enthalten. Mit der Wappengestaltung nach den Vorschriften der Heraldik wurde der Diplom-Archivar Daniel Schneider aus Freiburg im Breisgau (früher Hilgenroth) beauftragt. Am Freitag dem 30. September 2022 wurde das neue Wappen vorgestellt und offiziell eingeführt sowie die einzelnen Elemente des neuen Wappens erklärt: Der Saynsche Löwe erinnert an die frühere Zugehörigkeit der Gemeinde zu der Grafschaft Sayn, ein Mühlrad steht als Sinnbild für die früheren drei Mühlen auf dem Gemeindegebiet, zu nennen sind hier die Ölmühlen im Birnbachtal (in den Bröch) und in Niederölfen sowie die Neiterscher Mühle der Familie Hassel (heute Kino Wiedscala). Gekreuzte Hammer und Schlägel lassen die Bergbautradition der Region (z.B. Grube Emma) aufleben und Sense und Rechen symbolisieren die frühere Bedeutung der Landwirtschaft in allen Ortsteilen. Ein senkrechter Pfahl mit drei Wolfsangeln stammt aus dem Siegel des „Henne von Neitersen“, der als Schöffe am Gericht in Hachenburg im Jahr 1416 ein Rechtsgeschäft mit seinem Siegel beglaubigte, die Wellenleiste in der Mitte des Wappens stellt die Wied dar, denn der Fluss hat vielem in der Gemeinde den Namen gegeben, von der Wiedhalle bis zu den Wiedbachtaler Vereinen und schließlich symbolisieren die sechs Wellen die sechs Ortsteile der Gemeinde, nämlich Neitersen, Niederölfen, Fladersbach, Obernau, Neiterschen und Kahlhardt.
Gespalten von Silber und Grün durch Wellenschnitt, vorn ein durchgehendes schwarz-rot geviertes Kreuz, belegt mit einer goldenen Lilie, hinten geteilt durch einen silbernen Balken, oben eine silberne Glocke, unten schräggekreuzte, gestürzte silberne Hammer und Schlegel.
Die Ortsgemeinde Niedersteinebach liegt im nördlichen Bereich des ehemaligen Engersgaues und wurde erstmals in Aufzeichnungen „bald um 1250"..bzw. gegen Ende des 13. Jahrhunderts in den Heberollen des Herforder Marienstiftes urkundlich erwähnt. Der Ort gehörte zum Territorium des Erzbistums Trier, Wappen: rotes Kreuz in Silber, und grenzte im Norden der Gemarkung direkt an das Erzbistum Köln, Wappen: schwarzes Kreuz in Silber, bzw. den Kölner Berg, dessen. größter Teil zu Burglahr gehört. Niedersteinebach war als trierisches Lehen bis 1664 im Besitz der Grafen von Isenburg. Die territorialen und herrschaftlichen Beziehungen sind im Ortswappen vorne durch das schwarz-rot gevierte Kreuz sowie hinten durch einen der Isenburger Balken in umgekehrter, also silberner Tingierung dokumentiert. An die erste urkundliche Erwähnung erinnert die goldene Lilie als Mariensymbol an das Herforder Marienstift. Die Gemeinde Niedersteinebach ist zu beiden Seiten des Huferbachs angesiedelt, der die Gemarkung von Süd nach Nord durchfließt und am unteren Dorfende in den Lahrbach mündet. Beide Bäche verweisen auf die Endung des Ortsnamens. Im Ortswappen steht der Wellenschnitt (Spalt) symbolisch für den Hufer- und Lahrbach, die Niedersteinebacher Bannmühle und den Ortsnamen. Eine Besonderheit für Niedersteinebach und Umgebung ist die hier im Jahre 1703 gegründete „Erimitage" mit der alten Kapelle. Ihr Standort war im Eisenberg und der Flurname „Eremitenkopf“ (Gem. Bürdenbach) erinnert noch heute daran. Die Kapelle der Einsiedelei wurde 1740 - 44 sogar Pfarrkirche. Als eine feste Institution galt für die Bergleute ringsum die „Bergandacht" der Niedersteinebacher Erimitage.
Durch die Säkularisation wurde Anfang des 19. Jahrhunderts auch die Erimitage von Niedersteinebach aufgehoben. Übrig blieb die 1706 getaufte Glocke der alten Kapelle, die ihren Weg in die Horhauser Pfarrkirche fand und dort aufbewahrt wurde. Als sichtbare Erinnerung an die Erimitage wurde in das Ortswappen die silberne Glocke aufgenommen. Der Eisenberg, einst Hyserenberch, Kysermich, liegt zum Teil in der Gemarkung Niedersteinebach und ist Zeuge frühen „Eisensteinbergbaus" bis in das 20. Jahrhundert. Der Eisenstein wurde lange Zeit mit Fuhrwerken über die „Steinstraße" durch einen Teil der Gemarkung nach Horhausen transportiert. Die Einwohner Niedersteinebachs gingen dem Bergbau, als Hauptbroterwerb neben der üblichen Landwirtschaft, seit früher Zeit in den benachbarten Gruben nach, so auch fast ein Jahrhundert lang in der nahen Grube "Friedrich Wilhelm" (Hufer Schacht). Der Bergbau ist als bodenständiges Handwerk im Ortswappen durch das „Gezähe", gekreuzte und gestürzte silberne Hammer und Schlegel verankert. Die Feldfarbe „Grün", als Farbe der Freiheit, Fröhlichkeit und Hoffnung, steht im Ortswappen redend für die vom Wald und der Landwirtschaft geprägte Gemarkung mit Tal und Wiesen von Niedersteinebach. Die gemeinsamen Wappensymbole des Bergbaus, der ehemaligen Landesherren und des Marienstifts zeigen die enge Verbundenheit Niedersteinebachs zu seinen Nachbargemeinden. Die Ortsgemeinde Niedersteinebach ist heute eine ländliche Wohngemeinde im Naturpark „Rhein-Westerwald“ und gehört in der Verbandsgemeinde Flammersfeld zum Landkreis Altenkirchen.
Das Wappen der Ortsgemeinde Niedersteinebach ist somit historisch, handwerklich und landschaftlich begründet.
In Gold eine gestürzte rote Spitze, bedeckt mit einem Adler in verwechselten Farben.
Der Adler verweist auf die Familie derer von Koberstein, die von Kobern an der Mosel stammen und die wohl 1358 Burg Koberstein, heute das zur Ortsgemeinde Obererbach gehörende Hofgut Koberstein, erbauten.
Die Familie führte ein Wappen mit Adler wurde in das Gemeindewappen übernommen, allerdings mit den Farben der Grafschaft Sayn / Altenkirchen. Durch die gestürzte rote Spitze erhält das Wappen eine Dreiteilung. Dies dokumentiert die Dreigliedrigkeit der Gemeinde mit den Ortsteilen Obererbach, Niedererbach und Hachsen.“
Quelle: Rhein-Zeitung von 27.10.1995
Die Genehmigungsurkunde wurde am 21. September 1995 ausgestellt.
Gespalten und mit drei flachen Spitzen geteilt, vorne in Rot ein blaubewehrter und –gezungter goldener herschauender Löwe mit doppeltem Schwanz, hinten oben in Silber ein schwarzes Mühlrad, vorne unten in Gold drei blaue Wellenbalken und hinten unten in Grün eine goldene Korngarbe mit drei Ähren.
Das Wappen der Ortsgemeinde Oberirsen hebt durch die Teilung des Schildes mit drei Spitzen die Gliederung der Ortsgemeinde in die drei Ortsteile Marenbach, Oberirsen und Rimbach hervor. Die drei Ortsteile waren früher eigenständige Gemeinden, die in der Ortsgemeinde zusammengeschlossen sind und gemeinsam die Ortsgemeinde Oberirsen bilden. Das Wappen stellt somit durch die auffällige und ungewöhnliche Schildeinteilung die Gemeinschaft in Oberirsen heraus, die aus den Einwohnern der Ortsgemeinde in den drei Ortsteilen besteht. Überdies werden durch die Teilung mit den Spitzen symbolisch Hügel und Täler angedeutet und dadurch die geographische Lage der Ortsgemeinde in einer markanten Senke im Westerwald angedeutet. Einer landläufigen Bezeichnung zufolge liegen die drei Ortsteile im Grunde dieser Senke. Die Namensgebung der ortsansässigen Vereine – etwa der ehemalige Männergesangverein „Im Grunde“ Oberirsen, der ehemalige Gemischte Chor „Im Grunde“ Oberirsen oder der Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach – spielt gleichsam auf die geographische Lage und die landläufige Bezeichnung an und unterstreicht diesen Umstand.
Der herschauende Löwe mit doppeltem Schwanz ist das Wappentier der Grafen von Sayn und nimmt Bezug auf die jahrhundertelange territoriale Zugehörigkeit der Gemeinden Marenbach, Oberirsen und Rimbach zur Grafschaft Sayn und nach der Landesteilung des Sayner Landes in der Frühen Neuzeit zur Grafschaft Sayn-Hachenburg, die im vornehmsten Feld des Wappens zum Ausdruck gebracht wird. Das Mühlrad steht als pars pro toto für die Rimbacher Mühle, die als Getreidemühle für die Vermahlung des Korns mehrerer umliegender Gemeinden verantwortlich war und mithin eine wirtschaftliche Bedeutung für die Umgebung hatte. Des weiteren bestand in Rimbach einst eine Ölmühle. Folglich zeugt das Mühlrad von der Geschichte der Ortsgemeinde als Mühlenstandort. Die drei Wellenbalken vorne unten symbolisieren die drei durch die Ortsgemeinde fließenden Bäche: den Marenbach, den Rimbach und den Scharfenbach. Im Ortsteil Rimbach entspringt aus einem Zusammenfluss der Bachläufe der Irserbach, der in der Ortsgemeinde Oberirsen seinen Anfang als Zufluss zur Sieg nimmt. Zudem deutet das Gewässer auf den Weiher in Oberirsen hin. Die drei gebundenen Kornähren stehen zum einen als Symbol für die Westerwälder Landwirtschaft, in der über Generationen hinweg die Einwohner von Marenbach, Oberirsen und Rimbach überwiegend tätig waren und die im besonderen Maße die Ortsgemeinde über Jahrhunderte geprägt hat und sie angesichts der gegenwärtig noch existierenden Vollerwerbs- und Nebenerwerbsbetriebe in der Kommune im Unterschied zu anderen Ortsgemeinden weiterhin prägt, zum anderen stehen sie durch die zusammengebundene Garbe für den Zusammenschluss der drei landwirtschaftlich geprägten Gemeinden zu einer einzigen Ortsgemeinde Oberirsen und drücken so die Geschichte der drei Ortsteile ebenso wie ihre inzwischen gewachsene Verbundenheit aus. Gemeinsam mit dem Mühlrad deutet die Korngarbe den Kreislauf zwischen Saat und Ernte und der anschließenden Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produkte in der Rimbacher Mühle zu Mehl an, das Grundlage für das tägliche Brot ist, und unterstreicht dadurch nochmals die Bedeutung der Landwirtschaft für die Bevölkerung. Die hintere Hälfte des Wappens stellt somit die jahrhundertelange Landwirtschaft in der Ortsgemeinde dar.
Die Tingierung des Wappens (Farbgebung) bringt die territoriale Zugehörigkeit der Ortsgemeinde Oberirsen und ihrer Ortsteile im Laufe ihrer Geschichte zum Ausdruck. Das integrierte Wappen der Grafen von Sayn mit dem goldenen Löwen auf rotem Grund bezieht sich auf die Grafschaft Sayn und die Grafschaft Sayn-Hachenburg, denen Marenbach, Oberirsen und Rimbach während des Mittelalters und der Frühen Neuzeit angehörten. Der territoriale Bezug zu Nassau, wozu die drei Gemeinden vom Reichsdeputationshauptschluss bis zum Wiener Kongress zählten, wird durch die blauen Wellenbalken auf goldenem Grund, den Wappenfarben Nassaus, hergestellt. Das schwarze Mühlrad auf silbernem Grund steht für die preußischen Farben und verweist auf die territoriale Zugehörigkeit der Ortsgemeinde Oberirsen zu Preußen als Teil der preußischen Rheinprovinz seit dem Wiener Kongress bis zur Gründung des Landes Rheinland-Pfalz. Die Wappenfarben der preußischen Rheinprovinz (Grün, Silber und Schwarz) sind zudem unter Einbeziehung des grünen Feldes ebenfalls aufgenommen und betonen so nochmals die langwährende Einbindung der drei Ortsteile in die Rheinprovinz. Darüber hinaus ergibt sich durch die gewählten Farben des Wappens aus dem schwarzen Mühlrad, dem roten Feld und dem goldenen Feld wie dem goldenen saynischen Löwen selbst eine Kombination aus Schwarz, Rot und Gold. Daraus ergibt sich ein symbolischer Bezug zu den Farben der Landesflagge von Rheinland-Pfalz zum einen sowie zu den Farben der Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland zum anderen. Auf diese Weise wird durch die Andeutung ihrer Flaggen die Angehörigkeit der Ortsgemeinde Oberirsen sowohl zur Bundesrepublik Deutschland wie zugleich zum Land Rheinland-Pfalz symbolisch ausgedrückt. Aufgrund der Tingierung des Wappens wird sinnbildlich die geschichtliche Entwicklung der Ortsgemeinde Oberirsen bis in die Gegenwart aufgezeigt und die Kommune zugleich in den Rahmen der regionalen Geschichte gestellt. Die grüne Farbgebung im unteren Teil steht überdies symbolisch für die Felder und Wälder in Oberirsen und mithin für die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft in der Ortsgemeinde und deutet dadurch ihre Lage im Westerwald an.
Gespalten, vorne durch einen silbernen Wellenbalken geteilt, oben in Rot eine silberne Kapelle, unten in Blau ein dreiblättriger silberner Eichenzweig mit goldener Eichel, hinten in Silber vor gestürzten schräggekreuzten schwarzen Hammer und Schlegel ein durchgehendes rotes Kreuz, belegt mit einer heraldischen goldenen Lilie.
Im nordöstlichen Bereich des ehemaligen Engersgaues liegt die Ortsgemeinde Obersteinebach. Sie wurde „bald um 1250“ bzw. gegen Ende des 13.Jahrhunderts in den Heberollen des Herforder Marienstifts erstmals urkundlich erwähnt. Das Dorf, bzw. „die Huben zu Ober- und Niedersteinebach“ gehörten zum Territorium des Erzbistums Trier. Lehensherrn waren hier die Grafen zu Isenburg. An die ehemaligen Landes- bzw. Lehensherrn erinnern im Ortswappen von Obersteinebach hinten das „Trierer Kreuz“ sowie die Farben Rot und Silber, die auch gleichzeitig die Wappenfarben des Erzbistums und die der Isenburger Grafen sind. Die goldene heraldische Lilie steht als Mariensymbol für die erste urkundliche Erwähnung durch das Herforder Marienstift. Obersteinebach liegt im Tal des "Lahrbaches", der den Ort an der Ostgrenze der Gemarkung nach Norden durchfließt, um dort bei Oberlahr in die Wied, einem der großen Westerwälder Flüsse, zu münden. Der Bach, und somit auch der Ortsname sind im Ortswappen vorn durch einen silbernen Wellenbalken dokumentiert. Oberhalb des Dorfes, das aus dem „Überdorf, Oberdorf und dem Balkan" besteht, stand um 1828 eine Betkapelle, die zur bereits 1550 erwähnten Filiale Obersteinebach gehörte. Sie wurde 1926/27 neu aufgebaut und am 14.10.1928 dem hl. Josef als Schutzpatron geweiht. In den darauf folgenden Jahren wurde sie mehrfach verschönert und renoviert. Die St. Josefskapelle ist im Ortswappen als silberne Kapelle vorne in Rot dargestellt. Obersteinebach ist eine ländliche Wohngemeinde. Für die Einwohner war in früherer Zeit, neben der üblichen Landwirtschaft, der Eisenerzbergbau eine Erwerbsquelle. Alte „Pingenzüge“ und der alte „Stollen hinter dem Heiderhof“ zeugen heute noch von 400 - 500 Jahre altem Bergbau. Für den heute ruhenden Eisenerzbergbau stehen im Ortswappen, gestürzt und gekreuzt, schwarze Hammer und Schlegel. Obersteinebach liegt in einem reizvollen, von Wald umgrenzten Tal, der ca. 2/3 der Gemarkung ausmacht. Der silberne Eichenzweig mit goldener Eichel symbolisiert den Wald und die Gemarkung. Er erinnert aber auch gleichzeitig an die im Volksmund überlieferte Sage von der „Bildeiche", die als noch vorhandenes Naturdenkmal im Wald zwischen Obersteinebach und Peterslahr steht. Eine Besonderheit in der Obersteinebacher Gemarkung ist der am nördlichen Ortsausgang gelegene "Lahrbach-Stausee". Er bietet vielen Einwohnern und Gästen als Naherholungsgebiet einen hohen Freizeitwert und ist so eine besondere Attraktion der Gemeinde. Im Ortswappen steht das vordere blaue Feld für den Stauweiher. Obersteinebach liegt heute im Naturpark Rhein-Westerwald und gehört in der Verbandsgemeinde Flammersfeld zum Landkreis Altenkirchen.
Das Wappen der Ortsgemeinde Obersteinebach ist somit historisch, handwerklich und landschaftlich begründet.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir leider nicht vor.
Gespalten von Silber und Grün, vorn zwei gekreuzte aufgerichtete rote SchIüssel, den Bart nach außen, hinten ein silberner Storch mit rotem Schnabel und roten Füßen über gespaltenem Wellenschildfuß in verwechselten Farben, darin vorn zwei silberne Balken, hinten ein durchgehendes rotes Kreuz mit einem silbernen Eichenblatt belegt.
Die Ortsgemeinde Peterslahr, früher Laere, Nydernlahre, Niederlahr, liegt an der Nordgrenze des ehemaligen Engersgaues und ist als Niederlahr erstmals im Sayner Teilungsvertrag 1314 urkundlich erwähnt. Der Ort gehörte in der Grafschaft Isenburg, Herrschaft Horhausen, zum Territorium des Erzbistums Trier, das hier die Landesherrschaft ausübte. Die Lehnsherren waren die Grafen zu Isenburg bis zu deren Aussterben im Jahr 1664. Danach fiel der Ort wieder an Kurtrier zurück, kam 1803 an Nassau-Weilburg und 1866 an Preußen. An die ehemaligen Landes-und Lehensherren erinnern im Ortswappen unten deren Wappen und zwar das rote „Trierer Kreuz in Silber", sowie die „Isenburger Balken", diese jedoch in silberner Tinktur. Der Ortsname von Perters„lahr" hängt mit seiner Lage an der südwestlichen Grenze der „Lahrer Herrlichkeit" zusammen und wurde vermutlich um 1556 durch die „Petrusverehrung" der Isenburger Grafen, die dem Ort Niederlahr den Kirchenpatron „Petrus" übertrugen, durch „Peterslahr" verdrängt. Eine Kirche wird hier bereits 1320 genannt. Der Ort war mit seiner „St. Petruskirche" und der „Petrusreliquie" ein bedeutender Wallfahrtsort. Die Kirche ist seit 1824 selbständige Pfarrei im Bistum Trier. An die Stelle der alten Kirche trat 1901 ein prächtiger Neubau mit Teilen der alten Bausubstanz, der am 23.6.1901 als „St. Petrus" eingesegnet wurde und noch heute der Mittelpunkt dörflichen Lebens ist. Auch der für sein „Heilwasser" bekannte „Petrusborn" in der Dorfmitte, im Jahr 2000 als „Petrusbrunnen" restauriert, trägt den Namen des Schutzpatrons. Die Kirche und der mit ihr verbundene Ortsname sowie der Brunnen sind im Ortswappen durch das Attribut des HI. Petrus als gekreuzte rote Schlüssel in Silber auf dem ersten Schildplatz in den Trierer als auch Isenburger Farben dargestellt. Landschaftlich gehört Peterslahr zum Naturpark Rhein-Westerwald und liegt hier im reizvollen Wiedtal links der Wied, am Fuße des Menzenberges. Die Wied bildet als bedeutender Westerwälder Fluß im Norden den größten Teil der Gemarkungsgrenze und ist als Wellenschildfuß im Ortswappen dokumentiert. Die Gemarkung Peterslahr ist im wesentlichen von der Land- und Forstwirtschaft geprägt, die über Jahrhunderte Lebensgrundlage für die Einwohner waren. Der Wald macht ca. 65 % der Gemarkungsfläche aus und ist durch das silberne Eichenblatt auf dem Trierer Kreuz symbolisiert. Das Eichenblatt erinnert aber auch an die geheimnisvolle „Bildeiche bei Peterslahr“, deren Sage bis in die heutige Zeit erhalten ist. Im „Volksmund" werden die Peterslahrer Einwohner auch die "Peterslahrer Störche" genannt. Dieser volkstümliche Dorfname ist seit alters her überliefert und auch heute noch im Gebrauch. Alljährlich machen die Störche auf ihrem Zug in der Wiedaue zu Peterslahr Rast. Der Zug der Störche steht symbolisch für Wiederkehr, Himmelfahrt und Wiederkunft. Der Storch selbst ist also auch ein christliches Symbol und läßt sein Nest nie unbewacht. Somit ist der Storch doch typisch für Peterslahr und die Einwohner identifizieren sich mit ihrem alten Dorfnamen. Im Ortswappen ist der Dorfname „Peterslahrer Störche" als silberner Storch in das hintere grüne Feld aufgenommen. Die Feldfarbe Grün steht aber gleichzeitig für die Gemarkung, die Wiedaue, die Landwirtschaft, den Menzenberg und den Wald. Grün ist aber auch die Farbe für Fröhlichkeit und Hoffung, mit der sich die Peterslahrer Bürger verbunden fühlen. Heute ist die Ortsgemeinde Peterslahr eine ländliche Wohngemeinde in der Verbandsgemeinde Flammersfeld und gehört zum Landkreis Altenkirchen.
Das Wappen der Ortsgemeinde Peterslahr ist somit historisch, handwerklich und landschaftlich begründet.
Wappen geteilt und oben gespalten, vorn in Schwarz eine silberne Rose mit goldenem Butzen, hinten in Gold zwei gekreuzte schwarze Hämmer, unten in Silber das rote kurtrierische Kreuz.
Auch der Gemeinde Pleckhausen wurde nach den entsprechenden Bestimmungen der Gemeindeordnung das Recht verliehen, ein eigenes Wappen zu führen.
Die Genehmigungsurkunde des Regierungspräsidenten datiert vom 6.10.1980.
Das nach den Regeln der Heraldik ausgearbeitete Wappen wurde farbig wie oben gestaltet.
Zunächst zählte Pleckhausen zur Grafschaft Nieder-Isenburg. Im Jahre 1664 kommt es an Kurtrier und gehört im Amt Herschbach zum Kirchspiel Horhausen. Die Zugehörigkeit zu Kurtrier symbolisiert das kurtrierische Kreuz.
Für die landesgeschichtliche Zugehörigkeit vor 1664 steht im ersten Schildteil die silberne Rose in Schwarz. Sie ist dem Wappen des Berncot von Isenburg von 1408 entnommen (Gruber S. 64/65.).
Die beiden gekreuzten Hämmer, (Hammer und Schlegel) stehen für die frühere Wirtschaftsstruktur. Pleckhausen hatte in früherer Zeit eine Hütte und Eisenschmelze.
Rot durch einen silbernen Schräglinksbalken geteilt, vorn ein blau bewehrter und gezungter goldener linksgewendeter leopardierter Löwe, hinten ein goldener Eichenzweig mit vier Fruchtständen balkenweis und vier Blättern bordweis.
Die Farben sind dem Wappen der alten Landesherrschaft entnommen. Auch der leopardierte Löwe weist auf die Grafen Sayn hin.
Der Querstreifen oder Balken soll die alte Heerstraße, heutige Bundesstraße 8, die durch den Ort führt, darstellen.
Der Eichelzweig mit Früchten hat mehrere Bedeutungen und sind auf den Ort bezogen.
Die vier Eicheln stehen für die einzelnen Ortsteile, Rettersen, Hahn, Roßberg, und Witthecke.
Der Ort war in seiner Geschichte immer durch die Landwirtschaft und Waldreichtum geprägt.
Die Genehmigungsurkunde wurde am 23. Mai 2002 ausgestellt.
Von Blau über Gold geteilt, unten ein silbernes dreiendiges Hirschgeweih, oben zwei gekreuzte blaue Rodungshacken.
Der Ortsname Rott geht zurück auf das althochdeutsche rod, riet = Rodung. Die Rodungshacken im oberen Schildteil beziehen sich demnach auf den Namen der Wappenstifterin.
Das Hirschgeweih ist das geminderte Wappenbild der Grafen von DasseI. Die Aufnahme bezieht sich auf die heute noch üblichen Flurnamen „DasseIer Hof" und „DasseIer Feld", die mit dem Geschlecht von DasseI in Zusammenhang stehen sollen.
Die 6 Enden des Geweihes symbolisieren die sechs zu Rott zählenden Ortsteile Rott, Kaffroth, Silberwiese, Düsternau, Schweißbruch und Bahnhof Peterslahr.
Das Landeshauptarchiv Koblenz hat mit Schreiben 2 Zi/270-Rott vom 27. November 1979 mitgeteilt, daß gegen diesen Entwurf keine Bedenken bestehen.
Der Ortsgemeinderat Rott hat beschlossen das ausgeführte Wappen anzunehmen und künftig als Gemeindewappen Rott zu führen.
Eine Beschreibung zum Wappen liegt mir leider nicht vor.
Gespalten durch eingeschweifte rote Spitze, darin goldener, blau gezungt- und bewehrter leopardierter Löwe, vorn grün-goldene Flankenflammenspaltung, hinten in silber fünfblättriger schräger Buchenzweig.
Das Wappen weist in der ersten Hälfte darauf hin, dass das Dorf im 17. Jahrhundert von den Franzosen niedergebrannt wurde. Der Buchenzweig verweist auf die fünf Dörfer der Gemeinde sowie auf Natur und Wälder. Der Löwe stammt aus dem Wappen der Grafen von Sayn, denen das Dorf historisch gehörte.
Das Wappen wurde 2019 offiziell verliehen.
Schräggeviert von Blau und Gold. Oben eine goldene Sonne. Unten fächerförmig drei goldene Ähren zwischen zwei goldenen Pflugscharen. Rechts ein aufgeschlagenes blaues Buch. Links eine blaue Harfe.
In den Jahren 1946 bis 1949 wurde das Wappen von Clemens Bäcker, Emil Flemmer, Arnd und Horst Adorf, ehemalige Volkerzer Bürger, entworfen. Sie stellten das Warren unter den
Leitspruch:
„Das Wort ruht in des Menschen Seele,
Der Ton in froher Sangeskehle,
Das Samenkorn bringst Erde du,
Doch alles strebt dem Himmel zu.“
Das Wappen wurde heraldisch neu dargestellt von Grafiker Herrn Hans Heuser, Wuppertal.
Die Genehmigungsurkunde wurde am 14. Juni 1995 überreicht.
Schild von Rot und Gold gespalten, vorn ein goldener Leopard(oder herschauender Löwe), hinten zwei Übereinanderstehende blaue Pflugscharen.
Die alte Verbandsgemeinde Weyerbusch wurde 1970 aufgelöst. Das Erlaubnis zur Führung von Wappen von 1937 erlosch.
Die Gemeinde, die jetzt zur Verbandsgemeinde gehört, beantragte das sie ihr altes Wappen behalten würfe.
Die Genehmigungsurkunde wurde am 5. November 1970 ausgestellt.
Durch eingeschweifte rote Spitze mit silberner Rose gespalten, vorn in Silber das kurtrierische Kreuz, hinten eine brennende schwarze Bergwerkslampe.
Willroth gehörte ursprünglich im Amt Herschbach zur Grafschaft Nieder-Isenburg. Nach dem Tode des letzten Grafen, 1664, fiel es an Kurtrier, Herschbach wurde kurtrierisches Amt (Fabricius, S. 206 ff). Deshalb wurde im ersten Feld das rote kurtrierische Kreuz aufgenommen.
Über Jahrhunderte war die Wirtschaftsstruktur von Willroth durch den Erzbergbau bestimmt. Inzwischen ist die Erzgrube stillgelegt. Als Hinweis auf den Erzbergbau wurde die Urform der Beleuchtung unter Tage, die Öllampe, in das Wappen aufgenommen.
Kirchen- und Ortspatronin von Willroth ist die Kleine hl. Theresia. Ihr Attribut ist die Rose. Daher wurde in die eingeschweifte Spitze des Schildes eine silberne Rose aufgenommen.
Das Landeshauptarchiv Koblenz hat mit Schreiben Az. 2 Zi/270-Willroth, vom 27. Februar 1980 festgestellt, daß der Entwurf den heraldischen Regeln entspricht. Mit Schreiben vom 12.3.1980 hatte es einem anderen Entwurf den Vorzug gegeben.
Der Ortsgemeinderat Willroth hat sich in seiner Sitzung vom 21.3.1980 für den ausgeführten Entwurf entschieden.
Von Rot und Gold durch schräglinken, silber-schwarz gespaltenen Wellenbalken geteilt, vorn ein linksgewendeter, blaugezungt und –bewehrter goldener leopardierter Löwe, hinten ein grüner Ilexzweig.
Das Wappen ist durch einen schrägen Doppelbalken geteilt. Der Doppelbalken soll die beiden wichtigen historischen Straßen, die durch die Gemarkung des Ortes gehen symbolisieren. Die alte Heerstraße (hohe Straße, B8) silbern und die alte Kohlstraße (Wallfahrsweg) schwarz.
In der oberen Hälfte (vorn) weist der leopardierte Löwe auf die Zugehörigkeit zur Grafschaft Sayn hin und da dieser auch in den Wappen der Verbandsgemeinde Altenkirchen und des Landkreises Altenkirchen enthalten ist wird die Zugehörigkeit des Ortes Wölmersen, zu diesen Verwaltungen betont.
In der unteren Hälfte (hinten) weist auf goldenen Grund (gelb) der grüne Ilexzweig (Stechpalme) mit roten Beeren speziell auf den Wald in der Gemarkung Wölmersen hin. Der Wald ist besonders reich mit der naturgeschützten bewachsen. Die Stechpalme (Ilex aquilifolium) wird unter anderem auch als Christdorn bezeichnet und kann daher auch auf das in der Ortsgemeinde ansässige überregionale, christliche Zentrum NEUES LEBEN hinweisen. Darüber hinaus sind mit dem Ilexzweig viele bäuerlichen Traditionen verbunden, was wiederum mit der alten bäuerlichen Struktur der Gemeinde in Zusammenhang gebracht werden kann.
Die Genehmigungsurkunde wurde am 16. Juni 2004 ausgestellt.
In Rot auf goldenem gewölbten Schildfuß, dieser belegt mit einem grünen Eichenzweig, ein silberner Ziegenbock mit goldenen Hörnern.
Ziegenhain liegt auf einer Hochfläche mitten im Grünen und bietet einen schönen Ausblick in den Westerwald. Diese Höhenlage wird im Ziegenhainer Wappen, das der Ort seit 2013 trägt, durch den gewölbten Schildfuß symbolisch dargestellt. Der Eichenzweig spielt auf die mächtigen Eichen an, die in der Ortslage zu finden sind. Das im Ortsnamen vorkommende Hain oder Hahn deutet auf die Einfriedung der Gemeinde in der Vergangenheit hin. Wie im Westerwald oft üblich, war die Gemeinde mit einer dichten Hecke bzw. Hagen umgeben, die zum Schutz gegen äußere Feinde, aber auch als Einzäunung für die Weidetiere diente, die innerhalb dieses Bereichs überall weiden konnten. Mutmaßlich waren unter den Weidetieren viele Ziegen, daher der Name. Der Ziegenbock steht somit redend für den Ortsnamen.