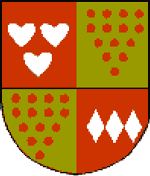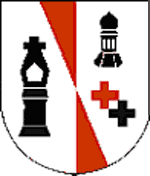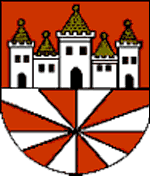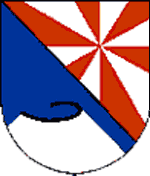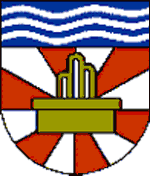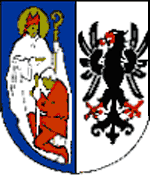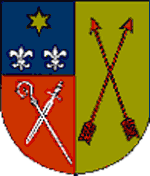Auf Blau ein goldenes Kreuz mit drei Balken, begleitet oben rechts von zwei goldenen gekreuzten Hämmern und oben links von zwei goldenen gekreuzten Ähren.
Der in Gold gefaßte Stab (Kreuzform) verweist auf den Schutzpatron der Gemeinde Brenk, den Heiligen Sylvester. Die gekreuzten goldenen Ähren sind als Symbol für die Landwirtschaft anzusehen, die gekreuzten Hämmer verweisen auf den Phonolithabbau in der Ortsgemeinde.
Wappen geviiert; oben links und unten rechts je 14 rote Kugeln (4:4:3.2.1) in Gold; oben rechts drei silberne Herzen (2:1) in Rot; unten links 3 silberne Rauten balkenweise in Rot.
Für das Gemeindewappen wurden die historischen Wappen der ehemaligen Inhaber der Herrschaft Burgbrohl kombiniert, das Wappen des namensgebenden Geschlechts der Herren von Brohl in Feld 2 und 3, das Wappen der Herren von Braunsberg in Feld 4 und das Wappen der letzten Inhaber, der Herren von Bourscheidt mit vertauschten Farben in Bild 1.
In Grün durch eine silberne Zwillingswellenleiste schräg geteilt, oben ein goldenes, sechsspeichiges römisches Rad, unten ein goldenes Hochkreuz.
Das Wappen ist durch die diagonale Darstellung des Dedenbachs von links oben nach rechts unten in zwei Felder aufgeteilt.
Im rechten oberen Feld ist ein römisches Wagenrad dargestellt. Dieses Wagenrad soll auf eine frühere Besiedlung im Bereich „An den Birken“ deuten und auf die Kohlstraße die ein Verbindungsweg -von der Hauptstraße von Trier nach Köln- zum Rhein war.
Im linken unteren Feld ist das Vaterlandskreuz dargestellt.
Bis in die 80iger Jahre des 19. Jahrhunderts wurde einmal im Jahr zu Pfingsten eine Wallfahrt nach St. Matthias in Trier unternommen. Kinder und ältere Leute die selbst daran nicht teilnehmen konnten, gaben den Wallfahrern bis zur Grenze des Flurbanns das Geleit. Dort stand das Kreuz um 1729. Der Brudermeister, der die Prozession anführte und den Wallfahrtsweg gut kannte, trug ein großes Kreuz. Am Vaterlandskreuz angekommen drehte sich der ganze Zug zum Dorf hin um und der Brudermeister machte mit dem Kreuz das Kreuzzeichen. Dabei sprach er „Leb wohl, Vaterland“. Erst nach diesen Worten traten die Kinder und alte Leute den Heimweg an. Die Wallfahrer setzten ihren Gang fort.
Der auf zwei Gefache reduzierte rote Ständer ist abgeleitet von dem zwölffach in Rot und Silber geständerten Wappen der Herrschaft Waldbott-Bassenheim, Herrn zur Olbrück.
Das Schneiderkreuz erinnert an ein Opfer der Olbrücker Herrschaft. Bei dem Kirchturm handelt es sich um das Denkmalgeschützte Zwiebeltürmchen der Sankt Rochus-Kapelle.
Die darunter befindlichen beiden Kreuze symbolisieren die kirchliche Zugehörigkeit zur Kur Trier und Kur Köln.
Durch rotes Schildhaupt, darin drei silberne Herzen (2:1), geteilt und unten gespalten. Rechts in Blau stilisierte silbenre Kirche mit drei Türmen, links in Gold 14 rote Kugeln (4:4:3:2:1).
Bei der erstmaligen urkundlichen Erwähnung gehört Glees zur Herrschaft derer von Brule (hinteres Wappen im Schild). Letzte Besitzer dieser Herrschaft waren die von Bourscheidt (Schildhaupt mit vertauschten Farben). Seit der Zeit Napoleons gehört Laach zur Gemeinde Glees (vorne im Schild stilisierte Kirche wie im Wappen von Laach)
In Rot, darin ein goldener Laubbaum (Linde) über einem symmetrischen silbergebordeten roten Balkenkreuz, eine linke silberne Flanke, darin ein blauer Doppelwellenfaden.
Die in Gold gehaltene Linde auf rotem Untergrund symbolisiert die Dorflinde in der Mitte des Ortes. Das silberne Balkenkreuz erinnert an die kirchliche Zugehörigkeit zur Kur Trier. Die in Blau dargestellten Wellenlinien auf Silbernem Untergrund verweisen auf den Zusammenfluss von Leder- und Leimbach.
In Gold ein schwarzhaariger silberner Bauer mit rotem Hut, rotem Wams, roten Hosen und schwarzen Stiefeln, mit der Linken einem schwarzen Karrenpflug führend und mit der Rechten eine schräglinke schwarze Peitsche schwingend, rechts oben begleitet von einer gesichteten roten Strahlensonne
Das Motiv des Wappens basiert auf dem Siegel des Landgerichtes der Herrschaft Kempenich vom Jahre 1596 (siehe LHAKo Best. 1C Nr. 11463 und Nr. 11475). Der Bauer mit Pflug und Sonne dient darüber hinaus noch bis ca. 1960 als Siegel des Kempenicher Amtsbürgermeisters. Die Hauptfarben des Wappens Gold und Rot nehmen Bezug auf das Wappen der Herren von Kempenich, die in Gold zwei rote Balken führten (s. LHAKo. Sammlung Eltester).
Wappen geteilt, oben in Rot eine silberne fünftürmige Burg mit goldenen Dächern, unten 12-fach von rot und silber geständert.
Die Landeshoheit über die Gemeinde übte hier die Herrschaft Königsfeld aus, deren letzte Besitzer vor 1794 die Waldbott von Bassenheim waren. Im Wappen die fünftürmige Burg als Hinweis auf die alte „Burg Königsfeld“ und ferner das Wappen der Waldbott von Bassenheim (von Rot und silber sechs mal (12-fach) geständert).
Über geteiltem Schildfuß in silber ein schwarzer Burgfried auf schwarzem Dreiberg. Schildfuß rechts 12-fach von Rot und Silber geständert, links in Blau gekreuzt ein silberner Palmzweig und eine silbene Hirtenschaufel.
Die Ruine Olbrück, Rest einer der größten ältesten Höhenburg-Anlagen der Eifel steht in der Gemarkung Niederdürenbach. Mit dem gut erhaltenen mächtigen Bergfried auf einem Phonolithkegel hoch über dem Brohltal aufragend, prägt sich wesentlich das Landschaftsbild der Region.
Das Wappen der Waldbott von Bassenheim steht für den Besitz der Burg durch dieses Geschlecht über viele Generationen. Es findet sich auch in einigen Wappen der Nachbargemeinden wieder.
Der Palmzweig steht als Märtyrersymbol für die Hl. Thekla, die Schutzpatronin des Dorfes Niederdürenbach, die als erste christliche Märtyrerin in die Geschichte der christlichen Kirche einging. Für ihre Entscheidung zu einem Leben in Keuchheit wurde sie mit dem Feuertod bestraft.
Die Hirtenschaufel steht symbolisch für den Hl. Wendelinus, den Schutzpatron des Dorfes Hain, der ein Leben als Viehhüter wählte um in Demut und Zurückgezogenheit sich den Heiligen Schriften und Frommen Übungen widmen zu können.
Schräggeteilt, oben zwölffach rot-silbern geständert, unten in Blau ein wachsender silberner Kegelstumpf mit trichterförmiger Öffnung, nach rechts durchbrochen.
Der zwölffach rot-silbern geständerte Teil erinnert an das Wappen der Familie Waldbott von Bassenheim, die seit 1554 Inhaber der Reichsherrschaft Olbrück war, zu der auch Niederzissen gehörte.
Der untere Teil zeigt in stilisierter Form den Bausenberg, der als erloschener Vulkan eine geologische Besonderheit am Ortsrand von Niederzissen ist.
Wappen gespalten; rechsts in Blau eine silberne Krone, darunter drei silberne gewellte Linien, links 12-fach von Rot und Silber geständert.
Der Wappenentwurf ist zweigeteilt.
Linke Seite:
Das Wappen der Familie Waldbott von Bassenheim (12-fach Rot Silbern geständert). Die Familie Waldbott von Bassenheim war seit 1554 Inhaber der Reichsherrschaft Olbrück, zu der auch die Gemeinde Oberdürenbach gehört.
Rechte Seite: Unter einer Königskrone 3 gewellte Linien. Symbolisch wird damit der Bezug zum Königssee in der Gemeinde Oberdürenbach hergestellt. Der Königssee stellt das Wahrzeichen der Ortsgemeinde dar.
In blauem Schildhaupt drei silberne Wellenbalken, darunter 12-fach von Rot und Silber geständert, belegt mit einem goldenen Brunnen.
Der Brohlbach, der Brenkbach und der Quackenbach durchfließen den Hoheitsbereich der Gemeinde Oberzissen. Innerhalb der Ortslage münden der Brenkbach und der Quackenbach in den Brohlbach.
Bei dem 12-fach geständerten Symbol handelt es sich um das Wappen der Waldbott von Bassenheim. Sie waren die letzten Inhaber der Reichsherrschaft Olbrück zu der auch Oberzissen gehörte. Das Brunnenbecken weist auf die Mineralwasserquelle innerhalb der Ortslage hin. Dieser Brunnen wird bereits in Zedlers Universallexikon, dem berühmtesten umfangreichsten Nachschlagwerk des 18. Jahrhunderts, beschrieben. Zwischen 1732 bis 1749 erschienen in Leipzig und Halle 46 Bände dieses Lexikons.
In Rot eine goldene Krone, darunter ein silberner Wellenbalken.
Die Landeshoheit über die Gemeinde übte ehedem die Herrschaft Landskron aus, deshalb deren Wappen in Rot eine Goldene Krone. Der Bach im Wappen weist auf den zweiten Teil des Ortsnamens.
Die Familie Waldbott von Bassenheim war seit 1554 Inhaber der Reichsherrschaft Olbrück zu der auch die Gemeinde Oberdürenbach gehörte.
Durch einen schwarzen und silberne Wellenbalken schräglinks geteilt von Silber und Grün, oben zwei schräglinks sich berührende schwebende Balkenkreuze, rot und schwarz, unten aus dem Schildrand wachsend vier nach links gestaffelte silberne Sechskantsäulen steigender Höhe, die vierte etwas kleiner als die dritte.
Die beiden Kreuze weisen auf die Zugehörigkeit an Kur Trier und Kur Köln hin, da deren Grenzverlauf genau in das Gebiet der heutigen Ortsgemeinde Spessart fiel. Die Berührung der beiden mächtigen Territorien wird durch die Berührung der Kreuze symbolisiert. Die Sechsecksäulen stehen für die Mineralvorkommen besonders den Basalt und den Hannebachit Steinvorkommen, die das Leben der Menschen in dieser Region geprägt haben. Die Grundfarbe grün ergibt sich durch die landwirtschaftliche Nutzung der Region, die Weiden und die reichen Waldgebiete besonders um Spessart. Die Anzahl der Säulen beträgt vier, wegen der vier Ortsteile Spessart, Hannebach, Wollscheid und Heulingshof, die diese Ortsgemeinde tragen.
Wappen gespalten; Rechts in Blau der Hl. Remigius, einen Mann taufend, links in Silber ein rotbewehrter schwarzer Adler.
Patron der Katholischen Pfarrkirche zu Wassenach ist der Heilige Remigius, der als Bischhof von Reims 496 den Frankenkönig Chlodwig taufte. Von dem in Wassenach begüterten Adel ist das Geschlecht derer Kolb von Wassenach das Bekanntere. Durch die Vereinigung des kirchlichen Emplems und weltlichen Wappens soll der Bezug zum Schutzheiligen der Gemeinde berücksichtigt und die historische Vergangenheit festgehalten bleiben.
Schild gespalten und vorne geteilt. Oben in Blau über zwei silbernen Lilien ein goldener Stern. Unten in Rot schräggekreuzt silberner Abtsstab und silbernes Schwert. Hinten in Gold zwei schräggekreuzte rote Pfeile.
Das Dorf Wehr gehörte seit der Gründung des Klosters Steinfeld-Eifel um das Jahr 1069 bis 1073 zu dieser späteren Prämonstratenser Abtei; Bis zur Säkularisation um das Jahr 1800. Der Abt von Steinfeld war 900 Jahre lang „Land- und Lehnherr“ zu Wehr. Er übte die höhere und niedere Gerichtsbarkeit über das Dorf aus. Viermal fand im Jahr in Wehr das Schöffengericht statt.
Die Lilien und der Stern sind dem Wappen der Abtei Steinfeld entnommen.
Der Abtstab und das Schwert erinnern daran, dass der Abt von Steinfeld auch die weltliche Herrschaft und Gerichtsbarkeit ausübte. Seit vielen Jahrhunderten sind die gekreuzten Pfeile das Wappenzeichen der Gemeinde Wehr. Sie sind die Symbole des Heiligen Potentinus, des Patrons der Wehrer Pfarrkirche.
Geteilt, oben gespalten von Silber und Blau, unten Schwarz, vorne ein durchgehendes rotes Balkenkreuz, hinten pfahlweise zwei silberne Fische, unten ein gestürzter, offener, gekröpfter, silberner Greifzirkel, belegt mit einem geöffneten, silbernen Reißzirkel mit Stellbogen.
Das Rote Kreuz deutet auf die Zugehörigkeit zum Erzbistum Trier hin. Die Fische stehen für den Namen des Ortes, der sich von Vivarium = Weiher, Fischgehege, ableitet. Die Steinmetzwerkzeuge (Zirkel) tragen der Bedeutung der Steinmetzzunft für Weibern Rechnung.