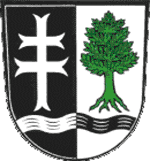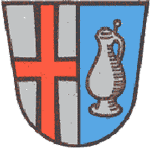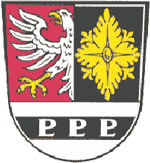Gespalten von Schwarz und Silber; vorne ein wachsender goldener Abtstab, hinten drei grüne Riednelken mit roten Blüten aus einem Stock wachsend.
Gespalten von Schwarz und Silber mit einem gesenkten Wellenbalken in verwechselten Farben; vorne ein doppelarmiges gegabeltes (zwölfspitziges) silbernes Kreuz, hinten ein bewurzelter grüner Laubbaum.
Das gegabelte Doppelkreuz stellt das Wappen des Memminger Oberhospitals (Kloster des Kreuzherrenordens) dar. Die Kreuzherren sind seit 1296 Inhaber des Kirchenpatronats. 1444 brachten sie auch den Ort Oberholzgünz in ihren Besitz. Der bewurzelte Laubbaum „redet“ für den Ortsnamen. Gleichzeitig erinnert er an die Zeit vor dem Kapellenbau von 1748 in Schwaighausen, als die Gläubigen ihre Andacht im Freien unter einem Baum verrichteten. Der Wellenbalken verweist auf den Kohbach, der als verbindendes Element der Gemeinde durch alle drei Ortsteile (Oberholzgünz, Unterholzgünz und Schwaighausen) fließt.
Der Entwurf des Wappens stammt von Stiftsarchivar und Kreisheimatpfleger Aegidius Kolb und die Gestaltung übernahm der Passauer Max Reinhart.
Unter silbernem Schildhaupt, darin ein mit goldenem Gitter belegter roter Schrägbalken, zweimal von Blau, Rot und Blau geteilt, oben nebeneinander drei silberne Eisenhüte.
Das Wappen repräsentiert drei Herrschaftsinhaber. Der Schrägbalken ist dem Wappen der Herren von Rothenstein entnommen, die 1446 den Ort Lachen als Bestandteil der Herrschaft Theinselberg erwarben. Sie waren Kemptener Dienstmannen und führten in ihrem Wappen in Weiß einen roten Schrägbalken mit gelbem Gitter. Das weiß-blaue Eisenhutfeh erinnert an die Marschälle von Pappenheim, die 1482 die Ortsherrschaft erwarben. Der Ort kam 1695 in den Besitz des Fürststifts Kempten, bei dem er bis zur Säkularisation 1802 geblieben ist. Darauf weisen die Farben Rot und Blau aus dem Wappen des Fürststifts.
Gespalten von Silber und Blau; vorne ein durchgehendes rotes Tatzenkreuz, hinten ein silberner Enghalskrug mit Deckel.
Seit 1320 ist in Memmingerberg das Spital Memmingen begütert; seit 1548 (bestätigt 1749) übte die Reichsstadt Memmingen die Hochgerichtsbarkeit im Ort aus. Diese Zugehörigkeit zum Territorium der Reichsstadt Memmingen wurde im Gemeindewappen durch die Übernahme des roten Tatzenkreuzes aus dem Memminger Stadtwappen zum Ausdruck gebracht. Innerhalb der Gemeindeflur liegt der Ort Künersberg, der in seiner Benennung auf Jakob von Küner (1697-1764) zurückgeht, einen aus Volkratshofen stammenden Pfarrerssohn, der in Wien zu einem bedeutenden Bankier aufstieg und in Künersberg eine Fayencefabrik gründete, die von 1745-1768 bestand und deren Produkte heute sehr geschätzt sind. Die Erinnerung an diese Fayencefabrik soll durch den Enghalskrug wachgehalten werden. Die Farbgebung des hinteren Feldes mit Silber - Blau deutet zugleich die Zugehörigkeit zu Bayern seit der Mediatisierung der Reichsstadt Memmingen 1803 an.
Das Wappen wurde vom Memminger Heraldiker Uli Braun gestaltet.
Gespalten von Silber und Rot; vorne ein roter Sattel, hinten eine goldene Säule mit Kreuz und Fundament.
Trunkelsberg liegt am Rande der „Memminger Mulde“, 625 m ü. d. Meeresspiegel und wird erstmalig im Jahre 972 als „Trunkenesberc“" in einer Urkunde Kaisers Otto I. erwähnt.
Es gehörte damals zum ehemaligen Gründungsbesitz des Klosters Ottobeuren. Für die Befreiung vom Kriegsdienst und von den Kriegssteuern musste das Kloster ein Drittel seines Vermögens dem Kaiser Otto I. abgeben. Darunter fiel u. a. auch Trunkelsberg, das anscheinend aus zwei Höfen mit Zubehör bestand.
Jahrhundertelang war Trunkelsberg mit der Geschichte der Ritter von Eisenburg verbunden, bis im Jahre 1455 der Eisenburger Stammsitz an drei Memminger Bürger, namens Jörg Mayr von Haan, Hans und Joos Settelin überging. Die Settelins waren nicht nur Rittergutsbesitzer, sondern auch Geschäftsleute und trieben u. a. Pferdehandel, weshalb sie in ihrem Wappen einen Pferdesattel führten. Und da die Sippschaft Settelin zweihundert Jahre lang die Herrschaft in Trunkelsberg inne hatte, übernahm die Gemeinde diesen Sattel als Symbol in ihrem Gemeindewappen.
Über silbernem Schildfuß, darin ein mit drei silbernen Großbuchstaben P belegter schwarzer Balken, gespalten von Rot und Schwarz, vorne ein halber golden bewehrter silberner Adler am Spalt, hinten eine goldene Rosette.
Seit dem Mittelalter ist im Gemeindegebiet das Kloster Ottobeuren als Grundherr und Gerichtsherr nachweisbar. 1748 erwarb die Abtei den Blutbann und damit die hohe Gerichtsbarkeit. Der Adler und die Rosette sind dem Wappen der Abtei Ottobeuren entnommen. Der Balken mit den drei Großbuchstaben „P“ im unteren Teil des Wappens erinnert an die Memminger Patrizierfamilie Vöhlin, die im 16. Jahrhundert zeitweise als Ortsherr in Ungerhausen nachweisbar ist.
Der Entwurf und die Gestaltung stammt vom Freisinger Theodor Goerge.