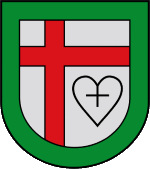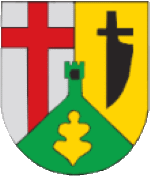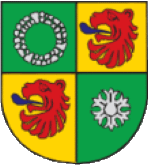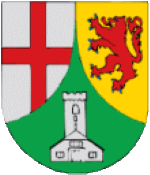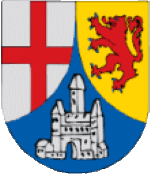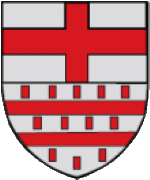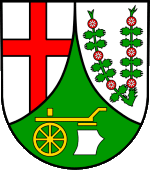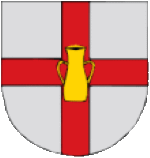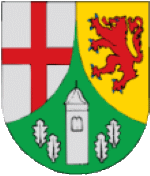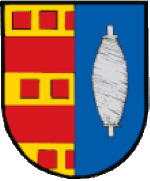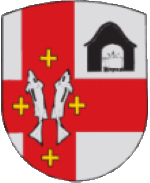Im grünen Bord steht in silbernem Feld das rote Hochkreuz, links unten begleitet von einem schwarzen, mit einem Kreuz belegten Herz.
Der grüne Bord soll die waldreiche Umgebung andeuten. Das rote Kreuz auf silbernem Grund ist das Wappen von Kur-Trier, zu dessen Herrschaft Berglicht einst gehörte. Das mit einem Kreuz belegte Herz ist dem Siegel des "Untergerichts Berg" entnommen.
Schild von eingebogener schwarzer Spitze, darin 2 abgewendete rotbezungte goldene Adlerrümpfe, gepalten; vorne in Silber ein rotes Balkenkreuz, hinten in Silber ein grüner stilisierter Eichenbaum mit Blättern und Früchten.
Das rote Kreuz auf silbernem Grund ist das Zeichen von Kur-Trier. Die in grün stilisierte Eiche steht für einen bestimmten Baum, soll aber auch Symbol für Umgebung des Dorfes sein. Auf eingeschobenem schwarzen Grund ein doppelköpfiger rotbezungter goldener Adler aus einem Kellerarsiegel (16. Jahrhundert) des Benediktinerklosters Maximin in Trier, zu dessen Herrschaft auch einst Breit gehörte.
Feld gespalten von silber und Gold, unten belegt mit grünem Winkelschildfuß, der mit goldenem Eichenblatt belegt ist und aus dessen Spitze ein grüner Burgturm wächst, vorne ein rotes Balkenkreuz, hinten ein schwarzes Pflugmesser.
Das goldene Eichenblatt gilt als Symbol für den Waldbestand der Gemeinde (im Osburger Hochwald). Der aus der Spitze des grünen Winkelschildfußes wachsende grüne Burgturm steht für den landschaftsbestimmenden Bergkegel in unmittelbarer Dorfnähe, der seit altersher mit hoher Wahrscheinlichkeit als Fliehburg diente.
Das rote Kreuz auf silbernem Grund ist das Zeichen für Kur-Trier; es soll ein Symbol für die historische und religiöse "Heimat" sein.
Das schwarze Pflugmuster auf goldenem Grund weist auf die hohe Bedeutung der Landwirtschaft als Haupterwerbsquelle bis in die jüngste Vergangenheit hin.
Schild geviert 1) in Grün ein silberner doppelter Steinring, 2) und 3) in Gold eoin blaubezungter roter Löwenrumpf, 4) in Grün eine silberne sechsteilige Blüte.
Die roten Löwenköpfe auf Gold stehen für die Wild- und Rheingrafen, zu deren Gebiet Burtscheid gehörte. Der Ringwall nimmt Bezug auf die Ortsakten des Landesmuseums, nach denen ein Wall im Distrikt "Mauer" liegt.
Die Kornblume steht für die Landwirtschaft.
Schild von aufsteigender eingebogener grüner Spitze, darin der silberne Erbeskopf-Turm, gespalten, vorne in Silber ein rotes Balkenkreuz, hinten in Gold ein blaubewehrter roter Löwe.
Das rote Balkenkreuz auf silbernem Grund in das Wappen von Kur-Trier; der blaubewehrte rote Löwe in Gold ist das Wappen der Wildgrafen, den Lehnsherren über die Mark Thalfang. Auf eingeschobenem grünen Grund in Silber der ehemalige Kaiser-Wilhelm-Turm auf dem Erbeskopf.
Schild von aufsteigender eingebogener blauer Spitze, darin silberne Burg, gespalten, vorne in Silber ein rotes Balkenkreuz, hinten in Gold ein blaubewehrter roter Löwe.
Das rote Kreuz auf silbernem Grund ist das Wappen von Kur-Trier, zu dessen Herrschaft Dhronecken einst gehörte. Der blaubewehrte rote Löwe in Gold ist das Wappen der Wildgrafen, den Lehnsherren über die Mark Thalfang, mit Sitz in Dhronecken. Auf eingeschobenem blauem Grund das Schloss der Wildgrafen in Dhronecken, am Zusammenfluss des Thalfanger- und Röderbaches, nach einer Darstellung von 1721.
In Gold ein blaubewehrter und -gezungter roter Löwe, begleitet von zehn grünen Eichenblättern.
Der rote, blaubewehrte und -gezungte Löwe auf goldenem Grund ist das Zeichen der Wild- und Rheingrafen. Die eingestreuten Eichenblätter stehen für die alte Eiche am Ortseingang und für die Eichnwälder von denen die Feldmark umgeben ist.
In Grün mit Bogenteilung zum Schildhaupt eine silberne Eiche mit Blattwerk und Wurzeln; Schildhaupt gespalten; vorne in Silber ein rotes Balkenkreuz, hinten in Gold ein blaubewehrter und blaubezungter wachsender roter Löwe.
Die silbere Eiche auf grünem Schild steht für den Bestand der mehrere hundert Jahre alten und z.T. unter Naturschutz stehenden Eichen in der Ortsgemeinde Gielert. Das rote Kreuz auf silbernem Grund ist das Zeichen von Kur-Trier. Der wachsende rote Löwe auf goldenem Grund nimmt Bezug auf die Waldgrafenschaft.
Das Wappen zeigt in geteiltem Schild oben in silber ein durchgehendes rotes Kreuz, unten in Silber zwei rote Balken, begleitet von 12 (5, 4, 2, 1) roten aufrechten Schindeln.
Das Wappen der Gemeinde Gräfendhron zeigt in der oberen Hälfte das rote Trierer Kreuz auf silbernem Grund; in der unteren Hälfte zwei rote Schrägbalken, im untersten Drittel 3, im mittleren Feld 4, im obersten Feld 5 rote Schindeln. Die Gestaltung der unteren Wappenhälfte erfolgte nach dem Hunolsteiner Wappen zur Erinnerung an die zeitweilige Zugehörigkeit des Ortes Gräfendhron zur Grafschaft und Vogtei Hunolstein.
In Silber eine grüne eingebogene Spitze, darin ein goldener Pflug mit silberner Pflugschar. Vorn ein rotes Balkenkreuz, hinten zwei grüne Heidekrautstengel mit roten Blüten.
Das rote Balkenkreuz auf silbernem Grund verweist auf die ehemalige Zugehörigkeit zum Kurfürstentum Trier. Das grüne Heidekraut mit roten Blüten ist das Symbol für die Namensgebung des Ortes. Auf eingeschobenem grünen Grund ein goldener Pflug mit einer silbernen Pflugschar als Zeichen der ehemaligen Existenzgrundlage, der Landwirtschaft.
Schild von eingebogener grüner Spitze, darin eine silberne Schmelzpfanne über silbernen Flammen, gespalten, vorne in Silber eine schwarze Lyra, hinten in Gold ein blaubewehrter roter Löwe.
Auf Silber eine schwarze Lyra als Zeichen der Verbundenheit der Gemeinde mit der Musik. Der rote Löwe ist das Zeichen der Wild- und Rheingrafen. Im eingeschobenen Feld eine Schmelzpfanne mit Flammen für die ehemalige "Eisenschmelze Röderbach", die auf der Gemarkung Hilscheid lag.
Das Wappen zeigt in Silber ein durchgehendes Kreuz, in der Mitte belegt mit einer goldenen Urne.
Das Wappen der Gemeinde Horath zeigt auf silbernem Grunde das rote Trierer Kreuz, in der Mitte überdeckt von einer römischen Urne in Gold. Dieser Krug erinnert daran, dass in Horath bedeutende Gräberfunde aus der Latènezeit gemacht wurden, wobei sehr viele Urnen zutage kamen.
In Gold ein von Silber und Blau gerauteter Schräglinksbalken, belegt mit einem blaubewehrten und -gezungten roten Löwen.
Der rote, blaubewehrte Löwe auf goldenem Grund ist das Zeichen der Wild- und Rheingrafen. Der blau-silberne Schrägbalken steht für eine ehemalige Grenzstelle in Ortsnähe, "Barriere" genannt.
Schild von eingebogener grüner Spitze, darin ein silberner Turm, rechts und links von je zwei silbernen Eichenblättern begleitet, gespalten, vorne in Silber ein rotes Balkenkreuz, hinten in Gold ein blaubewehrter roter Löwe.
Das rote Balkenkreuz istd as Zeichen von Kur-Trier. Der rote Löwe steht für die Wild- und Rheingrafen. Der von Eichenlaub begleitete Turm ist ein Wahrzeichen des Dorfes.
Unter silbernem Schildhaupt, darin ein rotes Balkenkreuz, Schild durch eingebogene aufsteigende Spitze, darin rot-silbernes Schach, gesplaten, vorne in grün 3 goldene dreiecksförmige stilisierte Bäume, hinten in grün 3 goldene Ähren.
Das rote Balkenkreuz auf silbernem Grund erklärt die ursprüngliche und jahrhundertelange Zugehörigkeit zu Kur-Trier, während das rote Schach auf silbernem Grund an die Herrschaft der Grafen von Sponheim erinnert. Über 300 Jahre war das Dorf durch einen Graben geteilt und gehörte teils zur Sponheimischen, teils zur Kur-Trierer Herrschaft. Die stilisierten Bäume weisen auf den beachtlichen Waldreichtum der Gemeinde hin. Die Landwirtschaft, symbolisiert durch die 3 Ähren, war bis vor Jahren noch die Hauptexistenzgrundlage der Dorfbewohner.
Das Wappen zeigt in Gold vor blau-gespaltenem Schilde 2 rote Balken zwischen 2 1/2 : 2 1/2 reihenweise gelegten, viereckigen (quadratischen) roten Steinen, hinten in Blau eine silberne Spindel.
Der vordere Teil des Wappens zeigt das halbe Wappen der Vögte von Hunolstein, zu deren Herrschaft Merschbach ehedem gehörte. Die Spindel ist eines der Attribute der heiligen Gertrud von Nivelles, der Patronin von Merschbach.
Schild von eingebogener grüner Spitze, darin Hammer und Schlegel in Silber, gespalten, vorn in Silber ein rotes Balkenkreuz, hinten in Gold zwei abgewendete rotgezungte schwarze Adlerrümpfe.
Das rote Balkenkreuz ist das Zeichen von Kur-Trier. Die abgewendeten Adlerrümpfe stehen für das Kloster Maximin in Trier. Hammer und Schlegel stehen für das Bleibergwerk, das einst auf der Gemarkung Neunkirchen betrieben wurde.
In Gold über zwei schwarzen Baumstümpfen im Schildfuß ein blaubewehrter und -bezungter roter Löwe, begleitet rechts von einer grünen Ähre.
Das Dorf Rorodt ist aus einer Rodung entstanden; dafür stehen die schwarzen Baumstümpfe und die aufgrünende Ähre. Der rote Löwe auf goldenem Grund ist das Zeichen der Wild- und Rheingrafen, zu deren Gebiet Rorodt gehörte.
Über den goldenen Bogenschildfuß, darin ein schwarzer Menhir, in Rot zwei goldene schrägliegende und mit den Spitzen einander zugewendete Eichenblätter, dazwischen ein goldener aufrechter Krummstab.
In Gold ein schwarzer Menhir:
Die ältesten Zeugnisse menschlicher Besiedlung in der Gemarkung Schönberg sind zwei Menhire. Das aus dem Keltischen stammende Wort Menhir bedeutet "Langer Stein". Als Flurname lebt die Bedeutung des Wortes Menhir weiter, noch heute sagt man "beim langen Stein". Diese Denkmäler aus der Jungsteinzeit (um 3000 v. Chr.) sind für Schönberg von solcher Bedeutung, dass sie als Symbol in das Gemeindewappen aufgenommen werden sollen.
Das Gold im Schildfuß, Symbol für die Sonne, betont die Bedeutung der Menhire für die Menschen in der Jungsteinzeit. Menhire dienten in der Jungsteinzeit als Hilfsmittel zur Beobachtung von Sonne und Mond, und damit konnte der Beginn der Jahreszeiten erkannt werden. Sonne und Jahreszeiten bedingen den Zyklus von Aussat und Ernte. Aussat und Ernte wurde in der Jungsteinzeit neue Grundlage für die lebenswichtige Nahrung, Grundlage für Ackerbau und Landwirtschaft. Dieser ursächliche Zusammenhang, die Sonne als Spenderin des Lebens, der erlebte und erkannte Rhythmus der Jahreszeiten, der Aussat und Ernte bedingt, kommt in den Ritualen der religiösen Feste und Opfer zum Ausdruck. Daraus ergibt sich die Bedeutung der Menhire auch als Kultstätte, als Ort der Verehrung der Ahnen und der Gottheit.
In den Farben der Symbole kommt die Bedeutung der Landwirtschaft und Natur für die Bewohner Schönbergs früher und heute zum Ausdruck, denn die Arbeit in Feld und Natur ist auch heute wesentliches Element. Das Gold im Schildfuß symbolisiert die Sonne. Die Sonne wiederum als Grundlage des Lebens, bedingt Ernte und Missernte, Erfolg und Misserfolg bäuerlicher Arbeit. Schwarz, als Symbolfarbe des Menhir, ist die Farbe der Erde und symbolisiert die Fruchtbarkeit des Bodens. Das Symbol der Fruchtbarkeit wird noch durch den Standort eines der beiden Menhire verdeutlicht; ganz in der Nähe befindet sich eine Quelle - der Kalenborn.
Zwei Eichenblätter:
Das Symbol soll auf die Lage des Dorfes hinweisen. Schönberg liegt auf einem Bergzug, der zum Dhrontal und zu zwei Seitentälern hin abfällt. Ausgedehnte Eichenwälder mit knorrigen alten Bäumen stehen auf den steilen Berghängen. Bis zum Ende des letzten Jahrhunderts waren es ausschließlich Eichenwälder. Die zwei zueinanderhin geneigten Eichenblätter deuten darauf hin, dass das Dorf früher ganz, heute noch teilweise, von Eichenwäldern umgeben ist. Alte Flurnamen "bei den Eichenbäumen" oder "Kosberch (Gosberch)" sind ein direkter Hinweis. Wahrscheinlich gab die Lage dem Dorf auch den Namen, was ebenfalls durch dieses Symbol ausgedrückt werden soll.
Der gesprochene und somit lebende Dorfname "Schemerich" kann gedeutet werden: Dorf auf dem Eichenberg. Geschrieben wird der Dorfname zwar Schönberg, aber alle Einheimischen des Dorfes und in allen Dörfern der Umgebung wird das Dorf nur "Schemerich" genannt. Das heißt also in der mündlichen Tradition lebt die alte Bedeutung "Dorf auf dem Eichenberg" weiter.
Der Ursprung des Wortes "Schemerich" geht auf das galloromanisches Wort "Cassanus-Eiche" zurück. Im Moselromanischen sowie im benachbarten französischen wird daraus chem oder chèn. Die Endung -rich deutet auf den Bergnamen hin, Eichenberg. -rich kann auch von der Endung -acum hergeleitet werden. Aus dem Wort "Chemriacum" wurde dann chemrich. Diese Wortbildung vollzog sich in keltisch-römischer Zeit.
Abtsstab in Gold:
In den schriftlichen Urkunden des 11., des 12. und des 13. Jahrhunderts ist Schönberg Besitz des Klosters Maximin bei Trier. Diese Zugehörigkeit zum Kloster Maximin besteht bis zur Auflösung des Klosters 1804 durch Napoleon. Das Kloster Maximin selbst soll auf eine Schenkung des Kaisers Konstantin im 4. Jahrhundert zurückgehen. Dem Kloster wurden viele Güter und Ländereien geschenkt.. Dazu gehörte das Gebiet zwischen der Ruwer bis zum Idarwald. In diesem Gebiet lagen die Orte Detzem, Riol, Fell, Büdlich, Schönberg, Thalfang u.a. .Diese viele Jahrhunderte dauernde Zugehörigkeit von Schönberg zum Kloster Maximin soll auch im Wappen der Gemeinde zum ausdruck kommen. Als Symbol wurde der Abtsstab gewählt.
Schild von Rot über Silber in erniedrigter Winkelteilung zum Schildfuß geteilt, oben in rot eine silberne Eiche, begleitet rechts unten von zwei goldenen Pflugmessern, links unten von einem goldenen Gemärke in G-Form.
Die Eiche ist ein Naturdenkmal des Ortes und ein Sinnbild für die Forstwirtschaft. Die Pflugmesser weisen auf die Bedeutung der landwirtschaftlichen Nutzung. Der Grundriss in Form des Buchstabens G steht als Hinweis auf die Siedlungsspuren des ehemaligen Dorfes Gospert, südöstlich gelegen von Talling. Der gestürzte Schildfuß symbolisiert die Ortslage in der Senke. In den Farben Rot-Silber bzw. Rot-Gold ist das Herrschaftsverhältnis zu Kur-Trier bzw. den Wild- und Rheingrafen wiedergeben.
In silbernem Schild ein rotes, rechtes, erniedrigtes Flankenkreuz, im Kreuzpunkt belegt mit zwei abgewendeten silbernen Salmen, die von vier goldenen Kreuzen umgeben sind. Im linken Obereck ein schwarzes Tor mit Gitter und glockenförmigem Dach.
Das rote Balkenkreuz auf silbernem Grund verweist auf die ehemalige Zugehörigkeit zum Kurfürstentum Trier. Die beiden von den Kreuzen umgebenen Salme entstammen dem Grafen von Salm. Sie erinnern an den Grafen Ernst, den Einzigen aus dem Wild- und Rheingräflichen Geschlecht, der auf dem Friedhof in Thalfang beigesetzt ist und auf dessen Grabsteinplatte ebenfalls diese Salme abgebildet sind. Das "Rost", der Eingang zum Kirchplatz, steht als Symbol für die ältesten Gebäude Thalfangs.