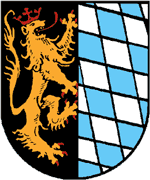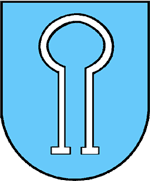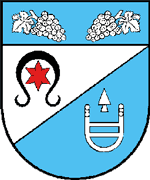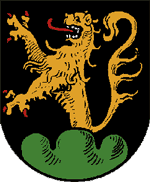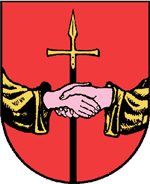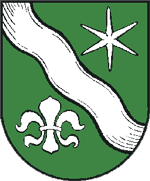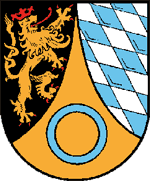Von Blau und Silber geviert, oben rechts ein silberner Pelikan mit goldenem Schnabel und goldenen Füßen, mit aus seiner Brust geschlagenen roten Blutstropfen seine silbernen Jungen zu seinen Füßen nährend, oben links über silbernem Wellenfuß eine rote Toranlage mit zwei Zinnentürmen, unten rechts ein schwarzes Mühlrad, unten links ein goldenes Schwert und ein goldener Krummstab, schräggekreuzt.
Genehmigung:
10.12.1985 Bezirksregierung, Neustadt.
Begründung:
Das Wappen der Verbandsgemeinde Billigheim-lngenheim vereint die Wappen der vier Ortsgemeinden, die ganz oder teilweise übernommen wurden. Der seine Jungen nährende Pelikan oben rechts entspricht dem Wappen der Ortsgemeinde Billigheim. Aus dem Wappen von Ingenheim wurde lediglich der Wappenschild in der Toranlage fortgelassen. Die beiden Wappen von Mühlhofen und Appenhofen erfuhren insofern eine Veränderung, als aus dem Mühlhofener Wappen die kurpfälzisch-bayerischen Attribute entfielen und nur das Mühlrad, nunmehr vollständig, übernommen wurde; aus dem Appenhofener Wappen fanden nur Schwert und Krummstab Aufnahme in das Ortsgemeindewappen.
(aus: Karl Heinz Debus, Das große Wappenbuch der Pfalz)
In Gold ein doppelköpfiger rotbewehrter und -bezungter schwarzer Adler, je einen grünen Birkenzweig in den Fängen haltend.
Genehmigung:
10.5.1985 Bezirksregierung, Neustadt.
Begründung:
Die Gemeinde Birkweiler siegelte 1779 nachweislich mit dem die ehemalige Reichsunmittelbarkeit dokumentierenden Adler des Siebeldinger Tals von 1730. Dieses Siegel wurde unverändert bis 1954 geführt. In diesem Jahr wurde der Genehmigungsantrag der Gemeinde unter Hinweis auf das genehmigte Wappen von Siebeldingen abgelehnt, wiewohl sich dieses durch Beifügung einer Krone unterschied. Die Gemeinde folgte dem damaligen Änderungsantrag des Staatsarchivs und führte seitdem in gespaltenem Schild einen halben Adler am Spalt in Verbindung mit dem redenden Symbol einer Birke. Die Ortsgemeinde war mit diesem Wappen nie recht einverstanden. Dem Änderungsantrag der Gemeinde wurde entsprochen und ihr der doppelköpfige Adler wieder zugestanden, zur Unterscheidung von dem Wappen der Gemeinde Siebeldingen wurden dem Adler allerdings Birkenzweige beigegeben, die ebenso wie der Birkenbaum im Wappen von 1954 den Ortsnamen versinnbildlichen.
(aus: Karl Heinz Debus, Das große Wappenbuch der Pfalz)
Durch eine blaue Leiste von Grün und Gold geteilt, oben ein schreitender herschauender rotbewehrter und -bezungter silberner Löwe (Leopard), unten ein schwarzes Gemarkungszeichen in Form eines Kesselhakens.
Genehmigung:
13.8.1929 Bayerisches Staatsministerium des Innern, München.
Begründung:
Nach Siegelkarenz 1606 ist 1723 das nunmehr geführte Wappen als Siegel belegt. Die obere Wappenhälfte entspricht, auch in der Farbgebung, dem Wappen der Herren von Steinkallenfels, die Rechte in Böchingen ausübten. Die Leiste entstammt vielleicht dem Wappen der Herren von Zeiskam, die zuvor grundherrliche Rechte in Böchingen besaßen. Der Kesselhaken schließlich ist dem Wappen der zweiten Oberhaingeraide entnommen, der Böchingen angehörte. Nach der Französischen Revolution führte man in Böchingen ein reines Schriftsiegel, benutzte aber dann wieder das alte Gerichtssiegel.
(aus: Karl Heinz Debus, Das große Wappenbuch der Pfalz)
In Grün drei silberne Schrägwellenbalken.
Genehmigung:
2.12.1937 Reichsstatthalter in Bayern.
Begründung:
Das Wappen entspricht dem bereits 1626 nachgewiesenen Gerichtssiegel. Es wird hierin eine Deutung des Ortsnamens gesehen Ein direkter Bezug zu den Herren von Fleckenstein, die ein ähnliches Wappen führten, ist nicht bekannt.
(aus: Karl Heinz Debus, Das große Wappenbuch der Pfalz)
In gespaltenem Schild rechts in Schwarz ein linksgewendeter, rotbewehrter, -bezungter und -bekrönter goldener Löwe, links von Silber und Blau gerautet.
Genehmigung:
16.8.1844 König Ludwig I. von Bayern.
Begründung:
Ein 1499 nachgewiesenes Gerichtssiegel von Frankweiler zeigt die Gottesmutter mit dem Kind auf einem steigenden Halbmond stehend. Als das ursprünglich dem Speyerer Domkapitel gehörende Dorf an Kurpfalz verkauft wurde, ersetzte man das frühere Siegel durch den auch heute noch gebräuchlichen gespaltenen kurpfälzischen Schild. Der König genehmigte gegen den Entscheid des Reichsheroldsamtes nach Befürwortung durch Minister Abel das Siegel als Wappen.
(aus: Karl Heinz Debus, Das große Wappenbuch der Pfalz)
In Blau ein silbernes HaIseisen.
Genehmigung:
7.11.1961 Ministerium des Innern, Mainz.
Begründung:
Nach Siegelkarenz 1531 erscheint erstmals 1760 ein Gerichtssiegel von Göcklingen mit dem Halseisen (Schafschere?) als Gemarkungszeichen. Der König genehmigte dieses Siegel mit dem barocken Zierelement eines Engelsköpfchens als Wappen, wobei eine muschelartige Verzierung des Schildes außerhalb des Wappenfeldes fehlgedeutet wurde. Hupp hat zudem noch unter Fortlassung des unheraldischen Beiwerks das Halseisen nach außen gebogen, statt es auf zwei Füße zu stellen. Die Genehmigung von 1961 hat diese Abweichungen vom alten Siegel wieder korrigiert.
(aus: Karl Heinz Debus, Das große Wappenbuch der Pfalz)
Unter blauem Schildhaupt, darin zwei schräggestellte beblätterte silberne Trauben, von Silber und Blau schräglinks geteilt, oben ein schwarzer Kesselhaken, in dessen Bogen ein schwebender sechsstrahliger roter Stern, unten ein silbernes Gemarkungszeichen in Form eines großen U, dessen Schenkel durch zwei Balken verbunden und am oberen Ende mit je zwei Kugeln besetzt sind, darüber eine schwebende spitze silberne Pflugschar.
Genehmigung:
11.9.1985 Bezirksregierung, Neustadt.
Begründung:
Die Ortsgemeinde Heuchelheim-Klingen wurde im Zuge der Verwaltungsreform aus den beiden zuvor selbständigen Gemeinden Heuchelheim und Klingen geschaffen. Beide verfügten über ein eigenes Wappen; diese wurden in das neugeschaffene Wappen aufgenommen, oben der Kesselhaken von Heuchelheim, unten das Gemarkungszeichen von Klingen. Die Gemeinde lebt vornehmlich vom Weinbau, was durch die beblätterten Trauben im Schildhaupt zum Ausdruck kommen soll.
(aus: Karl Heinz Debus, Das große Wappenbuch der Pfalz)
In Schwarz aus grünem Dreiberg wachsend ein rotbewehrter und -bezungter goldener Löwe.
Genehmigung:
9.10.1931 Bayerisches Staatsministerium des Innern, München.
Begründung:
Das Wappen entspricht dem seit 1606 - nach Hupp bereits seit 1497 -benutzten Gerichtssiegel, dem Hupp die pfälzischen Farben verliehen hat. Der schlechte Stempelschnitt, dessen Wappentier mehr einem Wolf als einem Löwen ähnelt, wurde um 1700 verbessert.
(aus: Karl Heinz Debus, Das große Wappenbuch der Pfalz)
In Gold ein roter Ring, in dessen silbernem Innern ein schwebendes gerundetes schwarzes Tatzenkreuz.
Genehmigung:
19.1.1962 Ministerium des Innern, Mainz.
Begründung:
In Impflingen siegelten nachweislich seit 1499 die Schultheißen mit ihrem eigenen Siegel. 1609 wird von einem Gerichtsschultheißereisiegel gesprochen, 1615 hinwiederum entbehrt die Gemeinde offensichtlich eines eigenen Siegels. Erst 1698 wird ein eigentliches Gerichtssiegel geschaffen, das nur einen Ring, wohl das Gemarkungszeichen, zeigt. Dieses Zeichen blieb über die Revolutionszeit hinaus lebendig und wurde von Hupp abgebildet. Ein Antrag 1930 führte nicht zur Verleihung. Während des Genehmigungsverfahrens 1961 griff das Staatsarchiv auf das GerichtsschultheißensiegeI von 1609 zurück, das in dem Ring noch ein Tatzenkreuz zeigt.
(aus: Karl Heinz Debus, Das große Wappenbuch der Pfalz)
In Rot zwei natürliche gereichte "treue" Hände mit goldenen Ärmeln, dahinter in der Mitte eine schwarze Lanze mit goldener Kreuzspitze, beiderseits anstoßend.
Genehmigung:
20.2.1957 Ministerium des Innern, Mainz.
Begründung:
Nach Siegelkarenz 1489 und 1561 ist zu 1773 ein Siegel mit der Initiale K als Gemarkungszeichen überliefert, das von Hupp farblich gefasst und veröffentlicht wurde. Dieses alte Gemerk wurde 1957 durch die beiden gereichten Hände aus dem Wappen der ortsansässigen Ritterfamilie von Knöringen ersetzt, unterlegt mit der Kreuzeslanze des Erzengels Michael, des Patrons der nahen Abtei Klingenmünster, die Vogtei- und bis 1490 Patronatsrechte in Knöringen ausübte.
(aus: Karl Heinz Debus, Das große Wappenbuch der Pfalz)
In Blau ein halber rotbewehrter und -bezungter silberner Löwe.
Genehmigung:
14.6.1844 König Ludwig I. von Bayern.
Begründung:
Ein Siegelstock belegt, dass das Gericht Leinsweiler schon um 1500 einen wachsenden Löwen im Schild führte. Nach der Freiheitsgöttin mit Jakobinermütze in der Revolutionszeit, wünschte man an Stelle des wachsenden Löwen eine ganzen, doch der König entschied sich trotz anderslautender Befürwortung durch den Reichsherold für die Beibehaltung des frühen Siegelbildes.
(aus: Karl Heinz Debus, Das große Wappenbuch der Pfalz)
In Grün ein silberner Schrägwellenbalken, oben beseitet von einem sechsstrahligen silbernen Stern, unten von einer silbernen Lilie.
Genehmigung:
21.4.1960 Ministerium des Innern, Mainz.
Begründung:
Das Siegelbild des Gerichtssiegels von Ranschbach zeigt nach Siegelkarenz 1452 seit 1472 stets den Schrägwellenbalken, im 18. Jahrhundert allerdings als Schräglinkswellenbalken. Dieses von Hupp als Wappen veröffentlichte Siegel blieb ungenehmigt. Anlässlich des Genehmigungsverfahrens 1960 wurde die Gemeinde unter Hinweis auf das zuvor verliehene gleichlautende Wappen von Grönenbach in Bayern überredet, unter Beibehaltung der von Hupp willkürlich gewählten Farben den Schrägwellenbalken mit Beizeichen zu versehen. An Stelle der von der Gemeinde unter Hinweis auf den früheren Wallfahrtsort Kaltenbrunnen und das dortige Gnadenbild vorgeschlagenen Madonna wurden die marianischen Attribute Stern und Lilie dem früheren Wappen hinzugefügt.
(aus: Karl Heinz Debus, Das große Wappenbuch der Pfalz)
In Gold ein doppelköpfiger schwarzer Adler, darüber eine schwebende goldene Kaiserkrone.
Genehmigung:
27.1.1922 Bayerisches Staatsministerium des Innern, München.
Begründung:
Das Wappen, in den Reichsfarben gehalten, entspricht dem Siegel des Gerichts von Siebeldingen, das sich von dem des Siebeldinger Tals, belegt seit 1517, nur durch Hinzufügung der Krone unterscheidet. Diese hält die Erinnerung an Rudolf von Habsburg wach, der dem SiebeIdinger Tal Freiheiten nach dem Recht der Stadt Speyer verbriefte; auf diese Reichsfreiheit verweist der Reichsadler.
(aus: Karl Heinz Debus, Das große Wappenbuch der Pfalz)
Durch eine eingebogene goldene Spitze, darin ein schwebender blauer Ring, gespalten, rechts in Schwarz ein linksgewendeter rotbewehrter, -bezungter und -bekrönter goldener Löwe, links von Silber und Blau gerautet.
Genehmigung:
25.8.1956 Ministerium des Innern, Mainz.
Begründung:
Das seit 1441 belegte Siegel von Walsheim zeigt den gespaltenen kurpfälzischen Schild mit Löwe und Rauten und ist so gleichbleibend bis zur Französischen Revolution belegt. Die Gemeinde führte dieses Siegel im 19. Jahrhundert als Wappen weiter, eine Genehmigung war jedoch nicht erfolgt. Zur Unterscheidung von anderen kurpfälzischen Wappen wurde bei der amtlichen Verleihung 1956 ein Beizeichen in Form eines Ringes hinzugefügt, wie er auf Grenzsteinen von Walsheim erscheint.
(aus: Karl Heinz Debus, Das große Wappenbuch der Pfalz)