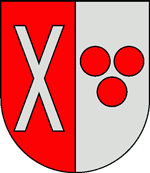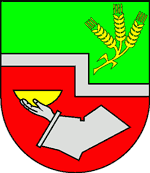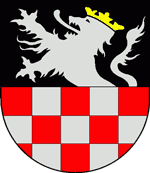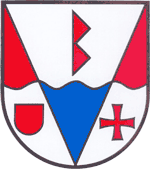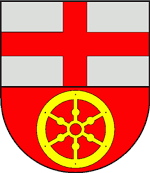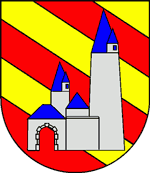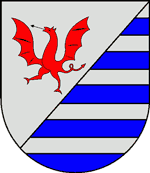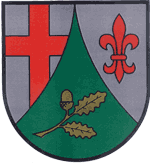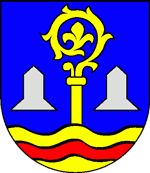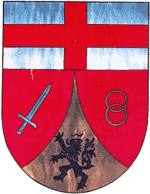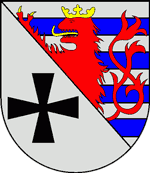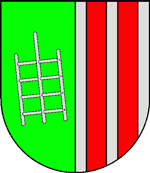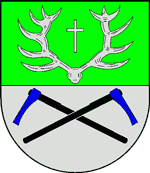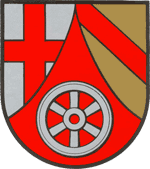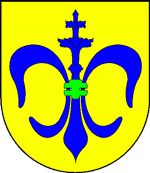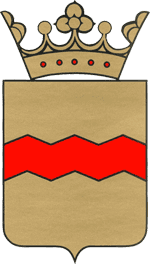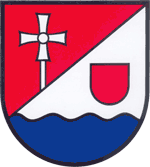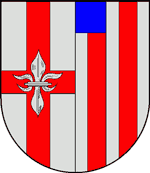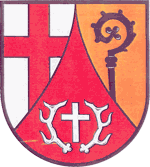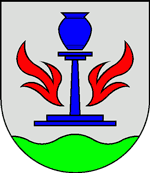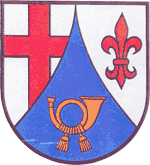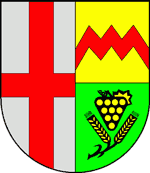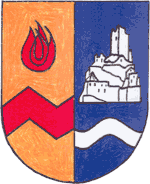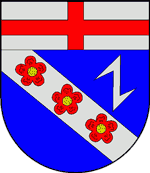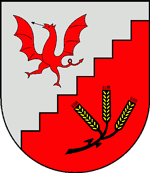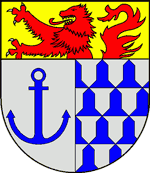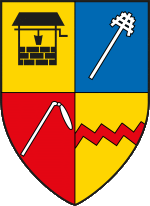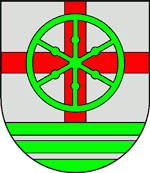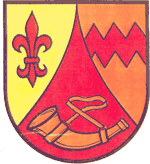Schild Rot und Weiß gespalten, vorne ein weißes Andreaskreuz, hinten 2 (2:1) rote Kugeln.
Mit Genehmigung der Bezirksregierung Trier vom 29.04.1971 erhielt die Gemeinde Altrich das Recht, ein eigenes Wappen zu führen.
Das Andreaskreuz in der vorderen Schildhälfte steht als Symbol für den im alten Gerichtssiegel, überliefert im Jahre 1764, dargestellten Kirchenpatron St. Andreas. Die hintere Schildhälfte erinnert an ein nach Altrich benanntes Rittergeschlecht, das im 14. Jahrhundert nachweisbar ist.
Die Farben Rot und Weiß weisen auf die ehemalige Zugehörigkeit zum Kurfürstentum Trier hin.
Wappen von rechtem silbernem Stufenbalken geteilt, oben in Grün links 3 goldene Ähren, unten in Rot ein silberner Ärmel mit silberner Hand, die eine goldene Schale hält.
Mit Genehmigung der Bezirksregierung Trier vom 15. April 1982 erhielt die Gemeinde Arenrath das Recht, ein eigenes Wappen zu führen.
Die silberne Stufeneinteilung des Schildes und die Bettlerschale gelten als Symbole des Kirchenpatrons St. Alexius, der als Bettler unter der Treppe in der Legende dargestellt wird. Die Ähren deuten die Landwirtschaft, das grüne Feld den Namen der Ortschaft - die Rodung des Arend (Sagenbuch des Krs. Wittlich S. 81) -. Grün bedeutet Wald und Feld und Rot-Silber erinnern an die Trierer kurfürstliche Herrschaft.
Schild geteilt, oben in Schwarz ein goldbekrönter und goldbewehrter silberner wachsender Löwe, unten silber-rot geschacht.
Mit Genehmigung des Ministers des Inneren des Landes Rheinland-Pfalz vom 4. Oktober 1967 erhielt die Gemeinde Bergweiler das Recht, ein eigenes Wappen zu führen.
Für ein in der Geschichte begründetes Wappen für Bergweiler muß man auf die territorialen Gegebenheiten vor 1789 zurückgreifen. Grundherr von Bergweiler war der Freiherr von Warsberg. Er übte seine Befugnisse aus innerhalb der dem Grafen von Sponheim übertragenen reichsunmittelbaren Herrschaft Bergweiler.
Daher muß das Bergweilerer Wappen sowohl die Herrschaft der Sponheimer Grafen, als auch die Grundherrlichkeit der Freiherren von Warsberg zum Ausdruck bringen.
Das geschieht durch ein geteiltes Wappen, dessen untere Hälfte das weiß und rot geschachte Sponheimer Wappen und dessen obere Hälfte im schwarzen Feld den goldbekrönten wachsenden silbernen Warsberger Löwen zeigt.
Von Rot über Silber durch Wellenschnitt geteilt, darin eine gestürzte, von Silber über Blau geteilte Spitze, oben 2 linke, rote Spickel, unten begleitet links von einem roten Tatzenkreuz, rechts von einem roten Schildchen.
Bettenfeld besitzt im 519 Meter hohen Mosenberg einen ehemaligen Vulkan mit gut erhaltenem Kratersee. Im Wappen ist diese landschaftliche Besonderheit heraldisch dargestellt.
Bereits im Jahre 1239 war der Hof Bettenfeld im Besitz Theoderichs von Malberg (Beyer, UKB 111, Nr. 669). Diese Zugehörigkeit bestand bis zum Ende der Feudalzeit. Das Zeichen der Malberger, ein rotes Schildchen in Silber. Es ist im unteren Schildteil aufgenommen.
Kirchen- und Ortspatron von Bettenfeld ist seit alter Zeit der hl. Johannes der Täufer. Er führt als Attribut ein Vortragekreuz. Im Wappen ist dies als Tatzenkreuz wiedergegeben.
Das Landeshauptarchiv hat mit Schreiben 2 Zi/270-Bettenfeld, am 13.06.1983 den Entwurf im Grundsatz gebilligt, indes einige Änderungen erbeten. Diese sind erfolgt.
Der Ortsgemeinderat Bettenfeld hat am 05. Juli 1983 beschlossen, das ausgeführte Wappen anzunehmen und künftig als Gemeindewappen zu führen.
In Silber und Rot geteiltem Schild oben ein rotes Balkenkreuz, unten ein sechsspeichiges goldenes Rad.
Mit Genehmigung der Bezirksregierung Trier vom 14. Januar 1980 erhielt die Gemeinde Binsfeld das Recht ein eigenes Wappen zu führen.
Übernahme des Wappens der früheren Verbandsgemeinde Binsfeld. Auf den grünen Schildbord ist zu verzichten, da der Schildbord nur den Wappen für Verbandsgemeinden zugeordnet werden kann. Die Ortsgemeinde Binsfeld unterstand ehedem dem Kurfürstentum Trier, daher auch das kurtrierische rote Kreuz in Silber. Das goldene Rad steht einmal als Symbol für die Landwirtschaft, dann aber auch für den in Binsfeld früher weit verbreiteten HausierhandeI. In Binsfeld waren früher Hausierhandel und -gewerbe, sowie bis zur Gegenwart auch Landwirtschaft vorrangig in der Erwerbsstruktur.
Schild, von oben links nach unten rechts fünfmal von Gold und Rot schräggeteilt, belegt mit einem silbernen Burgturm mit blauem Dach und zwei blauen Fenstern.
Mit Genehmigung der Bezirksregierung Trier vom 24.03.1983 erhielt die Ortsgemeinde Bruch das Recht, ein eigenes Wappen zu führen.
Der schräggeteilte, rot-goldene Schild war das Wappen der Edlen Herren von Bruch, dem ersten Adelsgeschlecht, das die Brucher Burg bereits in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts als Stammsitz bewohnte. Das Bild der Ortschaft Bruch wird wesentlich von dieser Burg, einer Wasserburg, geprägt.
In Silber auf rotem Dreiberg, darin eine goldene Hirschstange, drei grüne Fichten mit goldenen Zapfen.
Das Wappen wurde gemäß Beschluß des Gemeinderates von Dierscheid vom 26. April 1982 angenommen:
Dieses sogenannte sprechende Wappen gibt Auskunft über den Ortsnamen und die geographische Lage. Der Name Dierscheid bedeutet soviel wie Rehwild -darum Fichten und Gehörn. Der Schildfuß symbolisiert die Lage des Ortes auf einer Berghöhe der Voreifel. Die Farben Silber und Rot erinnern an die Zugehörigkeit zum Kurfürstentum Trier.
Schild von links oben nach rechts unten geteilt. In der rechten oberen Hälfte oben in Silber ein roter Drache, in der linken unteren Hälfte 9 mal in Silber und Blau quer geteiltes Feld.
Am 19. Oktober 1981 beschloß der Gemeinderat von Dodenburg die Einführung des Wappens.
Der rote Drache in Silber ist das Wappen des Geschlechtes von Kesselstatt. Die Geschichte Dodenburgs ist wesentlich von den Reichsgrafen von Kesselstatt geprägt worden. Das Dodenburger Schloß, eine frühere Wasserburg, kam im Jahre 1790 durch Erbteilung an Kasimir Friedrich von Kesselstatt. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde er mit der Burg belehnt. Die Luxemburger Farben (Blau und Silber) symbolisieren die ehemalige Zugehörigkeit Dodenburgs zum Herzogtum Luxemburg.
In Gold ein schwarzer doppelköpfiger Reichsadler mit rotem Nimbus, belegt mit einem silbernen Kreuz, dem eine fleischfarbige Schwurhand aufliegt.
Mit Genehmigung des Landes Rheinland-Pfalz vom 20. März 1962 erhielt die Gemeinde Dreis die Erlaubnis zur Führung eines eigenen Wappens.
Das Wappen ist einem Gerichtssiegel von Dreis aus dem Jahre 1722 entnommen. Kreuz und Schwurhand sind auf lokale Wappentradition als Zeichen der Gerichtsbarkeit zurückzuführen.
In Gold ein erniedrigter roter Zickzackbalken, belegt mit schwarzem Keil, darin drei goldene Ähren unter einer goldenen Krone.
Die Gemeinde Eckfeld stand in enger Beziehung zur Grafschaft Manderscheid. Sie war seinerzeit die größte Gemeinde dieser Grafschaft.
Der rote Zickzackbalken im goldenen Feld deutet auf die Zugehörigkeit der Gemeinde Eckfeld zur Grafschaft Manderscheid hin.
Der schwarze Keil mit den drei goldenen Ähren symbolisieren den Namen Eckfeld. Die Spitze des Keiles steht für die Silbe "Eck" ( abgeleitet vom altdeutschen Wort "Ak“) und die Ähren deuten auf "Feld". Gleichzeitig wird damit der noch überwiegend bäuerliche Charakter der Gemeinde zum Ausdruck gebracht.
Die goldene Krone versinnbildet, daß Eckfeld ursprünglich königliches Eigentum war.
Gespalten von Gold durch eine eingebogene rote Spitze, darin ein silbernes Gemerke der verschlungenen Buchstaben I und S, vorne ein roter Sparrenbalken, hinten schräggekreuzt schwarzer Hammer und schwarze Zange.
Das Gemerke mit den verschlungenen Buchstaben I und S steht für "Isen-Schmitt", die alte Eisenschmitter Hüttenmarke aus dem 16. Jahrhundert. Die Farben rot und silber sind die Malberger Farben, zu deren Herrschaft Eisenschmitt bis zum Ende der Feudalzeit gehörte.
Der Sparrenbalken im ersten Feld ist das Zeichen der Grafschaft Manderscheid. Er deutet auf die Zugehörigkeit zu der ehemaligen Grafschaft Manderscheid hin.
Im zweiten Feld stehen Hammer und Zange. Sie sind Symbol für die jahrhundertelang bestehende Eisenindustrie, von der der Ort auch seinen Namen erhielt.
Das Landeshauptarchiv Koblenz hat mit Schreiben 2 Zi/270 Eisenschmitt, vom 21. April 1986 den Wappenentwurf befürwortet, nachdem einige verschiedene Korrekturen vorgenommen wurden. Diese sind erfolgt.
Die Verbandsgemeindeverwaltung Manderscheid hat am 25. April 1986 mitgeteilt, daß die Ortsgemeinde Eisenschmitt den ausgeführten Entwurf angenommen habe und künftig als Gemeindewappen führen will.
Unter goldenem Schildhaupt, darin ein wachsender roter Löwe, silber-blaues Eisenhutfeh.
Mit der Genehmigung der Bezirksregierung Trier vom 13. März 1972 erhielt die Gemeinde Esch das Recht, ein eigenes Wappen zu führen.
Esch ist der Sitz der Burgherren bzw. Ritter von Esch. Das Wappen des Ritters Konrad von Esch, 1330, (unter goldenem Schildhaupt mit Löwen, Grauwerk-Eisenhutfeh) ist unverändert übernommen.
Gespalten durch eine eingeschweifte grüne Spitze, darin ein goldener Eichenzweig mit zwei Blättern und einer Eichel. Vorne in Silber ein rotes Hochkreuz, hinten in Silber eine rote Lilie.
Gipperath wurde im Jahre 1098 erstmals urkundlich erwähnt: Kaiser Heinrich III bestätigte dem Simeonstift in Trier unter anderem Besitzungen in Gipperath.
Im Jahre 1179 bekundete Erzbischof Arnold von Trier, daß Abt und Konvent von Echternach zugunsten des Trierer Erzbistums auf sämtliche Rechte in Gipperath verzichtet (Goldenes Buch der Abtei Echternach, Gotha, fol. 102 v. u. 103). Dadurch wurde Gipperath Teil des späteren Kurfürstentums Trier.
Das kurtrierische Kreuz irn vorderen Teil des Wappens bildet den Bezug zum Erzbistum Trier. Die Abtei Echternach führt als Symbol ein Clevenkreuz; dafür steht im hinteren Teil des Wappens die rote Lilie.
Als landschaftliche Besonderheit eigener Art steht auf der Höhe vor der nördlichen Ortseinfahrt von Gipperath ein 200-jähriger, als Naturdenkmal ausgewiesener Eichenhain. Auf diese Besonderheit weist der goldene Eichenzweig mit der goldenen Eichel in der eingeschweiften grünen Spitze hin.
Das Landeshauptarchiv Koblenz hat mit Schreiben vom 14.05.1998; Az.: Z Hs/3801-2320, mitgeteilt, daß der ausgeführte Entwurf heraldisch einwandfrei sei und der Genehmigungsbehörde vorgelegt werden könne.
Der Ortsgemeinderat Gipperath hat in seiner Sitzung vom 08.07.1998 beschlossen, den ausgeführten Entwurf anzunehmen und künftig als Wappen der Ortsgemeinde Gipperath zu führen.
In Blau auf einem goldenen Wellenschildfuß, darin ein roter Wellenbalken, ein gekürzter goldener Abtstab, begleitet rechts und links von je einem silbernen fehförmigen Eisenhut.
Das Wappen wurde auf Beschluß des Gemeinderates von Gladbach vom 06. Juni 1983 angenommen:
Das Pedum erinnert an den heiligen Willibrord, den ehemaligen Patron der Kapelle Gladbach und darüber hinaus an die Beziehungen zur Abtei Echternach. Die Eisenhutfeh erinnert an die Zeit Theoderichs von Esch (um 1278). Die Farben Rot und Silber stehen für die Herrschaft der Trierer Kurfürsten. Der goldene Wellenschildfuß symbolisiert den Namen des Ortes Gladbach, heller, glänzender Bach.
Von Schwarz über Silber geteilt, oben ein wachsender, rot bewehrter Drache, unten zwei gekreuzte blaue Rodehacken.
Greimerath ist nach de Lorenzi sehr alte eigenständige Pfarrei (S.666). Bereits bei der Visitation 1569 war Greimerath selbständige Pfarrei. Der Erzbischof von Trier bezog 2/3 des Zehnten, der Pfarrer 1/3. Kirchen- und Ortspatron ist seit altersher St. Georg. Sein Attribut, ein Drache, steht in der oberen Schildhälfte.
Greimerath ist in Beyer, Urkundenbuch 1144 erwähnt. Der Ortsname geht zurück auf das althochdeutsche und mittelhochdeutsche „-rod", „-ried"... mundartliche Formen „-rad", „-rath“ = Rodung (Müller, II, S. 60).
Als Hinweis auf die Deutung des Ortsnamens sind in der unteren Schildhälfte zwei gekreuzte Rodehacken aufgenommen.
Das Landeshauptarchiv Koblenz hat mit Schreiben 1 Kr/3801-2061 vom 06. August 1993 mitgeteilt, daß der ausgeführte Entwurf „unverändert der Kreisverwaltung zur Genehmigung vorgelegt werden.“ könne.
Der Ortsgemeinderat Greimerath hat in seiner Sitzung vom 25. August 1993 beschlossen, den ausgeführten Entwurf anzunehmen und künftig als Gemeindewappen Greimerath zu führen.
Unter silbernem Schildhaupt, darin ein rotes Balkenkreuz, durch eingeschweifte goldene Spitze, darin ein schwarzer Löwe, gespalten; vorne in Rot ein silbernes Schwert nach links, hinten in Rot zwei ineinander geschlungene goldene Ringe.
In sehr engem Zusammenhang mit den Anfängen des Ortes stand ein Rittergeschlecht, das - abgeleitet vom Namen ihrer im luxemburgisch-lothringischen Grenzgebiet liegende Stammburg Rüttgen- „von Rutich", „von Roucy“, „von Rozeio“, „von Ruzei“, „von Roscei", „von Rocei“, „von Ruscheio" hieß. Mit dem luxemburgischen Grafenhaus standen sie in enger verwandtschaftlicher Beziehung; ihr Wappen zeigt einen von rechts aufsteigenden, gekrönten Luxemburger Löwen*).
Ein Familienzweig dieser Ritter nannte sich später die „von Litiche", nachdem der Ortsname von Großlittgen von ihnen als Familienname übernommen wurde**).
Im 12. Jahrhundert ist den Litichern die Grundherrschaft über Großlittgen in Form eines Lehens vom luxemburgischen Grafenhaus übergeben worden***).
Bis 1341 waren die luxemburger Grafen im Gebiet von Großlittgen die Landesherren. Von 1341 bis Ende des 18. Jahrhunderts gehörte Großlittgen zu Kurtrier. Am 25. November 1346 erhob der Trierer Kurfürstbischof Balduin Großlittgen in den Städterang und gab damit den Bürgern des Ortes erstmals das wichtige Bürgerrecht, ein in der Geschichte der Zivilgemeinde von Großlittgen bedeutendes Datum.
Seit 1802 gehört das Kloster Himmerod zur Zivilgemeinde Großlittgen. Das Kloster Himmerod ist bereits über 850 Jahre ein weit über die nähere Heimat hinaus sehr bekanntes religiöses, geistiges und kulturelles Zentrum.
Der Hl. Martin von Tours ist seit alter Zeit Pfarr- und Ortspatron von Großlittgen. Er führt als Attribute ein Schwert und seinen Mantel. Die beiden unteren linken und rechten roten Teilbereiche sollen symbolhaft den, mit dem Schwert, geteilten Mantel darstellen.
*)+**)+***) aus: Manderscheid - Geschichte einer Verbandsgemeinde in der südlichen Vulkaneifel, 1986, Seite 708, Herausgeber: Verbandsgemeinde Manderscheid, verfaßt von Günter Hesse und Wolfgang Schmitt-Kölzer
Das Landeshauptarchiv Koblenz hat mit Schreiben vom 11.06.1987, Az.: 2 Zi/270-Großlittgen, mitgeteilt, daß gegen den ausgeführten Entwurf keine Bedenken bestehen.
Der Gemeinderat Großlittgen hat am 23. Juli 1987 beschlossen, den ausgeführten Entwurf anzunehmen und künftig als Gemeindewappen zu führen.
Schild von Gold über Blau geteilt, oben ein wachsender, schwarzer, rot bewehrter Adler, unten ein goldener Eichenzweig mit drei Blättern und einer Eichel.
Hasborn war bis zum Ende der Feudalzeit eine geschlossene reichritterschaftliche Besitzung. Sie gehörte den Freiherren von Wiltberg (Fabricius S. 531 und 546 Ziff . 69). Als Hinweis auf den reichsritterschaftlichen Status steht der Reichsadler an erster Stelle.
Als landschaftliche Besonderheit eigener Art weist Hasborn innerhalb der Ortslage einen 300-jährigen Eichenbestand auf. Um dies, von der Bezirksregierung unter Naturschutz gestellte Eichenwäldchen herum, hat sich die Ortslage entwickelt.
Wegen dieser Besonderheit, die kaum eine andere Gemeinde aufweist, ist im unteren Schildteil der goldene Eichenzweig aufgenommen (Vgl. G. Hesse/W. Schmitt-Kölzer, Manderscheid, Bernkastel 1986, S. 747).
Das Landeshauptarchiv Koblenz hat mit Schreiben 2 Zi/270-Hasborn vom 15.12.88 festgestellt, daß die Entwürfe den heraldischen Regeln entsprechen. Der vom Landeshauptarchiv favorisierte Entwurf 2 ist ausgeführt worden.
Der Bürgermeister der Ortsgemeinde Hasborn hat mit Schreiben vom 04.01.1989 mitgeteilt, das der Ortsgemeinderat den vom Landeshauptarchiv Koblenz bevorzugten Entwurf beschlossen habe anzunehmen und künftig als Gemeindewappen zu führen.
Im schräggeteilten Schild vorne in Silber ein schwarzes Tatzenkreuz, hinten in Silber 4 blaue Balken, belegt mit einem roten, goldgekrönten, wachsenden Löwen.
Mit dem Gerneinderatesbeschluß vom 19.10.1981 wurde für die Gemeinde Heckenmünster das Wappen festgelegt:
Die Luxemburger Farben (blau, silber) mit wachsendem gekrönten Löwen symbolisieren die Zugehörigkeit Heckenmünsters zum Herzogtum Luxemburg. Das schwarze Tatzenkreuz deutet auf den Kreuzherrenorden hin, der nach Volksmund und Literatur in Heckenmünster lange Zeit die Seelsorge ausgeübt haben soll. Darüber hinaus ist dieses Kreuz, das auf dem Altar der Kirche abgebildet ist, Symbol für Heckenmünster, einem vermutlich ehemaligen Wallfahrtsort zum Heiligen Kreuz. Die Pfarrei feiert als Kirchweihe jährlich das Fest der Kreuzerhöhung.
Schild gespalten, vorn in Grün silberner Rost, hinten in Silber zwei rote Pfähle.
Das Wappen wurde mit Gemeinderatsbeschluß vom 26. Oktober 1981 festgelegt.
Zwei rote Pfähle in Silber stellen das Wappen der Herren von Orley (Urley) dar. Wilhelm von Orley (Herr zu Beford) besaß zu Heidweiler Güter, die er im Jahre 1428 an das Stift St. Simeon verpfändet hat. Grün steht für Waldreichtum und Landwirtschaft. Der silberne Rost bezieht sich auf den Kirchenpatron St. Vinzenz, der laut Legende mit Rost dargestellt ist. Die Holzfigur des heiligen Vinzenz von Sarragossa in der Pfarrkirche zu Heidweiler, Anfang 16. Jahrhundert, zeigt St. Vinzenz mit dem Rost abgebildet.
Von Silber und Blau neunmal geteilter Schild, belegt mit einem roten Balkenkreuz, dies wiederum belegt mit einer silbernen Lilie.
Mit Genehmigung der Bezirksregierung Trier vom 13. Februar 1979 wurde für die Gemeinde Hetzerath das Wappen festgelegt.
Die Ortsgemeinde Hetzerath übernimmt aus Gründen der Tradition das Wappen der im Jahre 1970 in der Verwaltungsreform aufgelösten Verbandsgemeinde - früher Amt-Hetzerath, ausgenommen den blauen Schildbord.
Hetzerath war Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung, des früheren Amtes und der sog. Mairie aus napoleonischer Zeit. Die gegenwärtige Generation ist sich der Bedeutung des verlorenen Verwaltungssitzes sehr bewußt. Die Erinnerung daran ist für nachfolgende Generationen durch die Übernahme des Amts- bzw. Verbandsgemeindewappens zu erhalten. Für die Begründung des Wappens der Verbandsgemeinde ist nachzulesen:
„Die Landeshoheit übten ehedem das Kurfürstentum Trier (deshalb das rote Kreuz) und das Herzogtum Luxemburg (daher die neunmalige silbern-blaue Schildteilung des Luxemburger Wappens) aus.
Von besonderer kulturhistorischer Bedeutung ist die Wallfahrtskirche der schmerzhaften Mutter Gottes von Eberhards-Klausen, das Keverlaer des Trierer Landes, deshalb die Lilie, das Symbol der Mutter Gottes, die zusammen mit dem Schildbord die Marienfarben Blau-Silber zeigt.“
Von Grün und Silber geteilt. In Grün ein 12endiges, silbernes Hirschgeweih mit Grind, einschließend ein silbernes Kreuz, in Silber 2 schragenförmig gekreuzte blaue Rodehacken mit schwarzen Stielen.
Mit Genehmigung der Bezirksregierung Trier vom 27. Januar 1966 erhielt die Gemeinde Hupperath das Recht ein eigenes Wapppen zu führen.
Hirschgeweih mit Kreuz ist Attribut des hl. Hubertus, des Pfarrpatrons von Hupperath, dessen Name wahrscheinlich Hubertus zurückgeht. Die Rodehacken weisen auf die Endsilbe des Ortsnamens. Das Wappen ist also redend.
Gespalten von Silber und Gold durch eine eingebogene rote Spitze, darin ein silbernes, sechsspeichiges Rad; rechts ein durchgehendes rotes Kreuz, links ein roter Schrägrechtsbalken.
Mit der Genehmigung der Bezirksregierung vom 9. Juli 1985 erhielt die Ortsgemeinde Karl das Recht, ein eigenes Wappen zu führen.
Das Wappen wird wie oben beschrieben.
Das Wappen wurde nach mehrmaligen Beratungen mit dem Gemeinderat und Vertretern der Verbandsgemeindeverwaltung von Herrn Karl E. Becker aus Malberg entworfen und gestaltet. Ein heraldisches Gutachten des Landeshauptarchives Koblenz liegt hierzu vor. Der Gemeinderat Karl hat diesen Entwurf am 3. Juni 1985 einstimmig beschlossen.
In der weiteren Begründung heißt es:
Kurtrierer Kreuz und der rote Schrägrechtsbalken sind im Schlußstein des alten Kirchturmes von Karl ausgehauen. Sie sind im gevierten Schild, 1 und 3 Kurtrierer Kreuz, 2 und 4 Schrägrechtsbalken. Der Turm wurde also offenbar in der Regierungszeit des Kurfürsten Johann von Baden (1456 - 1503) erbaut, auf diese Zeit weist auch eine der Glocken in der Karler Kirche hin, die die Jahreszahl 1500 (MCCCCC) trägt.
Das Rad ist Hinweis auf die Landwirtschaft und die Bedeutung des Ortsnamens Karl = Karel. „Das Adjektiv vom kelto - lat. carros = Wagen, Karre, lautet carralis ... wobei via zu ergänzen bleibt. (M. Müller, ON, S. 61).
In Gold eine zur Kreuzblume erblühte blaue Lilie mit doppeltem grünen Fruchtknoten.
Der Gemeinderat von Klausen beschloß am 08. Mai 1980 das Gemeindewappen zu führen.
Die blaue Lilie stellt den Bezug her zur Marienverehrung; die Kreuzblume als Stilelement der Gotik, Symbol für unsere herrliche, weithinbekannte, spätgotische Hallenkirche. Der doppelte Fruchtknoten, Symbol für die beiden ehemaligen, zu einer Gemeinde zusammengeschlossenen Gemeinden Krames und Pohlbach.
Schild gespalten, vorne in Gold ein blauer Krummstab, hinten in Rot ein sechsspeichiges goldenes Rad.
Mit Genehmigung der Bezirksregierung Trier vom 5. Dezember 1980 erhielt die Gemeinde Landscheid das Recht, ein eigenes Wappen zu führen.
In gespaltenem Wappenschild, vorne in Gold der blaue Krummstab symbolisiert das Kirchenpatronat in Landscheid. Kirchenpatronin ist die Äbtissin St. Gertrud von Nivelle. Das sechsspeichige goldene Rad, im Wappenschild hinten in Rot, ist dem Wappen der ehemaligen selbstständigen Ortsgemeinde Niederkail entnommen, die sich ab 1.12.1975 freiwillig aufgelöst und mit den bis dahin ebenfalls selbstständigen ehemaligen Ortsgemeinden Landscheid und Burg/Salm zur Ortsgemeinde Landscheid zusammengeschlossen hat. Ambulanter Handel und Gewerbe, eine wesentliche Existenzgrundlage in früherer Zeit und auch heute noch, sowie die Landwirtschaft, werden durch das sechsspeichige goldene Rad symbolisiert.
Über goldenem Schildfuß mit rotem Sparrenbalken gespalten, vorn in blau ein silberner Kirchturm mit schwarzem Dach, hinten in Silber ein rotes Lilienkreuz.
In einer Urkunde Papst Eugens III, vom Jahre 1148 werden Ort und Kirche zu „Luofenvelt" dem Abt zu Echternach als Abteibesitz bestätigt (Wampach, Echternach I, 2, Nr. 205). Die Abtei Echternach führte ein Lilienkreuz, mit Schwurhand belegt. Das Lilienkreuz ist im zweiten Feld des Gemeindewappens aufgenommen.
Die Kirche in Laufeld war die einzige Pfarrkirche in der Grafschaft Manderscheid (Wackenroder, Kr. Wittlich, S. 190). „Der hohe Turm ist als verteidigungsfähiger Kirchturm von den Grafen von Manderscheid um 1500" erbaut. Wegen der Bedeutung des Turmes, und wegen der charakteristischen, nach oben verjüngten Bauform, ist er im ersten Feld wiedergegeben.
Vom 14. Jahrhundert bis zur Französischen Revolution gehörte Laufeld zur Grafschaft Manderscheid. Der Manderscheider Sparrenbalken, im Schildfuß wiedergegeben, deutet darauf hin.
lDas Landeshauptarchiv Koblenz hat mit Schreiben 2 Zi/270-Laufeld/VG Manderscheid, vom 8.2.1983 keine Bedenken gegen diesen Entwurf geäußert.
Der Ortsgemeinderat Laufeld hat in seiner letzten Sitzung vor dem 16.3.1983 beschlossen, diesen Entwurf anzunehmen und künftig als Gemeindewappen zu führen.
Roter geschobener Balken auf goldenem Feld mit der Grafenkrone.
Stammwappen des Hauses Manderscheid (Schannat-Bärsch).
Über blauem, durch Wellenschnitt geteilten Schildfuß schräglinks geteilt, vorn in Rot ein aufsteigendes silbernes Vortragekreuz, hinten in Silber ein rotes Schildchen.
Die Silbe „Meer" des Ortsnamens geht zurück auf das althochdeutsche „mari, meri" = Sumpf, Moor. Sie ist begründet durch das Meerfelder Maar. Es wird durch den unteren, im Wellenschnitt geteilten Schildteil symbolisiert.
Bis um 1800 gehört Meerfeld als Herrschaft Meerfeld zum Besitztum der Herren von Malberg in Herzogtum Luxemburg. Der Besitzer von Malberg war auch Inhaber der Herrschaft Meerfeld (Eiflia illustrata 3, 2, 2 S. 76 f). Zeichen der Malberger war das rote Schildchen in Silber (Gruber, S. 88f). Es ist im hinteren Schildteil aufgenommen.
Kirchen- und Ortspatron ist in Meerfeld seit altersher der hl. Johannes der Täufer. Sein Symbol, ein Vortragekreuz, ist im ersten Schildteil wiedergegeben.
Die Feldfarben Rot, Silber und Blau sind zugleich die Farben der früheren Luxemburger Landesherren.
Das Landeshauptarchiv Koblenz hat mit Schreiben 2 Zi/270-Meerfeld vom 21.4.1982 dem ausgeführten Entwurf den Vorzug gegeben.
Der Ortsgemeinderat Meerfeld hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, das vom Landehauptarchiv empfohlene Wappen anzunehmen und künftig als Gemeindewappen Meerfeld zu führen.
Im gespaltenen Schilde vorne in Silber ein rotes Balkenkreuz, belegt mit silberner Lilie, hinten in Silber mit blauem Obereck 2 rote Pfähle.
Mit Genehmigung der Bezirksregierung Trier vom 24. November 1966 erhielt die Gemeinde Minderlittgen das Recht, ein eigenes Wappen zu führen.
Minderlittgen gehörte zur Landesherrschaft des Kurfürstentums Trier, deshalb dessen Wappen: Rotes Balkenkreuz in Silber. Die Lilie ist Attribut der Muttergottes, der Pfarrpatronin von Minderlittgen. In Silber mit blauem Obereck 2 rote Pfähle ist das Wappen der Grafen von Runkel, die ehedem als Grundherren zu Minderlittgen die Mittel- und Grundgerichtsbarkeit ausübten.
Über grünem Boden in Silber ein roter Turm, beseitet von blauer Pflugschar und blauer Zange.
Von einem ehemaligen Wehrturm im Distrikt „Weiherchen" weiss der Volksmund noch heute zu berichten (vgl. auch Wackenroder Kdm. Kr. Wittlich). Er steht in den kurtrierischen Farben im Hauptteil des Schildes. Musweiler gehörte bis um 1800 unter kurtrierischer Landeshoheit den Grafen von Manderscheid-Blankenheim. Kirchen- und Ortspatron von Musweiler ist seit altersher die heilige Apollonia. Als Helferin bei Zahnkrankheiten angerufen, führt sie als Zeichen eine Zange.
Die auch heute noch landwirtschaftliche Struktur des Ortes wird durch die antike Pflugschar symbolisiert.
Dass Landeshauptarchiv Koblenz hat mit Schreiben vom 19. Mai 1983 Az.: 3 Krü/270-Musweiler mitgeteilt, daß gegen den Schildinhalt nichts einzuwenden sei.
Die Gemeinde Musweiler hat in der Sitzung vom 20. Oktober 1983 beschlossen, das ausgeführte Wappen anzunehmen und künftig als Gemeindewappen zu führen.
Durch eingeschweifte blaue Spitze, darin eine goldene Schale mit silberner Wasserfontäne, vorn in Silber das rote kurtrierische Kreuz, hinten in Silber eine rote Lilie.
Die Geschichte Niederöfflingens reicht zurück bis 785 und 797, als Karlmann die „villa ... Officinus" (Niederöfflingen) der Abtei Echternach schenkte. (Wampach, Echternach, I, 2, Nr. 112). Die Abtei Echternach führt als Symbol ein Glevenkreuz; dafür ist hier im zweiten Feld eine Lilie aufgenommen.
Bereits im Jahre 1179 verzichtet die Abtei Echternach auf ihren Besitz Niederöfflingen zugunsten des Erzbischofs von Trier. Damit war der Ort kurtrierisch. Als Hinweis hierauf steht im ersten Feld das Kurtrierer Kreuz.
Unmittelbar östlich des Ortes liegt der Edeltrudis-Brunnen. Vermutlich seit 1500 ist er Ziel vieler Pilger. Sie kommen an dem auf den 23. Juni folgenden Sonntag, um vom geweihten Wasser des Brunnens zu schöpfen. St. Edeltrudis ist auch Ortspatronin von Niederöfflingen. Dafür steht in der eingeschweiften Spitze das Brunnensymbol.
Das Landeshauptarchiv Koblenz hat mit Schreiben 2 Zi/270-Niederöfflingen, vom 09.04.1986 mitgeteilt, dass gegen den ausgeführten Entwurf keine Bedenken bestehen.
Der Gemeinderat Niederöfflingen hat am 20.03.1986 beschlossen; den ausgeführten Entwurf anzunehmen und künftig als Gemeindewappen zu führen.
Durch eingeschweifte rote Spitze, darin zwei silberne Hirschstangen, einschließend ein silbernes Kreuz, gespalten, vorn in Silber ein rotes Balkenkreuz, hinten in Gold ein schwarzer Krummstab.
Der Ort gehörte bis zum Ende der Feudalzeit zum Kurfürstentum Trier. Als Hinweis hierfür steht das kurtrierische Kreuz im ersten Feld des Schildes (Fabricius, S. 118 und 153 sowie Chronik der Verbandsgemeinde Manderscheid).
Der Ortsname „Scheidweiler" begegnet als "scelttvilere" im Güterverzeichnis der Abtei Prüm vom Jahre 893 (Beyer, Mrh. Ukb. I, Nr. 135, S. 158; Wackenroder, Kunstdenkmäler Kr. Wittlich, Düsseldorf 1934, S. 235 ff.).
Als Hinweis auf die Abtei Prüm steht im zweiten Feld der Krummstab des Abtes.
Die Kapelle und spätere Pfarrkirche führte bereits bei der Visitation 1569 den hl. Hubertus als Kirchen- und Ortspatron; sein Symbol steht in der eingeschweiften Spitze.
Das Landeshauptarchiv Koblenz hat mit Schreiben vom 05.06.1992, Az.: Z Hs/270-1941 Hs/270-1940, dem Entwurf zugestimmt.
Der Ortsgemeinderat Niederscheidweiler hat in seiner Sitzung vom 29. September 1992 beschlossen, den beiliegenden Entwurf anzunehmen und als Wappen der Ortsgemeinde Niederscheidweiler zu führen.
In Silber über grünem Wellenschildfuß eine blaue Töpferscheibe, beseitet von je einer roten Flamme, darüber ein blauer Topf.
Mit Beschluß vom 02. November 1982 entschied sich der Gemeinderat von Niersbach zur Führung des des Ortswappens.
Die Farben Rot und Silber erinnern an die Kurfürstliche Herrschaft Trier. Töpferscheibe und Tongefäß und rote Flammen gelten als Symbol des Töpferhandwerks, das seit frühester Zeit bis in unsere Tage in Niersbach betrieben wird. Der grüne Wellenschildfuß steht für Land- und Forstwirtschaft im Raume Niersbach-Greverath.
Von Rot über Silber geteilt, oben ein silbernes Glevenkreuz, unten drei rote Schrägrechtsbalken.
Der Ort wurde durch Karlmann dem Kloster Echternach geschenkt. Die Schenkung wurde durch Karl den Großen dem Kloster Echternach bestätigt (Wampach, Grundherrschaft Echternach I, 2, Luxemburg 1930, S. 180). Das Kloster Echternach führte als Symbol ein Gleven- (Lilien-) Kreuz. Es ist im oberen Feld wiedergegeben.
Im Landeshauptarchiv Koblenz ist ein Siegelabdruck des Henrich von Ufflingen von 1451 erhalten. Ufflingen ist die alte Bezeichnung für (Ober)Öfflingen. Es zeigt in Silber 3 rote Schrägrechtsbalken (Gruber, S. 132/133).
Das Landeshauptarchiv Koblenz hat mit Schreiben 3Krü/270-Oberöfflingen, vom 29. April 1982, zu dem ausgeführten Entwurf geraten.
Der Ortsgemeinderat Oberöfflingen hat in seiner Sitzung vom 18. August 1982 einstimmig beschlossen, den empfohlenen Entwurf anzunehmen und künftig als Gemeindewappen zu führen.
Durch eingeschweifte blaue Spitze, darin ein goldenes Posthorn mit goldener Kordel und 2 goldenen Quasten, gespalten, vorn in Silber ein rotes Balkenkreuz, hinten in Silber eine rote Lilie.
Während der Feudalzeit gehört der Ort im Gericht Strohn zum Amt Daun im Kurfürstentum Trier. Als Hinweis hierauf steht im ersten Feld das Kurtrierer Kreuz. (Fabricius, S. 113).
Im Jahre 1193 erscheint der Ort als Scheitwilre, als für die Abtei Springiersbach eine Bestätigungsurkunde durch Kaiser Heinrich IV ausgestellt wird. (Beyer Mrh. Ukb. II, Nr. 129 u. KD Kr. Wittlich, S. 237). Darauf weist die aufgenommene Springiersbacher Lilie hin.
„Das Dorf Oberscheidweiler lag an der alten, historischen Poststraße von Trier nach Koblenz und wurde nachweislich 1840 von der damals zuständigen Unternehmung Thurn und Taxis angefahren (Mitt. d. Verb.-Gem.-Verwaltung Manderscheid). Die alte Posttradition ist durch ein goldenes Posthorn symbolisiert.
Das Landeshauptarchiv Koblenz hat mit Schreiben Z Hs/270-1940 vom 25.06. 1992 dem Wappenbild in der ausgeführten Form zugestimmt.
Der Ortsgemeinderat Oberscheidweiler hat in seiner Sitzung vom 24. November 1992 die ausgeführte Wappenform beschlossen und will sie künftig als Gemeindewappen Oberscheidweiler führen.
Schild gespalten, hinten geteilt, vorne in Silber ein rotes Balkenkreuz, hinten in Gold ein roter Zickzackbalken, unten in Grün goldene Traube mit Blatt neben zwei goldenen Ähren.
Mit Genehmigung der Bezirksregierung vom 13. März 1972 erhielt die Gemeinde Osann-Monzel das Recht, ein eigenes Wappen zuführen.
Die vordere Schildhälfte deutet auf die ehemalige Zugehörigkeit zu Kurtrier. In der hinteren Schildhälfte verweist der Zickzackbalken auf die frühere Grundherrschaft und mittlere Gerichtsbarkeit der Grafen von Manderscheid-Blankenheim, Weintraube und Ähre sind Hinweis auf Weinbau und Landwirtschaft.
Schild gespalten, vorne in Gold ein halber geschobener roter-Balken, darüber eine rote Flamme. Hinten in Blau eine silberne Burgruine, darunter ein halber siIberner Wellenbalken.
Die vordere SchiIdhälfte ist in der Hauptsache das Wappen von Manderscheid. Die rote Flamme (Geistflamme) ist Attribut der heiIigen Brigida, der Patronin Pantenburgs.
Die hintere Hälfte erinnert durch das Symbol der Niederburg an die ehemalige Zugehörigkeit zur Grafschaft. Der Wellenbalken stellt den Lieserbach dar, der an der Burg vorbeifließt.
Das Landeshauptarchiv Koblenz hat mit Schreiben 2 Zi/270-Pantenburg vom 29.09.1983 keine Bedenken gegen diesen Entwurf geäußert.
Der Ortsgemeinderat Pantenburg hat in seiner Sitzung vom 25.11.1983 beschlossen, diesen Entwurf anzunehmen und künftig als Gemeindewappen zu führen.
Im silbernen Schildhaupt ein rotes Balkenkreuz, darunter in Blau ein silberner Schrägbalken, belegt mit 3 goldenbesamten, fünfblättrigen, roten Rosen. In Blau oben ein silberner Forsthaken.
Mit Genehmigung der Bezirksregierung Trier vom 30.09.1965 erhielt die Gemeinde Platten das Recht, ein eigenes Wappen zu führen.
Das rote Kreuz im silbernen Schildhaupt weist auf die ehemalige Landesherrschaft, Kurfürstentum Trier. Silbernes Ankerkreuz auf Hermelingrund war das Wappen des adeligen Geschlecht der Plait oder Platten, die in Platten ihr Stammhaus hatten und zuletzt wegen ihrer Besitzungen in Longuich den Namen Plait von Longuich führten und deren Mannesstamm zu Ende des 16.Jh. mit Gerhard Plait von Longuich erlosch. Für die Gemeinde Platten wurde das Ankerkreuz auf Gegenhermelingrund gesetzt.
Unter silbernem Schildhaupt mit drei schwarzen Muscheln (2/1) steht in rotem Feld das silberne Pleiner Viadukt mit 4 Pfeilern über einer von links nach rechts sich windenden goldenen Schlange.
Mit Genehmigung der Bezirksregierung Trier vom 9. Februar 1978 erhielt die Gemeinde Plein das Recht, ein eigenes Wappen zu führen.
Silber und Rot sind die alten Wappenfarben von Kur-Trier, zu dessen Herrschaftsbereich Plein früher gehörte. Die schwarzen Pilgermuscheln erinnern an das in der 2ten Hälfte 17ten Jahrhunderts untergegangene Dorf Ankast im Liesertal, dessen Gebiet und Kirchenpatronat auf Plein übergingen. Sie entstammen dem Hauswappen der Familie von Wolff-Metternich an dem 1702 gestifteten Kirchenportal von Ankes und sind das Kennzeichen des Pilgerschutzheiligen und Kirchenpatrons von Ankes und Plein: St. Jakobus.
Der im Mittelalter bekannte Pilgerpfad aus der Eifel über Klausen, Trier - St.Matthias nach Santiago di Comostela in Nord-Spanien führte durch Plein und Ankes.
Das Pleiner Viadukt ist die Plein kennzeichnende Verkehrsverbindung der Neuzeit, die 1945 zerstört und nach dem Kriege wieder aufgebaut wurde.
Die sich windende, häutende Schlange ist wiederum von dem Kirchenportal des sagenumwobenen Ankes entlehnt. Sie ist von altersher ein Sinnbild wiederkehrender Verjüngung, das in die Zukunft weist.
Das Gemeindewappen Plein erfaßt in der Aussage seiner Bestandteile nicht einfach Symbole aus der Ortsgeschichte, sondern gibt einen vorwärts weisenden Hinweis auf die Stetigkeit lebendiger Entwicklung aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft.
Schild schräglinks stufenförmig geteilt, vorne in Silber ein roter Drache, hinten in Rot drei goldene Ähren.
Mit Genehmigung der Bezirksregierung vom 08. September 1975 erhielt die Gemeinde Rivenich das Recht das Wappen zu führen.
Laut Urkunde vom 30.12.1704 wurde von Hugo Ernst Graf Cratz von Scharfenstein dem Freiherren Karl Kaspar von Kesselstatt, Probst des Domstiftes St. Paulin zu Trier und Statthalter daselbst, all sein Recht am Dorf Rivenich und Erlenbach geschenkt. Durch Schräglinksteilung des Wappenschildes ist im oberen Teil mit Genehmigung der Familie von Kesselstatt das Wappen der früheren Freiherren und späteren Reichsgrafen von Kesselstatt dargestellt. Die stufenförmige Schräglinksteilung des Schildes symbolisiert den Sparrenbalken der Grafen von Manderscheid. Rivenich gehörte zum manderscheidich-bruch`schen Hochgericht von 1764. Die goldenen Ähren in rotem Feld beziehen sich auf den heiligen Brictius, den Pfarrpatron von Rivenich. Im Siegel des gemeinsamen manderscheidisch-bruch`schen Hochgerichts vom 24. Februar 1765 ist der heilige Brictius als Pfarrpatron von Rivenich mit den ihn aus der Legende charakterisierenden drei Ähren dargestellt.
Unter goldenem Schildhaupt, darin ein wachsender roter, silberbewehrter Löwe, gespaltener Schild, vorne in Silber ein blauer Anker, hinten Eisenhutfeh in Silber.
Mit Genehmigung der Bezirksregierung Trier vom 3. Januar 1980 erhielt die Gemeinde Salmtal das Recht, ein eigenes Wappen zu führen.
Der Ortsteil Salmrohr und ein Teil des Ortsteils Dörbach gehörten ehedem zur Herrschaft der Ritter von Esch. Das Wappen des Ritters Konrad von Esch, 1330, (Unter goldenem Schildhaupt mit Löwen, Grauwerk-Eisenhutfeh) ist vorne ersetzt durch einen blauen Anker, entnommen aus dem Abtswappen Jacobus Otto von Trier, das auf offenem Giebel der Dörbacher Mühle, früher Gutshof Mühle des ehem. Augustiner Chorherren-Klosters Klausen abgebildet ist.
Gespalten von Gold und Silber durch eine eingebogene blaue Spitze, darin zwei gekreuzte goldene Kerzen, vorne ein roter Sparrenbalken, hinten eine schwarze Lilie.
Seit altersher ist Kirchen- und Ortspatron von Schladt der hl. Blasius. Sein Attribut sind zwei gekreuzte Kerzen, die in der eingebogenen Spitze stehen.
Bis zum Ende der Feudalzeit war Schladt Besitz der Grafen von Manderscheid. Ihr Zeichen war der rote Sparrenbalken in Gold, der im ersten Feld des Schildes aufgenommen ist.
Zuvor hatte Schladt bis um die Mitte des 14. Jahrhunderts zur Abtei Echternach gehört. Ihr Symbol, die Lilie, steht im zweiten Schildteil.
Das Landeshauptarchiv Koblenz hat mit Schreiben 2 zi/270-Schladt, vom 24. März 1986 zwar einen anderen Entwurf favorisiert, jedoch gegen den ausgeführten keine Bedenken erhoben.
Der Ortsgemeinderat Schladt hat am 02. Mai 1986 beschlossen, das ausgeführte Wappen anzunehmen und künftig als Gemeindewappen zu führen.
Geviert:
1. in Gold ein schwarzer Brunnen,
2. in Blau eine silberne Maischegabel,
3. in Rot ein silberner Dreschflegel, beide schräglinks,
4. in Gold ein roter Sparrenbalken.
Über grünem Schildfuß, darin zwei silberne Leisten, in Silber ein rotes Balkenkreuz, belegt mit grünem sechsspeichigem Rad.
Mit Genehmigung der Bezirksregierung Trier vom 15. April 1982 erhielt die Gemeinde Sehlem das Recht, ein eigenes Wappen zu führen.
Grüner Schildfuß symbolisiert die Landwirtschaft, die in starkem Maße den Ort und vorwiegend seine Umgebung prägt (Wald, Wiesen und Felder).
Ebenso steht er als Zeichen für die fränkische Siedlung zwischen dem 6. - 8. Jahrhundert im Sumpf- und Wiesengelände des Salmbaches.
Die Landeshoheit übten die Kurfürsten von Trier zwischen 1578 und 1794 aus, weshalb das rote Kreuz (Kreuzungssymbol) in Silber dem grünen Rad als Symbol des Kirchenpatrons St. Georg unterlegt ist (Marterrad). Sehlem wird als Pfarrort bereits 1295 erwähnt.
Durch eingeschweifte rote Spitze, darin ein goldenes Horn, gespalten, vorn in Silber eine rote Lilie, hinten in Gold ein roter Zickzackbalken.
Die Pfarrei Laufeld, zu der Wallscheid seit jeher gehört, war durch ihre Verbindung mit Echternach bis zum Ende des 18. Jh. an der Teilnahme der Springprozession verpflichtet. An diese alte Zugehörigkeit erinnert die rote Lilie im ersten Feld des Gemeindewappens.
Wallscheid gehörte bis 1593 zum Besitz der Grafen von Manderscheid-Schleiden. Bei der Erbteilung 1593/1615 kam der Ort zur Gräfin Magdalena; deren Tochter Graf Dietrich von Manderscheid-Kail heiratete. Die Linie stirbt 1742 aus (Fabricius, S. 43). An die Zugehörigkeit erinnert im zweiten Feld des Wappens der rote Manderscheider Sparrenbalken in goldenem Feld.
Kirchen- und Ortspatron von Wallscheid ist seit altersher der hl. Cornelius. Sein Symbol ist ein Horn, das in der eingeschweiften Spitze wiedergegeben ist.
Das Landeshauptarchiv Koblenz hat mit Schreiben 2 Zi/270-Wallscheid vom 09.04.1986 gegen den ausgeführten Entwurf keine Bedenken erhoben.
Der Gemeinderat Wallscheid hat in seiner Sitzung vom 14.04.86 die Einführung des ausgeführten Wappenentwurfs und seine Führung als Gemeindewappen beschlossen.