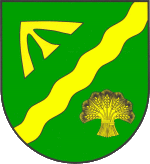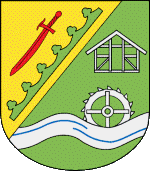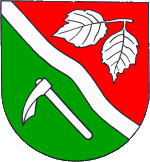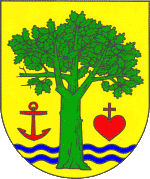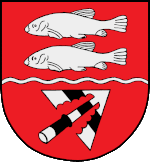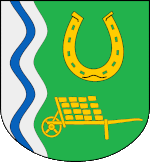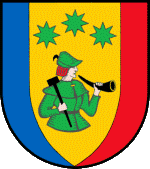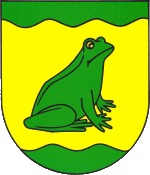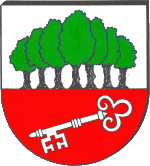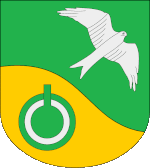In Grün ein schräglinker goldener Wellenbalken zwischen einem goldenen Pfeileisen mit der Spitze zum rechten Obereck oben und einer aus sieben Ähren bestehenden goldenen Garbe.
Die Gemeinde Grinau verbindet in ihrem Wappen Motive der Naturlandschaft, die gleichzeitig zum Ortsnamen Bezug haben, mit solchen aus der Geschichte und der Wirtschaftsstruktur. Als ältester Besitzer des Dorfes ist die Adelsfamilie Krummesse belegt, deren Wappenzeichen ein "Strahl", d.h. ein Pfeileisen gewesen ist. Der Wellenbalken bezieht sich auf die Grinau, einen kleinen Wasserlauf, der westlich des Ortes die Grenze zwischen Holstein und Lauenburg bildet und in die Stecknitz mündet. Schließlich bezeugen die Ähren die Vergangenheit des Ortes als Bauerndorf, dessen Wirtschaftsstruktur bis heute durch die Landwirtschaft bestimmt wird. Auch die Farben des Wappens verweisen daher auf die grünen Wiesen und die goldgelben Felder. Die schwere Qualität des Bodens im Gemeindegebiet bot und bietet gute Voraussetzungen für den Getreideanbau, die sogar den Anbau von Weizen erlauben.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Gold und Grün, leicht versetzt zum rechten Schräghaupt, schräglinks geteilt. Rechts entlang der Schildspaltung ein schwebender mit fünf Kleeblättern besetzter grüner Schrägbalken, darüber ein roter Säbel, links unter einem silbernen Ständerwerkhaus ein silbernes Mühlrad, unten überdeckt von einem silbernen Wellenbalken.
Ein Ort an der Stelle des heutigen Groß Boden, im Besitz der Askanier Ratzeburg-Lauenburger Linie, wurde erstmals urkundlich im Jahr 1310 als Riekenhagen erwähnt. Unter der Bezeichnung Boden entstand er auf dem Gebiet des wüst gefallenen Ortes und Kirchspiels Schönenborn neu. Der Ortsname Boden wurde gebildet aus "Bude", Wohnhaus der kleinen Leute wie Handwerken und Arbeiter auf dem Lande. Der Name erscheint 1649 nach dem ersten Bauernvogt "Boden Tim" (Tim Bubert). Bei Groß Boden fand im Dezember 1813 ein Gefecht zwischen Franzosen und Dänen einerseits, sowie der Allianz andererseits statt. Auch im deutsch-dänischen Krieg von 1864 fanden hier Gefechte statt. Die Bodener Wassermühle wurde im Jahre 1312 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Es war eine Amtsmühle des Amtes Steinhorst und hatte daher eine überörtliche Bedeutung. In dieser Mühle, wo früher Korn gemahlen wurde, rotierte noch bis 1965 eine Turbine zur Stromerzeugung. Mit der Darstellung der Askanier, einen mit Kleeblättern besetzten grünen Schrägbalken, ein kleines Ständerwerkhaus für den Ortsnamen, ein Wasserrad für die Amtsmühle und einen Säbel für die Gefechte in Boden werden die Hauptmerkmale des Dorfes wiedergegeben.
Von Rot und Grün durch einen schrägrechten silbernen Wellenbalken geteilt, oben zwei durch einen gemeinsamen Stiel verbundene Laubblätter, unten eine schrägrechte auswärts gerichtete silberne Feldhacke.
Die Gemeinde Groß Schenkenberg besteht aus zwei Ortsteilen, Groß Schenkenberg und Rothenhausen. Hiermit wird die gewählte Schildteilung begründet. Der Wellenbalken verweist auf die Grinau (Bach), der durch die Gemarkung der Gemeinde fließt. Die beiden Laubblätter stehen für den Wald der Gemeinde, der rote Schildgrund verweist auf die rege Bautätigkeit und Entwicklung der Gemeinde hin. Das Arbeitsgerät, die Feldhacke, ist Symbol für den Ackerbau, der grüne Hintergrund erinnert an die Weide- und Wiesenflächen als Voraussetzung für die Viehwirtschaft der Gemeinde.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Silber eine eingebogene grüne Spitze, vorn ein grünes dreiblättriges Kleeblatt, hinten ein grünes Wagenrad, unten ein goldener Baumstumpf.
Der Baumstumpf im Wappen soll den Namensteil "Rodung" (Rade) symbolisieren. Das Kleeblatt ist ein Hinweis darauf, dass der Anbau von Futterklee eine Haupteinnahmequelle war. Das Wagenrad deutet auf Klinkrade als mittelalterlichem Verkehrsknotenpunt hin. Es trafen die Wege Hamburg-Lübeck, sowie die Salzstr. nach Lüneburg aufeinander. U.a. wurden in unserem Dorf Vorspannpferde bereitgehalten, um die schweren Fuhrwerke die Hügel hinaufzuziehen. Eine ebenfalls sehr lukrative Einnahmequelle.
In Grün über einem gesenkten goldenen Wellenbalken ein Storch in natürlichen Farben, mit erhobenem rechten Ständer, begleitet oben von einer goldenen Ähre und einem goldenen Eichenblatt.
Der Wellenbalken symbolisiert die Bille, die Ähre die Landwirtschaft. Das Eichenblatt steht für die Wälder der Umgebung. Der Storch erinnert daran, dass bis vor wenigen Jahren noch zahlreiche Störche in Koberg brüteten.
In Gold ein grüner Eichbaum mit abgebrochenem Ast auf der rechten Seite, der unten zwei blaue Wellenbalken überdeckt. Rechts des Stammes ein roter Anker, links ein rotes Herz, aus dem ein rotes Kreuz wächst.
Das Wappen zeigt die bekannte Storcheneiche aus dem Lankauer Gemeindewald. Sie gilt mit ihren geschätzten 600 Jahren als eine der ältesten Eichen Deutschlands. Das Herz mit dem Kreuz ist das Wahrzeichen der heiligen Birgitta von Schweden. Der von ihr gegründete Birgittenorden erbaute in der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts in Marienwohlde ein Kloster mit Kirche. Der Anker weist hier auf den Elbe-Lübeck-Kanal hin, der die gesamte Westflanke des Gemeindegebiets bildet. Die blauen Wellenbalken stehen für den großen und kleinen Lankauer See.
In Rot eine silberne Wellenleiste, begleitet oben von zwei übereinander gestellten silbernen Schleien, unten von einer schräglinks gestellten, viermal von Silber und Schwarz geteilten Pfeilspitze (Strahl).
Übersetzt bedeutet das altpolabische Wort "Linov" soviel wie "Ort, an dem es Schleie gibt". Durch die Fische in der oberen Hälfte stellt sich das Wappen der Gemeinde Linau als "redend" dar. Die Gemeinde liegt im Quellgebiet der Bille, welche durch die Wellenleiste repräsentiert wird. "Lynowe" war im Mittelalter Stammsitz der wegen ihrer räuberischen Unternehmungen gegen Lübecker und Hamburger Kaufleute berüchtigten Adelsfamilie von Scharpenberg, die im Wappen ein Pfeileisen, einen sogenannten "Strahl", führte. Die bereits im 13. Jh. stark befestigte Burg bildete die Ausgangsbasis für die Scharpenbergschen Raubzüge. Nach dem 1291 geschlossenen Landfriedensvertrag zwischen den Hansestädten und den Herzögen von Lauenburg wurde die Burg Linau niedergerissen. Für den Wiederaufbau der Burganlage brauchten die Scharpenberg nur eine kurze Zeit; mehrere Jahrzehnte noch konnten sie von hier aus ihre Überfälle ungehindert weiterführen. 1349 belagerten Herzog Erich, die Grafen von Holstein und eine starke Mannschaft aus Hamburg und Lübeck die Burg. Nach dreiwöchiger Belagerung wurde sie erobert und zerstört. Diese Maßnahme beendete das Raubrittertum der Scharpenberg. 1471 verkaufte Volrad von Scharpenberg endgültig das Schloß und das gleichnamige Dorf an Herzog Johann von Lauenburg. Die Tinktur des Wappens übernimmt die des Lauenburger Kreiswappens. Ebenso folgt die schwarz-silberne Teilung des "Strahls" mehr der "Stückung" des Bordes dieses Wappens als den strukturierten historischen Siegeldarstellungen des Adelswappens.
Das Wappen wurde am 21.5.1981 genehmigt.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Grün eine silberne rechte Wellenflanke mit blauem Wellenpfahl. Links über einen goldenen Torfkarren ein goldenes Hufeisen mit nach oben gekehrtem Stollen.
Lüchow ist von der Landwirtschaft geprägt, doch der Strukturwandel hat dafür gesorgt, dass es heute nur noch sechs bewirtschaftete Höfe gibt. Große Moorflächen am Ostrand der Gemeinde Lüchow, das Duvenseer und Klinkrader Moor wurde schon sehr früh zur Gewinnung von Brennmaterial genutzt. Immer wieder kam es zu Streitigkeiten zwischen den Lüchower und Duvenseer Bauern, die sich über die Abgrenzung der Weidegebiete nicht einigen konnten. Regelmäßige Überschwemmungen der Lüchower Wiesen brachten weitere Unstimmigkeiten. Die zahlreichen Rinnsale im Moorgebiet erhielten ein gemeinsames Bett, den Grenzgraben, der dann durch gemeinsames Aufräumen immer genügende Breite und Tiefe behielt. Mit der Darstellung von Torfkarre und Hufeisen für die Landwirtschaft und der Wellenschnitt für den so wichtigen Grenzgraben werden Hauptmerkmale des Dorfes ausreichend wiedergegeben.
Das Wappen wurde am 30.11.2010 genehmigt. Entwurfsverfasser war Wolfgang Bentin, Kastorf.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Blau und Rot gespalten durch eine schildförmige, gestürzte goldene Spitze, darin unter drei 1 : 2 gestellten, achtstrahligen grünen Sternen ein linksgewendeter, grün gekleideter halber Hirte, der in der Linken ein schwarzes Horn, in der Rechten einen schwarzen Holzhammer hält.
Das Gemeindewappen verdankt seine Benennung der hier befindlichen Kupfermühle, auch als „Kupferhammer“ bezeichnet. Der Hammer in der Hand des Hirten setzt den Namen dieses Gemeindeteils einleuchtend ins Bild. Da die herkömmliche Lebensgrundlage der Einwohner in den drei Orten neben der Feld auch die Viehwirtschaft war, steht der Hirte als Symbol für die Vergangenheit im Wappen. Das Hüten der Tiere auf der gemeinen Weide war in früherer Zeit in den Dörfern eine wichtige Aufgabe. Das Horn gab das tägliche Signal zum Aufbruch aus den Ställen. Teilung und Farbgebung des Schildes greifen die Farben Mecklenburgs auf. Die drei Dörfer waren bis zur Teilung Deutschlands Exklaven Mecklenburgs im Kreis Herzogtum Lauenburg. Daran erinnert die Tinktur.
In Grün ein breiter goldener Wellenbalken, belegt mit einem linksgewendeten, sitzenden grünen Frosch in Seitenansicht.
Das heraldische Wahrzeichen der Gemeinde Poggensee nimmt Bezug auf den Ortsnamen. Der Wellenbalken, gewöhnlich heraldische Figur für ein fließendes Gewässer, ist durch seine abweichende, auffällig verbreiterte Gestalt bildlicher Ausdruck für den zweiten Bestandteil des Ortsnamens, den See. Der Frosch, niederdeutsch "Poch" oder "Pogge", gibt den ersten Namensbestandteil wieder. Durch die Wahl der ausschließlich auf den Gemeindenamen bezogenen Figuren erweist sich das Wahrzeichen der Gemeinde Poggensee als Musterbeispiel eines "redenden" Wappens. Poggensee gehörte bis 1937 zum Lübecker Staatsgebiet, war also eine lübeckische Exklave im preußischen Herzogtum Lauenburg.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Unter silbernem Schildhaupt, darin ein vierlätziger roter Turnierkragen, in Blau eine schwebende silberne Burg mit drei Zinnentürmen und offenem Tor.
Das Wappen der Gemeinde Ritzerau entstand 1990, aus Anlaß des 750-jährigen Jubiläums der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes. Bereits 1240 bezeugt eine Urkunde sowohl eine Adelsfamilie von Ritzerau (Ritzerowe) als auch eine Wassermühle in dem gleichnamigen Ort. Die Familie Ritzerau war eines der mächtigsten und bedeutendsten Adelsgeschlechter im Herzogtum Lauenburg. Ihr Wappenzeichen waren zwei übereinander gestellte Turnierkragen. Um 1590 starb die Familie aus. Ihren Besitz, darunter die stark befestigte Burg und das gleichnamige Dorf, übernahm die Stadt Lübeck, in Konkurrenz zum Herzog von Lauenburg. Das alte Burggebäude wurde 1634 abgebrochen, das an seiner Stelle zum Schutz Lübecks erbaute festungsartige Schloß im 19. Jh. beseitigt. Die Figuren des Wahrzeichens von Ritzerau, der Turnierkragen des Familienwappens und die "idealtypische" mittelalterliche Burg, sind wie kaum ein Zeichen geeignet, die lange und bewegte Geschichte des Ortes im Spannungsfeld zwischen Adel, Hansestadt und Landesfürst vor Augen zu führen.
Von Gold und Schwarz durch einen blau-silbernen Wellenbalken geteilt. Oben drei grüne Bäume, unten ein goldenes Posthorn.
Der Ortsname von Schönberg (vormals Schonenberch) leitet sich von der durch die Gemeinde fließenden Au, der Schönau, ab: "Schön" heißt in diesem Zusammenhang "klar" und "rein" - sie wird durch den blauen Wellenbalken im Wappen symbolisiert. Das heutige Schönberg ist eine Neugründung des 16. Jahrhunderts - wahrscheinlich als adlige Hofstelle - zur Zeit der Regentschaft der Askanier als Herzöge von Sachsen-Lauenburg in der Gemarkung eines im 14.Jh. eingegangenen Vorgängerortes gleichen Namens. Die Landesfarben "Schwarz über Gold" der von 1296 bis 1689 regierenden Askanier wurden in umgekehrter Folge für den Wappenentwurf übernommen. Die ehemals urbaren Flächen der wüstgefallenen Vorgängersiedlung waren in der Zwischenzeit wieder vom Buchenmischwald überwachsen worden und mussten durch Rodung dem Wald wieder abgerungen werden. Der Schönberger Wald prägt bis heute das Bild der Landschaft, hierfür stehen im Wappenentwurf die drei Laubbäume. Das Gelingen der Neugründung von Schönberg hatte, neben der Wasser- und Holzversorgung zum Bauen und Heizen, einen weiteren besonderen Gunstfaktor; alle werden heute als "Infrastruktur" bezeichnet: Durch die in Verbindung mit der aufkommenden Vermessung und Kartierung der Herzogtümer ab dem 16./17. Jahrhundert gewonnenen Erkenntnisse über die tatsächliche Lage der Orte zueinander wurde der Verlauf der alten Heerstraße von Lübeck nach Hamburg verlegt: Anstelle über Kastorf, Siebenbäumen, Steinhorst, Stubben nach Eichede weiter in Richtung Hamburg zu führen, wurde die Streckenführung von Kastorf kommend über Labenz, Sandesneben nach Schönberg geführt, um zum benachbarten Dwerkaten die Landesgrenze nach Holstein/Stormarn zu passieren. Die ursprünglich militärisch genutzte Heerstraße hatte sich zur wirtschaftlich genutzten Poststraße gewandelt, an derem lauenburgischen Ende in Schönberg im Jahr 1666 eine Poststation gegründet wurde. Anfang des 18.Jahrhunderts war die Poststrecke von der Landesgrenze bei Schönberg bis zur Landesgrenze bei Kastorf in 4,70m-Breite vollständig gepflastert. Schönberg entwickelte sich damit zur bedeutensten Poststation auf der Strecke zwischen Hamburg und Lübeck im Herzogtum Sachsen-Lauenburg: Hier war Endstation der Hamburger Post auf dem Weg nach Lübeck bzw. Endstation für die Lübecker Post auf dem Weg nach Hamburg; hier wurden vor der Weiterfahrt die Pferde gewechselt und proviantiert oder gegebenenfalls Quartier genommen sowie das Wegegeld entrichtet. Erst als gegen Ende des 18.Jh. die Königlich Dänische Post die Landstraße über Bad Oldesloe als Verbindung zwischen Hamburg und Lübeck vorzog, verlor die Verbindung über Schönberg an Bedeutung. Das noch heute bestehende, klassizistische, ehemalige Posthaus stammt aus dieser letzten Phase. Die Lage an der Poststraße zwischen Lübeck und Hamburg und die Bedeutung für die Gemeinde Schönberg wird im vorliegenden Wappenentwurf durch das goldene Posthorn in der unteren schwarzen Wappenhälfte sowie durch den silbernen Wellenbalken dargestellt. Schönberg blühte dennoch auf: Durch die Verkoppelung der Fluren in Schönberg Ende des 18. Jahrhunderts wuchs die Anzahl der Herdstellen (ungefähr gleichbedeutend mit Haushalten, nicht Hofstellen) in Schönberg und Franzdorf von 35 auf 55 Herdstellen an; zusätzlich wurden neue Hofstellen, sogenannte "Anbauerstellen" geschaffen. Schönberg ist heute mit über 1.300 Einwohnern, neben Sandesneben, Linau und Nusse, eine der größten Gemeinden im Amt Sandesneben-Nusse; es ist noch heute, wenn auch stark zurückgehend, von Landwirtschaft geprägt; ferner von produzierendem Gewerbe, kleineren und mittleren Handwerksbetrieben sowie kleinerem Einzelhandel. Ortsteil Franzdorf Franzdorf wurde ebenfalls in der Gemarkung der im Mittelalter wüstgefallenen Dörfer Schonenberch und Nannendorp zu Beginn des 16. Jahrhunderts wahrscheinlich parallel zur Neugründung von Schönberg als Schönhörn gegründet und gegen Mitte des 16.Jh., zu Ehren des Landesherrn Herzog Franz I. oder Franz II. von Sachsen-Lauenburg, in Franzdorf umbenannt. Schönberg und Franzdorf bildeten zusammen die Vogtei Schönberg; Franzdorf gehörte bis 1814 zu Schönberg und war von 1814 bis 1938 eigenständige Gemeinde bis es in Verbindung mit dem Groß-Hamburg-Gesetz wieder nach Schönberg eingemeindet worden ist.
Von Silber und Rot geteilt. Oben nebeneinander sieben Laubbäume mit schwarzen Stämmen, deren grüne Kronen zur Mitte ansteigend ineinandergreifen; unten ein schrägliegender silberner Schlüssel mit dem Bart unten rechts.
Das Wappen der Gemeinde Siebenbäumen nimmt mit der Baumgruppe im oberen Feld Bezug auf den Ortsnamen und ist in diesem Sinne "redend" gemeint. Der Schlüssel weist auf die Tradition Siebenbäumens als Kirchort hin. Die Kirche war allerdings nicht dem heiligen Petrus, sondern der Gottesmutter Maria geweiht, was das Kreuz im Schlüsselbart andeuten soll. Zudem kann die Dreipaßform des Schlüsselgriffs als möglicher Hinweis auf die Dreifaltigkeit gewertet werden. Als Attribut des ältesten, wohl immer schon verschließbaren Gebäudes am Ort vertritt der Kirchenschlüssel nicht nur dieses und die kirchliche Tradition, sondern öffnet zugleich das Tor zur gesamten Vergangenheit der Gemeinde. 1359 verpfändeten die Herzöge von Sachsen-Lauenburg Stadt und Vogtei Mölln, zu der auch das Dorf Siebenbäumen gehörte, an die Stadt Lübeck. Hierauf sowie auf die Zugehörigkeit eines Teils des Ortes zu Lübeck von 1401 bis 1747 bezieht sich die Tingierung des Wappenschildes in den Lübecker Farben.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Grün und Gold im abgerundeten Schrägstufenschnitt geteilt. Oben ein auffliegender silberner Rot-Milan, unten eine grün-silber-grüne Scheibe, die innere Scheibe oben mit einem ins goldene Feld reichenden grünen Pfahl versehen.
Wie die frühgeschichtlichen Gräber auf dem Gelände des heutigen Kieswerkes belegen, war das jetzige Dorfgebiet schon lange von Christi Geburt bewohnt. Um 800 n. Chr. errichteten die Bewohner den in den Geschichtsbüchern erwähnten Sirksfelder Wallberg zur Verstärkung des "Limes Saxoniae". Die Burganlage Wallberg, auch Sirksfelder Schanze genannt, ist einslawischer Ringwall mit einem nördlichen Zugang. Mit etwa einhundert Metern Durchmesser liegt dieses archäologische Denkmal etwa einen Kilometer südlich des Ortes. Seit vielen Jahren leben zwei Brutpaare des Rot-Milans, einer der schönsten einheimischen Greifvögel, in der Gemarkung von Sirksfelde. In Jahre 2002 wurde der Rote Milan in die Vorwarnliste der neuen Roten Liste gefährdeter Brutvögel in Deutschland aufgenommen. Die Sirksfelderinnen und Sirksfelder sind stolz darauf, diesen seltenen Greifvogel täglich in ihrer Gemeinde beobachten zu können. Mit der Darstellung von "Wallberg" und dem "Roten Milan" werden die Merkmale des Ortes deutlich wiedergegeben.
Das Wappen wurde am 24.3.2011 genehmigt. Entwurfsverfasser war Wolfgang Bentin, Kastorf.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Silber ein golden bewehrter, golden bekrönter halber roter Löwe.
Die Figur des bekrönten halben Löwen im Wappen der 1928 aus dem gleichnamigen Gutsbezirk hervorgegangenen Gemeinde Steinhorst ist dem Wappen der Familie von Wedderkop entnommen, deren erster adliger Vertreter, der herzoglich-gottorfische Minister Magnus von Wedderkop, das landesherrliche Gut Steinhorst gegen Ende des 17. Jh. käuflich erwarb. Dessen Sohn Gottfried ließ 1722 das Herrenhaus Steinhorst, auch heute noch das bedeutendste Bauwerk des Ortes, erbauen, das die Verbindung Steinhorsts mit der Familie von Wedderkop über die Zeiten hin dokumentiert. Steinhorst war im 18. und 19. Jh. Verwaltungssitz des gleichnamigen Amtes. Die abweichenden Farben (Rot auf Silber statt Rot auf Gold im Wedderkopschen Wappen) betonen die Eigenständigkeit des neuen Gemeindewappens gegenüber dem alten Familienwappen.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Grün und Gold durch einen gold-blauen Wellenbalken geteilt. Oben drei fächerförmig gestellte silberne Ähren, unten ein grüner Baumstumpf.
Ende 2013 lobte die Gemeindevertretung einen Wettbewerb für das schönste Wappen aus.
Alle Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Stubben - egal ob alt oder jung, Mann oder Frau oder gleich welcher Herkunft - waren aufgefordert, ihre Ideen und Vorstellungen für das Wappen zu Papier zu bringen. Fast 100 tolle Entwürfe kamen zusammen.
Im Anschluss an die Gedenkfeier zum Volkstrauertag am 17.11.2013 hatten dann alle Bewohner(innen) die Möglichkeit, ihren Lieblingsentwurf zu küren.
Die drei Entwürfe mit den meisten Stimmen wurden einem auf Wappen spezialisierten Kunstgrafiker aus Steinhorst zur Verfügung gestellt.
Dieser entwickelte die Entwürfe entsprechend der Vorgaben des Kommunalheraldik-Leitfadens des Landes Schleswig-Holstein weiter.
Das Ergebnis fand hohen Zuspruch in der Gemeinde.
Abgebildet sind ein Baumstubben als Namensgeber der Gemeinde; ein Fluss, der die Barnitz symbolisiert, die durch die Gemeinde fliesst und drei Ähren, die für die Landwirtschaft stehen, die immer noch das Leben in Stubben bestimmt. Das alles findet sich vor dem gelb/grünen Hintergrund, den traditionellen Farben der Gemeinde.
Das Wappen ist ein schönes Ergebnis, dass über alle Gruppen hinweg unter Mitwirkung vieler Stubber Bürger entstanden ist.
Von Gold und Rot schräglinks geteilt. Oben der schwarze mecklenburgische Stierkopf, unten ein stehender, natürlich tingierter, schwarz bewehrter Storch.
Im Jahr 1158 wird die Ortschaft Walegotsa, das heutige Walksfelde, erstmalig in einer Urkunde erwähnt. Gemäß dem Mecklenburgischen Urkundenbuch I hat Heinrich der Löwe die Ausstattung des Bistums Ratzeburg festgelegt und Walegotsa dem Bistum zugeordnet. Mit dem Ende des 30-jährigen Krieges erhielt das Ratzeburger Domland (Bistum) die Bezeichnung „Fürstentum Ratzeburg“ und wurde dem Herrschaftsbereich der Mecklenburger Herzöge zugeteilt. Damit gehörte Walksfelde -ebenso wie die übrigen Dörfer der Vogtei Mannhagen- zu Mecklenburg. Es war also eine mecklenburgische Exklave im Lauenburgischen. Erst 1937 kam Walksfelde zum Kreis Herzogtum Lauenburg.
Im Jahr 2008 feierte Walksfelde sein 850-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass sollte die Gemeinde ihr eigenes Wappen erhalten. Der Gemeindevertreter Heinz-Jürgen Waldfried gestaltete den Entwurf, welcher von der Gemeindevertretung angenommen wurde. Wappen und Flagge wurden am 30.07.2008 vom Landesarchiv genehmigt und in die Wappenrolle eingetragen.
Der mecklenburgische Stierkopf symbolisiert die von 1648 bis 1937 währende Zugehörigkeit zum Herzogtum Mecklenburg bzw. Mecklenburg-Strelitz. Das Dorf war über mehrere Jahrhunderte eine mecklenburgische Exklave im Herzogtum Lauenburg. Der Storch weist auf die traditionell im Dorf brütenden Störche hin. Der gelbe Untergrund steht für die landschaftstypische Rapsblüte. Der rote Untergrund symbolisiert die Zugehörigkeit zum Kreis Herzogtum Lauenburg, welches im Wappen ebenfalls die rote Farbe als Hintergrund führt.
In Grün, aus dem oberen Schildrand hervorbrechend, eine schwarz bewehrte goldene Adlerklaue, die eine silberne jungsteinzeitliche Streitaxt ohne Stiel hält.
Das 1982 geschaffene Ortswappen will in bildlicher Darstellung auf die Lage seines Dorfes hinweisen. Das Grün des Wappenbildes stellt die waldreiche Lage unseres Dorfes dar. Die Fänge des Adlers, der symbolisch die vorgeschichtliche Axt hält, will bekunden, daß insbesondere dort und auf allen Fluren Wentorfs schon Menschen aller Epochen der Vorgeschichte hier in Wentorf lebten, was durch Funde insbesondere auf dem “ Örn “ belegt ist. “ Der Adler Örn “ ist ein Flurname und könnte mit der Nähe zum Oberteich, welcher früher ein offenes Gewässer war, zusammenhängen. Zentrum des öffentlichen und kulturellen Lebens ist das 2003 errichtete Gemeinschaftshaus „Dörphus up den Ruhm“, welches neben der Freiwilligen Feuerwehr und dem gemeindeeigenen Kinderspielkreis auch einen Gemeindesaal beherbergt.