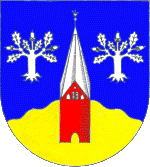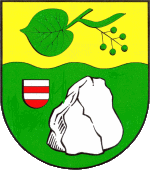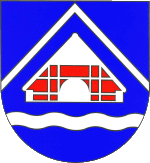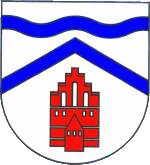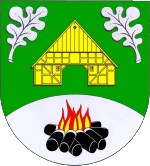In Blau, darin drei silberne Laubblätter, über blauem Wellenschildfuß, darin zwei silberne mit einem silbernen Pfahl mittig verbundene Wellenbalken, ein goldener abgeflachter Dreiberg, darin ein grüner Sonnentau.
Die Gemeinde Feim liegt im Naturraum "Dänischer Wohld" im "Östlichen Hügelland" inmitten einer durch Waldgebiete und Moore sowie durch landwirtschaftliche Nutzflächen geprägten Landschaft. Kleine Bachläufe und sanfte Hügel und Talungen geben dieser Region einen attraktiven Charakter. Die Wappengestaltung nimmt sich dieser besonderen landschaftlichen Situation an. Das Wappenschild wird geteilt durch einen "Dreiberg", der die reizvolle Moränenlandschaft versinnbildlicht. Die drei Laubblätter und das Sonnentau beziehen sich die Wälder und Moore im Gemeindegebiet und der blau-weiße Wellenschildfuß auf die Gewässer in und um Feim und zwar auf den Nord-Ostsee-Kanal, den alten Eiderkanal, die kleinen Bachläufe und die nahe Ostsee. Der geteilte Wellenfaden weist auf die Wasserscheide hin, die durch die Gemeinde verläuft.
Das Wappen wurde am 12.12.2011 genehmigt. Entwurfsverfasser war Uwe Nagel, Bergenhusen.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Blau ein gewellter goldener Berg, davor ein roter spätgotischer Kirchturm mit achtseitigem silbernem Helm; beiderseits desselben je ein schwebender bewurzelter silberner Eichbaum.
Die für Schleswig-Holstein typische Doppeleiche, die auch in dem Gemeindewappen versinnbildlicht werden sollte, wurde hier aus graphischen Gründen in zwei einzelne Eichen aufgelöst.
Der goldene Wellenberg symbolisiert einerseits den Vorsprung des Umlandes von Gettorf, des so genannten Dänischen Wohlds, in die Kieler Bucht, wobei das Meer durch den blauen Schildgrund dargestellt wird, andererseits kann in dem Wellenberg die Aufschüttung des Sandes über einem Hünengrab gesehen werden.
Die verwendeten Farben, Blau-Gelb (= Gold) - Rot-Weiß (= Silber), sind im späteren 19. und anfänglichen 20. Jahrhundert die faktischen Provinzialfarben von Schleswig-Holstein gewesen, wurden aber nicht populär. Die heutigen Farben von Schleswig-Holstein sind das auf das Jahr 1843 zurückgehende Blau-Weiß-Rot.
Die Genehmigung des Wappen erfolgte am 15.10.1984 durch den Innenminister des Landes Schleswig-Holstein.
Von Gold und Grün im Wellenschnitt erhöht geteilt. Oben ein mit der Spitze nach vorn weisendes grünes Lindenblatt mit Fruchtstand, unten - leicht nach hinten versetzt - ein silberner Feldstein, oben rechts begleitet von einem dreimal silbern-rot geteilten Schildchen.
Der Ortsname der Gemeinde Lindau bedeutet so viel wie "die Au bei den Linden". Das Lindenblatt mit Samenstand im Hauptschild und die Wellenlinie als Teilungslinie des Wappenschildes nimmt auf diese Namensdeutung Bezug. Der Findling im Schildfuß weist auf ein im Gemeindegebiet liegendes Naturdenkmal hin. Das seitlich beigeordnete Wappenschild bezieht sich auf die Familie von Ahlefeld. Sie besaß seit der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts bis zum Verkauf und zur Aufsiedlung in den Jahren 1919 und 1926 ununterbrochen die Güter Lindau und Königsförde und hat damit das Leben der Menschen in der seit 1928 selbständigen Gemeinde mitgeprägt. Sie hatte außerdem seit 1460 das Patronat für die Gutsbezirke zuständige Kirchengemeinde Gettorf inne.
Das Wappen wurde am 9.7.1999 genehmigt. Entwurfsverfasser war Uwe Nagel, Bergenhusen.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Gold und Rot im Wellenschnitt geteilt, oben ein grünes Giebelbrett mit einer rautenförmigen goldenen Fensterlucke, unten ein aus Werkstein gemauerter silberner, blau gefüllter Brunnen mit breitem Rand.
Die heutige Gemeinde Neudorf-Bornstein im Amt Dänischer Wohld, Kreis Rendsburg - Eckernförde liegt südlich der Eckernförder Bucht. Sie grenzt im Uhrzeigersinn, im Norden beginnend, an die Gemeinden Noer, Osdorf, Gettorf, Lndau, Holtsee und Altenhof. Zur Gemeinde Ne udorf-Bornstein gehören die Ortsteile Rothenstein, Behrensbrook und Neudorf nördlich der Bundesstraße 76 und Bornstein südlich dieser Bundesstraße. Neudorf wird erstmalig in den Gettorfer Kirchenpapieren im Jahre 1460 erwähnt unter dem Namen Niegedorpp. Bornstein wird urkundlich als Tome Bordenstene im Jahre 1506 erwähnt. Bis zur Auflösung der Gutsbezirke im Jahre 1928 gehörte Neudorf zum Gut Behrensbrook und Bornstein zum Gut Altenhof. Das grüne Giebelbrett steht für das Niedersachsenhaus, das Regelhaustyp in den historischen Dörfern ( Neu = neues, Dorf = Dorf) der Gemeinde war. Die Wellenlinie steht für die Hülkenbek, einen Wasserlauf zwischen Neudorf und Bornstein und der steinerne Brunnen steht wortwörtlich für den Ortsteil Bornstein (Born = Brunnen, Stein = Stein).
Das Wappen wurde am 23.7.2003 genehmigt. Entwurfsverfasser war Henning Höppner, Plön.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Blau über einem silbernen Wellenbalken und unter einem silbernen Sparren ein Bauernhaus in Frontalsicht mit silbernem Dach, Türen und Fachwerk und roter Mauerung.
Das Wappen der Gemeinde Neuwittenbek zeigt als Hauptfigur in stilisierter Form ein altes Bauernhaus. Es repräsentiert den Ort deshalb, weil dieser bis in die Gegenwart durch die bäuerliche Wirtschaft geprägt war und noch heute einige Bauernhäuser mit traditionellem Erscheinungsbild vorhanden sind. Die stilisierte Giebelansicht im Wappen ist beispielsweise am "Hof Grotkopp" erhalten. Der silberne Wellenbalken stellt die Levensau und die Altwittenbeker Au dar. Zugleich bezieht er sich auf den an der südlichen Grenze des Gemeindegebietes gelegenen Nord-Ostsee-Kanal. Ferner vertritt er "redend" den heutigen Ortsnamen und den der historischen Ortsteile Altund Neuwittenbek (= weißer Bach). Schließlich befindet sich im Ortsteil Warleberg das Mündungsgebiet der historischen "Levensau", die die Bedeutung eines Grenzwasserlaufs zwischen den Landesteilen Schleswig und Holstein hatte. Der Sparren soll symbolisch die Gemeinschaft der drei Ortsteile Neuund Altwittenbek sowie Warleberg in der heutigen Gemeinde Neuwittenbek darstellen. Alt- und Neuwittenbek wurden 1984 zu einer Gemeinde vereinigt. Vorher war Altwittenbek Ortsteil der Gemeinde Felm, Warleberg bis 1928 ein selbständiger Gutsbezirk. Die Tinktur ist in den Landesfarben vorgenommen.
Das Wappen wurde am 19.4.1988 genehmigt. Entwurfsverfasser war Karl Kohzar, Neuwittenbek.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Silber jeweils zwei Viertel eines roten Wagenrades und eines roten Mühlrades, schragenweise mit der Nabe auf einen gemeinsamen Mittelpunkt weisend aneinandergestellt; in den Oberecken zwei grüne Eichenzweige, jeweils aus zwei Blättern und einer Frucht bestehend.
Die Figur des gevierten Rades in dem dadurch ungewöhnlichen Wappen der Gemeinde Osdorf ist mehrdeutig. Zur einen Hälfte Wagen-, zur anderen Mühlrad soll mit ihm das arbeitsteilige Nebeneinander von Landwirtschaft und Handwerk, das den Ort seit alters prägte, versinnbildlicht werden. Die "Mühlradhälfte" repräsentiert zugleich die Borghorster Mühle und den gleichnamigen Wohnplatz. In der Vergangenheit war diese Mühle Zielpunkt des Getreideanbaus der Region. Durch die Quadrierung des Rades entsteht ferner das Bild einer Kreuzung, welche an die Lage des Ortes an zwei Verbindungsstraßen erinnern will. Jedes der Viertel vertritt einen der vier Ortsteile, aus denen 1928 die Gemeinde Osdorf gebildet worden ist: die gleichnamige Landgemeinde und die drei Gutsbezirke Borghorst, Borghorsterhütten und Augustenhof. Die Betonung des Radmittelpunktes soll schließlich die Lage Osdorfs im Zentrum des Dänischen Wohlds verdeutlichen. Diese Landschaft, ehemals ein ausgedehntes, dichtes Waldgebiet, wird im Wappen durch die beiden Eichenzweige vertreten.
Das Wappen wurde am 16.3.1989 genehmigt. Entwurfsverfasser war Karl Kohzar, Neuwittenbek.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Silber unter einem blauen Wellenbalken ein flacher, erhöhter blauer Sparren, der die Giebelseite eines roten steinernen Hauses einschließt mit Treppengiebel, drei gotischen Fenstern im Dachgeschoss, das mittlere höher, und einem spitzgiebeligen Vorhaus.
Dem Ortsnamen Schinkel liegt die Bedeutung "Schenkel" (Winkel) im geographischen Sinn zugrunde. Das soll mit dem blauen Winkel auf silbernem Grund ausgedrückt werden. Der blaue Winkel kann auch an die Umwandlung bzw. Begradigung der Eider in den "Eiderkanal und spätere Kanalbauten" erinnern. Er kann weiter bedeuten, dass in neuerer Zeit die Technik in mancher Weise die Gemeinde beeinflusst. Schließlich taucht im Verlaufe des Reststückes des Eiderkanals am Gut Rosenkranz dieser Winkel auf. Der Wellenbalken soll daran erinnern, dass ursprünglich Gut und Dorf an einem Flussbogen der Eider lagen. Die Burg erinnert an die bei der Gründung Schinkels erbaute Wasserburg. Die Zeichnung der Burg ist nach einer Zeichnung von Woldemar von Rosenkrantz ausgeführt, die am meisten der Darstellung in der sogenannte "Rantzauischen Tafel" entspricht.
Das Wappen wurde am 24.11.1998 genehmigt. Entwurfsverfasser war Karl Kohzar, Kiel.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Grün und Silber im Bogenschnitt zum Schildhaupt gesenkt geteilt. Oben ein goldenes Bauernhaus, rechts und links oben von je einem nach innen gestellten silbernen Eichenblatt begleitet, unten flammende Holzkohle aus acht schwarz-silbernen Scheiten und fünf goldenen Flammen mit rotem Bord.
Die Gemeinde Tüttendorf liegt im Naturraum Dänischer Wohld, im östlichen Hügelland, einer durch sanfte Hügel und Senken geprägte reizvolle Landschaft. Die bogenförmige Schildteilung soll darauf hinweisen. Bei dem stilisierten goldenen Giebel handelt es sich um ein für diese Region typisches Bauernhaus, das den Ortsnamen verbildlichen soll. Tüttendorf lässt sich mit "Dorf des Tütte", eine Kurzform von Diedrich, Diedrik, entspr. Tideke, Tüdeke, deuten. (W. LAUR, 1992, Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein) Die beiden Eichenblätter im Schildhaupt symbolisieren den Charakterbaum dieser Landschaft, von denen mehrere als Naturdenkmal ausgewiesen sind. Zudem sollen sie an die vergangene Friedenseiche am Denkmal in der Ortsmitte erinnern, die nach ihrem Verlust dann im Jahre 2010 durch eine neue Eiche ersetzt wurde. Die Gemeinde besteht aus drei Ortsteilen, nämlich, neben dem namengebenden "Tüttendorf", aus dem Ortsteil "Blickstedt" und "Wulfshagenerhütten", einem alten Gutshof, mit einer Glashütte im 16. Jahrhundert. Der Waldreichtum des Dänischen Wohld schaffte die Grundlage für die Köhlerei und die Glasverhüttung. Die brennende Holzkohle im Schildfuß bezieht sich auf dieses alte Handwerk. Zudem soll mit dem Symbol des Feuers ein Bezug zu den beiden Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde hergestellt werden, die als bedeutende gesellschaftliche Gruppen im Ort gelten.
Das Wappen wurde am 29.3.2011 genehmigt. Entwurfsverfasser war Uwe Nagel, Bergenhusen.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen.