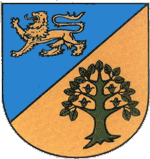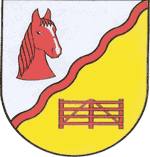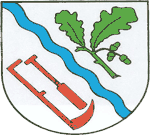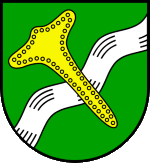Beschreibung der Wappen der amtsangehörigen Kommunen vom
Amt Südangeln Von Blau und Gold schräglinks geteilt. Oben ein rot bewehrter, schreitender goldener Löwe, unten eine bewurzelte grüne Buche mit Früchten.
Der Aufbau des Wappens lehnt sich an das Wappen des Kreises Schleswig-Flensburg an, von dem es auch die Figur des goldenen Löwen in Blau übernommen hat. Die Verwendung des Zeichens der übergeordneten Gebietskörperschaft will andeuten, daß die zentralörtliche Funktion der Gemeinde über den nur lokalen Aufgabenbereich hinausweist.
Die Buche im unteren Teil des Wappens nimmt Bezug auf den Gemeindenamen (Böklund = Buchenhain). Sie bildet den individuellen, auf den Ort und seine historischen Wurzeln bezogenen Beitrag des Wappens und weist dieses insofern der Gruppe der sog. „redenden Wappen" zu. Die Figur des belaubten, fruchttragenden Baumes steht zugleich als Zeichen eines lebendigen, zukunftsorientierten Gemeinwesens.
Die Farben des Wappens sind die historischen Farben des Landesteils Schleswig, ergänzt um das eigenständige, gemeindebezogene Grün.
Die Gemeinde Brodersby-Goltoft enstand zum 1.3.2018 durch Fusion der Gemeinde Brodersby mit der Gemeinde Goltoft.
Bis dahin gab es zwei Wappen der Gemeinden (siehe unten bei Ortsteile).
Die junge neue Gemeinde Brodersby- Goltoft verzichtete seit dem Tag der Fusion auf die Erstellung eines neues Wappens. Es wurde offiziell ein Gemeindelogo als Ersatz für ein Wappen erstellt. Dieses Logo erfüllt die selben Kriterien wie ein Wappen und ist seither offiziell auch auf allen amtlichen Dokumenten zu finden.
Ortsteile von Brodersby-Goltoft
Von Blau und Gold schräg geviert. Oben eine silberne Möwe im Flug, unten in Frontalansicht der abwechselnd silbern und schwarz geplankte Steven eines Schiffes.
Die Schildteilung im Wappen von Brodersby deutet mit dem Darstellungsmittel des Heroldsbildes die Lage des Ortes an der engsten Stelle der Schlei bei Missunde an. Von den Teilungssegmenten stehen die zwei goldenen für das Land, die beiden blauen für das Wasser. Brodersby eignete sich deshalb sowohl als Übergangsstelle über die Schlei wie auch als Verteidigungspunkt gegen wikingerzeitliche Seeräuber wie auch als Wehranlage in den schleswig-holsteinischen Kriegen. Auf der Halbinsel Burg, südlich von Brodersby, soll Herzog Knud Laward ein heute als "Margarethenwall" bezeichnetes "Castellum" erbaut haben. 1250 wurde hier angeblich der Körper des ermordeten dänischen Königs Erich Plogpenning angeschwemmt. Der Schiffssteven weist sowohl auf die durch die Wikinger beeinflußte Vergangenheit des Schleigebietes als auch auf die wichtige Verkehrsverbindung der Missunder Fähre hin. Die Möwe bezeugt den Reiz der Schleilandschaft und ihren Erlebniswert. Die Schildfarben Blau und Gold sind diejenigen des Landesteils Schleswig.
Das Wappen wurde am 3.10.1989 genehmigt. Entwurfsverfasser war Klaus Agger, Brodersby.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen.Von Gold und Blau im Wellenschnitt gesenkt geteilt. Oben zwei fächerförmig gestellte grüne Eichenblätter, deren Stiele durch ein verknotetes grünes Band zusammengehalten werden, unten ein silberner Fisch.
Die beiden Figuren des Goltofter Wappens knüpfen an historische Gegebenheiten an. Die durch ein verknotetes Band zusammengehaltenen Eichenblätter verstehen sich als die stilisierte Form einer Doppeleiche, das Erinnerungszeichen an die schleswig-holsteinische Erhebung von 1848. Wie in vielen Gemeinden wurde auch in Goltoft, wohl zur Fünfzigjahrfeier 1898, eine solche Eiche gepflanzt. Die alte Eiche, 1978 durch Straßenbau beseitigt, wurde im Jahre darauf durch eine junge ersetzt. Der Knoten der Wappenfigur ist Zeichen unverbrüchlicher Verbundenheit Schleswigs und Holsteins, die Eiche Garant für Unabhängigkeit und Beständigkeit der Bürger der Gemeinde. Goltoft war Bestandteil der Schliesharde oder Schleiharde. Als Verwaltungs- und Gerichtsbezirk führte die Schliesharde ein Siegel. Das Siegelbild war ein Fisch, der die Lage an der fischreichen Schlei versinnbildlicht. Aus diesem Hardessiegel hat Goltoft den Fisch übernommen.
Das Wappen wurde am 9.8.1988 genehmigt. Entwurfsverfasserin war Carla Erck, Golthoft.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Silber und Gold durch einen roten Schrägwellenbalken geteilt. Oben ein roter Pferdekopf mit silberner Blesse und unten ein rotes Hecktor.
Zur Geographie u. Territoriale Zugehörigkeit:
Havetoft liegt in der Landschaft Angeln und ist dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem Amt Böklund zugehörig. Havetoft liegt im Endmoränengebiet der letzten Eiszeit, der westliche Teil ist sandiger und der östliche Teil lehmiger Boden.
Beide Orsteile, Havetoft wie Hostrup, werden durch die Bollingstedter Au getrennt. Seit 1974 sind die bis dahin selbständigen Gemeinden Hostrup u. Havetoft vereint.
Urkundliche Erwähnung:
Die erste bekannte urkundliche Erwähnung von Havetoft ist der Bau der Kirche, der in der Zeit 1180 -1240 stattgefunden hat.
Charakteristisches:
Symbole u. Ortsnamen:
Havetoft u. Hostrup waren bis in die 50. Jahre reine Bauerndörfer mit den dazugehörigen Handwerks u. Versorgungseinrichtungen.
Bis zu der Zeit wurde das Pferd überwiegend als Zugtier auf den Höfen eingesetzt. Das Hecktor war Einlass auf das eingefriedigte Feld.
Nach dem Chronisten u. Lehrer Otto Clausen „Flur u. Ortsnamen"
Ortsteil Havetoft:
Have = reichsdänisch = Garten = ist im schleswigschen umzäuntes kleines Stück Land
toft = Ort = Siedlung = Dorf = wikingerzeitlich .
Ortsteil Hostrup:
Host = Horse = Pferd = Englisch
rup = Siedlung = Dorf = Völkerwanderungszeit u. folgende Jahrhunderte, ältere Wald u. Rodungsnamen.
Nach Wolfgang Laur Wissenschaftler „Angler Jahrbücher"
Ortsteil Havetoft :
Have = Einhegung = eingehegtes Land / Grundstück
toft = Hausplatz = Siedlungsplatz
Ortsteil Hostrup:
Host = Hors = Pferd
rup = Siedlung = Dorf
Gewellte Linie: Symbol für die Bollingstedter Au, die beide Ortsteile trennt.
Über blau-goldenem Wellenschildfuß in Gold eine grüne zweistämmige Eibe, rechts und links begleitet von drei bogenförmig untereinander stehenden grünen Findlingen.
Das Wappen der erstmals 1196 urkundlich erwähnten Gemeinde Idstedt zeigt als zentrales Symbol eine Eibe. Es greift damit auf die sprachwissenschaftlich belegte Deutung des Ortsnamens als „Eibenstätte" in frühgeschichtliche Zeit zurück. Die Eibe war einst den Germanen das Symbol der Ewigkeit und insbesondere dem Gotte Ull, einem Sohn des höchsten germanischen Götterpaares, ein heiliger Baum. Das läßt den begründeten Schluss zu, dass Idstedt als Eibenstätte in frühgeschichtlicher Zeit unweit des alten Heerweges ein nicht unbedeutender Kultplatz gewesen sein muss. Die Einhegung durch die Findlinge deutet darauf hin, dass an altgewohntem Ort die „Eibenstätte" wohl auch als Thingplatz gedient hat. Denn nur so erklärt sich, dass Istat im frühen Mittelalter, wie es im Erdbuch König Waldemars II. 1231 beurkundet wird, Zentralort des sog. Istatesyssels war. Das Syssel fasste im Süden des späteren Herzogtums Schleswig acht Harden zu einer Verwaltungseinheit zusammen.
Das Gold im Wappen will hinweisen auf die leichten und bleicherdigen hellen Sanderböden der schleswigschen Geest, an deren Ortsrand die Gemeinde Idstedt liegt. Für den Waldreichtum der sie umgebenden Landschaft steht die Eibe ebenfalls. Das Blau im Schildfuß, durchzogen von den goldenen Wellenbändern, symbolisiert den Idstedter See. Auf die Nähe Idstedts zur Angeliter Hügellandschaft deutet die dreibergartige Scheidung des Schildfußes vom Schildkörper hin: Idstedt an der Grenze zwischen den Hügeln Angelns und der schleswigschen Sandergeest.
Die Hauptfarbgebung Gold und Blau zitiert die Farben des ehemaligen Herzogtums Schleswig.
Von Blau und Grün durch einen Bogen aus einander zugewandten liegenden goldenen Ähren geteilt zum Schildhaupt. Oben eine goldene Frontalansicht eines Kolonistenhauses, unten ein goldenes Lyngby-Beil.
Geographie und territoriale Zugehörigkeit:
Klappholz befindet sich in der Landschaft Angeln, ist dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem Amt Böklund zugehörig. Es ist eine kleine ländliche Gemeinde im Endmoränengebiet der letzten Eiszeit. Der westliche Teil hat einen leichten sandigen Boden mit vormals einzelnen Mooren durchsetzt. Im östlichen Teil befindet sich schwerer lehmiger Boden.
Der Ortsteil Westscheide liegt, wie der Name sagt, im westlichen Teil der Gemeinde Klappholz, an der Grenze zum alten Kreis Flensburg, an der „Scheide".
Urkundliche Erwähnung:
Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 1352. Die Namensgebung „Klappholz" setzt sich aus dem dänischen Wort „Klapp", d. h. das Laub von den Bäumen schlagen und „holz" steht für den Waldreichtum in früherer Zeit. Da in damaligen Zeiten auf dem sandigen Boden oft Futtermangel herrschte, hat man die Zweige von den Bäumen abgeschlagen um das Vieh damit zu versorgen.
Der Ort Klappholz ist ein Haufendorf. Der erste Hofbesitzer soll ein Nikolaus Tolfsen um 1400 gewesen sein. Er siedelte auf einer Rodung.
Westscheide ist erst 1763 durch Ansiedlung von Kolonisten aus Württemberg und Rheinland Pfalz entstanden, die der dänische König Friedrich der V. ins Land geholt hatte, um die Ödländereien urbar zu machen.
Charakteristisches:
Im oberen Teil des Wappenschildes ist die Giebelseite eines Kolonistenhauses aus der Zeit der Besiedlung um 1763 dargestellt. Es handelt sich dabei um eine Bauzeichnung des damaligen „Architekten" Benetter. Ein Symbol für den Ortsteil Westscheide.
Die höchste Erhebung des Ortes Klappholz ist der „Roggenberg", mit einer Höhe von 61 m über NN. Er wird als Roggenährereihe symbolisiert.
In einem grünen gewölbten Feld ist ein Rentiergeweihbeil dargestellt, das „Lyngby Beil" (Ahrensburger Kulturstufe), das 1991 in guten Zustand bei Drainagearbeiten in 1,5 m Tiefe gefunden wurde. Es stammt aus der Zeit des Jungpaläolithikums, vor ca. 12 - 14000 Jahren, als Rentierjäger als Nomaden die Tundraähnliche Landschaft von Klappholz durchstreiften.
In Silber ein blauer Schrägwellenbalken, begleitet oben von einem grünen Eichenzweig, unten von einer einwärts gerichteten, schräggestellten gestürzten roten Heidensense und einem schräggestellten roten Torfspaten nebeneinander.
Alte, prächtige Eichen sind ein besonderer ortsbildprägender Schmuck der Gemeinde Neuberend, die sich mit ihren Knicks, Hecken und Wäldern, ihren Wasserläufen, kleineren und größeren Seen einer herrlichen Umgebung erfreut. Diese Tatsache soll in dem Wappen bildlich zum Ausdruck kommen.
Mehrere Vereine des Ortes haben die Eiche in ihren Namen aufgenommen.
Heidesense und Torfspaten sollen an frühere lebensnotwendige Arbeiten der Bauern auf der Berendheide (Neuberend) erinnern!
Über blau-goldenen Wellen in Gold ein bewurzelter blauer Eichbaum, dessen Stamm sich unterhalb der Mitte in drei gleichmäßig starke Äste teilt.
Die beherrschende Figur des Eichbaums im Wappen der Gemeinde Nübel weist auf die Zugehörigkeit des Kirchortes zur Struxdorfharde in historischer Zeit hin. Im Siegel dieser Harde findet sich ein Eichbaum abgebildet, wie dem inoffiziellen Wappen der Landschaft Angeln noch heute entnommen werden kann. Die besondere Form des Baumes mit seinen drei sichtbar von einander getrennten Wachstumszonen macht deutlich, daß die heutige Gemeinde Nübel aus den drei Ortsteilen Nübel, Brekling und Berend besteht, die sich 1974 zu einer Gemeinde zusammengeschlossen haben. Die Wellen im Schildfuß geben den Langsee wieder, der im Norden die Gemeinde begrenzt. Die Wappenfarben Blau und Gold entsprechen denen des Landesteils Schleswig.
Das Wappen wurde am 12.2.1985 genehmigt. Entwurfsverfasser war Horst Bach, Breking.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Rot und Blau durch einen silbernen Wellenbalken geteilt. Oben ein linksgewendetes, besegeltes silbernes Wikingerschiff, unten ein silberner Fisch.
Die Gemeinde Schaalby liegt mit ihren Ortsteilen Schaalby, Klensby, Kahleby, Moldenit und Füsing im Südwesten der Landschaft Angeln. Moldenit und Füsing grenzen unmittelbar an die Schlei. Diese, im 9. und 10. Jh. eine wichtige Fernverkehrsverbindung mit dem Zielpunkt Haithabu, zog immer wieder Wikinger an, die am Ufer kleine Siedlungen gründeten. Man nimmt an, daß die -by-Orte entlang der Schlei von schwedischen Wikingern angelegt worden sind. Diese Orte werden seit alters im Volksmund als "Wikingerdörfer" bezeichnet. Auf diesen wikingerzeitlichen Ursprung bezieht sich das Schiff im Wappen von Schaalby. Der das Wappen teilende Wellenbalken bezeichnet die Loiterau, welche durch das Gemeindegebiet fließt und in die Schlei mündet. Wie viele andere im Einzugsgebiet der Schlei war auch dieser Wasserlauf in der Vergangenheit schiffbar. Der Fisch im Wappen ist eine Übernahme aus dem Siegel der Schliesharde, dem Verwaltungszentrum für Schaalby bis 1867, und bezeichnet zugleich die Lage der Gemeinde an der fischreichen Schlei. Die Farben des Wappens sind die Farben Schleswig-Holsteins.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Grün ein schräglinker silberner Wellenbalken, überdeckt mit einem schräggestellten, gestürzten goldenen Thorshammer.
Die Ersterwähnung von 1363 gibt das Kirchdorf Taarstedt als "Torstede" wieder, wobei die Bedeutung des Ortsnamens als die "Stätte des Thor" deutlich wird. In der nordischen Sagenwelt ist Thor, ältester Sohn Odins, der Gott des Donners und Herrscher über Wind, Regen und Fruchtbarkeit, dessen Waffe und Symbol der Hammer "Mjölnir" war. Wegen der Volkstümlichkeit des Gottes, besonders auch unter den Bauern, war der Thorshammer, wie er im Wappen dargestellt ist, ein beliebtes, gern als Amulett getragenes Schmuckstück. Mit dieser Wappenfigur reiht sich das Taarstedter Wappen der großen Gruppe der "sprechenden" Gemeindewappen ein. Ob der Ortsname auf eine vorchristliche Kultstätte hinweist, ist nicht bekannt. Der Wellenbalken zeigt die Loiter Au, welche durch die 1938 aus Scholderup, Taarstedt und Westerakeby gebildete Gemeinde fließt. Die grüne Schildfarbe bringt die Fruchtbarkeit der Felder und die heute noch überwiegend agrarwirtschaftliche Orientierung der Einwohner zum Ausdruck.
Das Wappen wurde am 25.7.1994 genehmigt. Entwurfsverfasser war Hanas-Udo Hesse, Schnarup-Thumby..
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Blau zwischen zwei grannenlosen goldenen Weizenähren das silberne Taufbecken der Tolker Kirche mit wassergefüllter goldener Taufschale. Im goldenen Schildfuß mit geschwungener, ein Tal zwischen zwei Hügeln andeutender, Teilungslinie eine blaue Wellenleiste.
Das Tolker Taufbecken im Zentrum des Wappens verweist auf das hohe Alter von Ort und Kirche, die beide 1192 erstmals erwähnt sind. Für die in ihrer Mehrheit christlich getauften und kirchlich orientierten Tolker Bürger ist das alte Taufbecken bis heute ein verbindendes Symbol. Die Ähren verweisen auf die noch heute überwiegend agrarwirtschaftliche Orientierung des Ortes, die goldene Farbe auf die Bodenfruchtbarkeit Angelns und auf den durch Ackerbau gewonnenen Wohlstand. Die Form des Schildfußes deutet die Angeliter Landschaft mit ihren Hügeln an, durch welche die Loiter Au, dargestellt durch die Wellenleiste, fließt. Außerdem wird durch die Welle der fischreiche Tolker See repräsentiert. Die Farben des Schildes, Gold und Blau, sind die Farben des Landesteils Schleswig und zusammen mit dem Silber des Taufbeckens die des Kreises Schleswig-Flensburg.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Blau und Gold schräglinks geteilt, darauf ein Welleninnenbord und eine Urne in verwechselten Farben.
Die Gemeinde Twedt wurd von der Wellspanger und der Loiter Au fast zu zwei Drittel umflossen. Dieser Wasserlauf wird durch das Innenbord dargestellt. Die Urne, die etwa dem 3. oder 4. Jahrhundert n. Chr. angehört, deutet auf Aushebungen in Twedt um einen Grabhügel herum hin. Die Farbgebung Blau und Gold ist die Farbe des Landesteils Schleswig.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen.