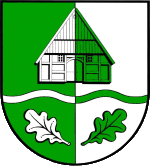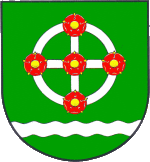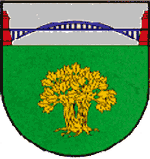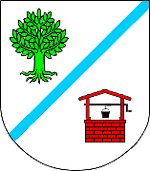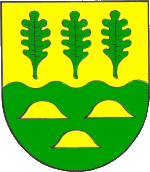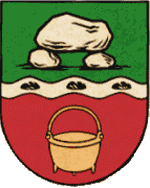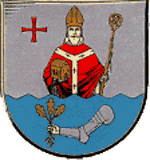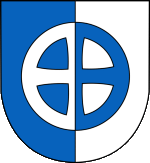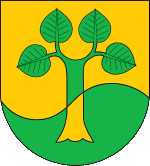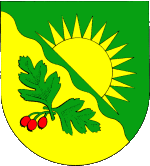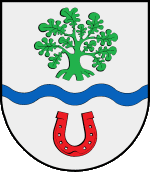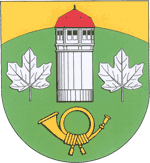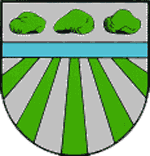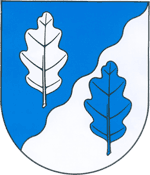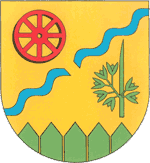Von Grün und Silber gespalten. In vertauschten Farben oben - die Spaltungslinie überdeckend - die Giebelfront eines bäuerlichen Fachwerkhauses mit verbrettertem Giebel, unten unter einem Wellenbalken zwei auswärts gewendete Eichenblätter.
Die Gemeinde liegt am Westrand der Holsteinischen Vorgeest im Niederungsgebiet der Stör. Das giebelständige Bauernhaus zeugt von der Bedeutung der Landwirtschaft für die Gemeinde, die Wellenlinie symbolisiert ihre Lage an der Stör. Die beiden Eichenblätter weisen auf den reichen Baumbestand hin, wobei die Eichen als charakteristisch für die Landschaft gelten.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Grün über silbernem Wellenbalken ein silbernes Rad mit vier Speichen (Radkreuz), belegt in der Mitte und an den vier äußeren Enden der Speichen mit zusammen fünf roten, mit goldenen Samenkapseln und goldenen Kelchblättern versehenen Rosenblüten.
Die Gemeinde Aukrug liegt inmitten des gleichnamigen Naturparks, welcher einen Teil der Hohen Geest Mittelholsteins umfaßt. Diese naturräumliche Lage hat sich als grüne Schildfarbe im Wappen niedergeschlagen. Der Erholungswert des Gemeindegebietes macht den Fremdenverkehr zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor. Buckener Au, Mitbek und Bünzau mit ihren Zuflüssen gliedern die Landschaft in Wiesentäler, die schon in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt waren. Der bereits vor dem Zusammenschluß gebräuchliche Name Aukrug bedeutet "in den Krögen", d. h. in den Krümmungen "der Au" gelegenes Land, was durch den silbernen Wellenbalken "redend" ausgedrückt wird. Die fünf Dörfer Bargfeld, Böken, Bünzen, Homfeld und Innien haben sich 1969 zur Gemeinde Aukrug zusammengeschlossen und werden im Wappen durch die fünf Rosen vertreten. Das verbindende Rad zeigt das Zusammenwachsen dieser fünf Aukruger Dörfer. Die verkehrsgünstige Lage der Ortsteile an einem Straßenkreuz der Landstraße Kiel-Itzehoe mit der "Lübschen Trade", einem mittelalterlichen in ost-westlicher Richtung verlaufenden Handelsweg, heute Bundesstraße 430, wird ebenfalls durch das Rad zum Ausdruck gebracht.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Unter silbernem Schildhaupt, darin die stilisierte Grünentaler Kanalbrücke mit roten Pfeilern, blauer Fahrbahn und blauem Tragwerk, in Grün eine bewurzelte goldene Doppeleiche.
Die im oberen Teil des Wappens auf silbernem Grund dargestellte Brücke soll an die Kanalhochbrücke im Ortsteil Grünental erinnern. Diese Grünentaler Hochbrücke wurde 1892 fertiggestellt und wurde 1987 abgebrochen.
Der grüne Untergrund des Wappens weist auf die landwirtschaftliche Struktur der Gemeinde Beldorf hin.
Die goldene Eiche erinnert an die Schleswig-Holsteinische Erhebung im Jahre 1848. Sie wurde am 24. März 1898 gepflanzt.
In der Chronik der ehemaligen Schule Beldorf heißt es dazu:
"Am 24. März 1898 wurde auch in unserem Orte der Tag der 50jährigen Wiederkehr der Schleswig-Holsteinischen Erhebung gefeiert.
Veranstaltet wurde diese Feier von der Schule, der Liedertafel und den Kampfgenossen von 1848 und 1871 unseres Dorfes. Die alten Kampfgenossen von 1848 wurden besonders dadurch geehrt, dass sie einzeln mit Musik aus ihrer Wohnung abgeholt wurden.
Nach einem feierlichen Umzuge durch das Dorf wurde auf der Dorfstraße am nördlichen Ende des Dorfes eine Doppeleiche gepflanzt. Hierbei wurde von dem 1. Lehrer Tackmann eine Rede gehalten, in welcher auf die Bedeutung des Tages hingewiesen wurde.
Von Grün und Silber schräglinks durch Wellenschnitt geteilt. Oben ein silberner Pferdekopf, unten ein rotes Mühlrad.
Die Zweiteilung des Wappenschildes soll darauf verweisen, dass die Gemeinde Bendorf aus zwei alten Dörfern besteht, nämlich Bendorf und Oersdorf. Beide Dörfer sind sehr alt, sie stammen wohl aus der Zeit zwischen 500 und 800 nach Christus, wenn sie nicht noch älter sind. Der das Wappen teilende schräge Wellenschnitt soll den zwischen den beiden Dörfern hindurchfließenden Bach "Iselbek" versinnbildlichen, soll aber auch auf die Zugehörigkeit der Gemiende zum Kreis Rendsburg-Eckernförde hinweisen, dessen Wappen gleichfalls durch einen Wellenschnitt schräg geteilt ist.
Der Pferdekopf im oberen Teil des Wappens steht für die in beiden Dörfern in Vergangenheit und Gegenwart betriebene Pferdezucht.
Das Mühlrad im unteren Teil des Wappens verweist auf die beiden alten Mühlen, die es bis in unser Jahrhundert auf dem Boden der Gemeinde gab: die um 1530 gegründete Hohenhörner Kornwassermühle auf Oersdorfer Gemarkung und die um 1670 gegründete Lohmühle auf Bendorfer Gemarkung.
In Grün ein silberner aufrecht stehender Findling, darüber ein goldenes Ulmenblatt mit links und rechts je einem goldenen Eichenblatt.
Der in der Dorfmitte stehende „Schalenstein" wurde im Jahre 1897 bei Erdbauarbeiten auf dem „Fohrsberg" in der Gemeinde Beringstedt gefunden. Wegen seiner siedlungsgeschichtlichen Bedeutung bildet dieser mit schalenförmigen Vertiefungen versehene Opferstein die Hauptfigur des Beringstedter Wappens.
Die beidseitig im Schildhaupt angeordneten goldenen Eichenblätter symbolisieren die Eichenallee, die aus Anlass des Friedens von 1871 gepflanzt wurde und die bis in die Dorfmitte hineinreicht.
Das goldene Ulmenblatt bezieht sich auf eine ehemals vorhandene 300 Jahre alte und 1936 unter Denkmalschutz gestellte Ulme in der Gemeinde. Diese mußte nach einem „Brandanschlag" im Jahre 1992 gefällt werden, doch erinnert sie an die Dingvogt-Stelle (die örtlichen Richter) in der Gemeinde Beringstedt.
Die grüne Hintergrundsfarbe verweist auf die Bedeutung der Landwirtschaft in dieser Region.
In Silber ein schräglinker blauer Balken, oben ein grüner Laubbaum, unten ein roter bedachter Brunnen mit schwarzem Eimer an der schwarzen Kurbel.
Schon seit dem 14. Jahrhundert gibt es Ansiedlungen in den ehemals selbständigen Gemeinde Großen- und Lütjenbornholt. Die Bewohner suchten diesen Flecken, da neben Wald und Gehölz auch eine Quelle, am Born, die lebenswichtig für eine Ansiedlung auf dem Flecken Bornholt war, vorgefunden wurde.
Aus dem Brunnen (Born) und dem Wald (Holt) ist dann der Gemeindename Bornholt entstanden.
Prägend für das Dorfbild der Gemeinde Bornholt ist seit 1888 der Nord-Ostsee-Kanal.
Als man mit dem Kanalbau begann, versiegten schlagartig alle Brunnen in Großen- und Lütjenbornholt. In Großenbornholt wurde daraufhin eine Wasserversorgungsleitung gebaut, die aus Mitteln des Kanalbaues finanziert wurde.
In Lütjenbornholt wurden die vorhandenen Brunnen tiefer gebohrt und dafür eine Entschädigung an die Grundstückseigentümer gezahlt.
Der Nord-Ostsee-Kanal trennt die ehemaligen Ortsteile Lütjen- und Großenbornholt von dem Ortsteil Töpferberg, der auf der Nordseite des NOK liegt.
Im oberen Teil der Gemeindewappens symbolisiert ein Baum die waldreiche Umgebung der Gemeinde Bornholt. Im unteren Bereich symbolisiert der Brunnen die stets vorhandenen Wasserquellen in der Gemeinde Bornholt.
Bis zum Bau des Nord-Ostsee-Kanales hatte jeder Grundstücksbesitzer seinen eigenen Brunnen vor der Haustür.
Der von unten links nach oben rechts verlaufende blaue Strich symbolisiert den Nord-Ostsee-Kanal.
Gleichzeitig kann die Trennungslinie des NOK auch das Gemeindegebiet nördlich und südlich des Kanales bezeichnen.
Auch in der heutigen Zeit besitzt der NOK ein prägendes Element für die Gemeinde Bornholt. Durch den Tourismus kommen zahlreiche Feriengäste nach Bornholt, um sich in der landschaftlich reizvollen Lage mit idyllischen Plätzen am Nord-Ostsee-Kanal zu erholen.
Von Gold und Grün im Wellenschnitt geteilt. Oben nebeneinander drei Eichenblätter, unten drei schwebende Grabhügel 2 : 1 in verwechselten Farben.
Ehndorf liegt am Zusammenfluß von Aalbek und Stör, was durch die Wellenteilung im Gemeindewappen ausgedrückt wird. Den für die Umgebung des Ortes ursprünglich typischen Eichenwald repräsentieren die Eichenblätter in der oberen Wappenhälfte. Die stilisierten Grabhügel in der unteren Wappenhälfte stehen stellvertretend für insgesamt sieben bronzezeitliche Begräbnisstätten auf dem Gemeindegebiet, die auf eine relativ frühe Besiedlung der Region hindeuten.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Grün und Rot durch einen silbernen, mit drei schwarzen Steinen der Figur nach belegten Wellenbalken geteilt. Oben ein aus zwei Tragsteinen und einem Deckstein bestehendes silbernes Steingrab, unten ein dreifüßiger goldener Grütztopf mit aufrecht stehendem Henkel.
Die Zweiteilung des Wappenschildes soll darauf hinweisen, dass die Gemeinde Gokels aus zwei alten Dörfern besteht, nämlich aus Gokels und Ohrsee.
Der das Wappen teilende Wellenbalken deutet auf einen Wasserlauf hin, der ehemals beide Dörfer trennte.
Die drei schwarzen Steine versinnbildlichen, dass die Bewohner der Dörfer, bis zum Bau der Verbindungsstraße, bei Hochwasser von Stein zu Stein springen mussten, um auf das gegenüberliegende Ufer zu gelangen.
Sowohl Ohrsee als auch Gokels sind reich an Hünengräbern, im oberen Teil des Wappens soll darauf verwiesen werden.
Im Ortsteil Gokels soll 1713 die Pest gewütet haben. Der Überlieferung nach haben die Einwohner der Nachbardörfer während der Pest Grapen mit Speisen auf den "Grapenberg" (heute Bakenberg) gestellt, damit die Kranken sich diese abholen konnten.
Der dreifüßige goldene Grütztopf (Grapen) im unteren Teil des Wappens verweist auf diese Überlieferung.
Von Grün und Gold in Schlangenlinienteilung erhöht geteilt, links je ein goldenes Buchen- und Eichenblatt, unten flammende Holzkohle aus neun schwarz-silbernen Scheiten und sechs silbernen Flammen mit rotem Bord.
Der Ortsname der Gemeinde Grauel leitet sich her von nd. Groof = „Graben" (W. Laur 1992). Dieses bezieht sich auf die Lage des Ortes am Rande einer eiszeitlichen Abflußrinne zwischen den Naturräumen „Hohenwestedter Geest" und „Holsteinischer Geest". Die Wappenteilung nimmt darauf Bezug.
Die flammende Holzkohle symbolisiert den Beruf des Köhlers und soll an den ehemals für die Gemeinde wichtigen Wirtschaftszweig, die Köhlerei erinnern.
Das goldene Buchenblatt im Schildhaupt bezieht sich auf das für die Herstellung der Holzkohle zu verwendende Buchenholz, das .goldene Eichenblatt auf den Charakterbaum der Landschaft um Grauel, die Eiche. Beide Laubblätter sollen zugleich auf die beiden Ortsteile der Gemeinde hinweisen, den namengebenden Ortsteil „Grauel" sowie den Ortsteil „Altenjahn".
Der grüne Hintergrund symbolisiert sowohl die südlich der Ortschaft angrenzende Niederung, der „Buckener Au", als auch die Bedeutung der Landwirtschaft für Grauel. Der goldene Hintergrund der flammenden Holzkohle bezieht sich auf die naturräumliche Lage am Ostrand der „Hohenwestedter Geest".
Das Wappen der Gemeinde Hanerau-Hademarschen zeigt in Silber, aus blauem, durch Wellenschnitt abgeteiltem Schildfuß wachsend, der heilige Severin in rotem Messgewand, mit goldener Bischofsmütze, goldenem Bischofsstab in der Linken und goldenem turmlosen Kirchenmodell in der Rechten, oben rechts begleitet von einem roten Tatzenkreuz; im Schildfuß von links nach rechts ein silbern gerüsteter Arm, der ein goldenes, bewurzeltes Eichbäumchen hält.
Im Jahre 1938 wurde aus den Nachbarorten Hademarschen und Hanerau, beide zum "Kirchspiel" Hademarschen gehörend, der Doppelort Hanerau-Hademarschen gebildet. Es ist daher verständlich, bei Schaffung eines Wappens die Geschichte bzw. Entwicklung beider Ortsteile gebührend zu berücksichtigen.
Bei den Akten und Urkunden des früheren Amtes und Gutes Hanerau im Landesarchiv Schleswig befinden sich mehrere Exemplare des mittelalterlichen Siegels des Kirchspiels Hademarschen. Das runde Siegel zeigt in der Mitte einen Bischof mit den Zeichen seiner Würde, der Mitra auf dem Kopf und dem Krummstab in der linken Hand. Die rechte Hand trägt das Modell einer Kirche.
Das Hademarscher Kirchsiegel tritt erstmalig in einer Urkunde aus dem Jahre 1590 auf, ist aber wohl älter. Die plattdeutsche, aus gotischen Buchstaben bestehende Umschrift des Siegels lautet: "- sill des kercspels - to hademarschen -". Das Siegel stellt mit großer Wahrscheinlichkeit den Hademarscher Heiligen, den St. Severin, der im 4. Jahrhundert Bischof von Köln war, dar.
Weitere Abdrucke des Siegels sind auf Urkunden aus der Zeit zwischen 1648 bis 1664 festgestellt worden. Alle Urkunden sind ausgestellt von den Hademarscher Kirchspiels-Ältesten oder Kirchspiels-Bevollmächtigten, als dem höchsten Selbstverwaltungsgremium des Kirchspiels, in welchem sich Vertreter aller 10 Dörfer befanden (Hademarschen, Beldorf, Bendorf, Großenbornholt, Liesbüttel, Lütjenbornholt, Örsdorf, Pemeln, Steenfeld und Thaden).
Die Verwendung des Hademarscher Kirchensiegels durch die politischen Vertreter der Bevölkerung entspricht der Bedeutung holsteinischer Kirchspiele im Mittelalter und früher Neuzeit.
Sie waren ja nicht nur Pfarrsprengel, sondern auch Verwaltungsbezirk, Gerichtsbezirk und Mittelpunkt des militärischen Aufgebots.
Als Selbstverwaltungskörperschaften gewannen die holsteinischen Kirchspiele großes Gewicht, besonders im Spätmittelalter. Wie die meisten anderen Kirchspiele schuf sich damals auch die Bevölkerung des Kirchspiels Hademarschen ein eigenes Siegel als Symbol für ihre Einheit und Unabhängigkeit. Das Siegel diente zur Bestätigung und Bekräftigung der Willenserklärungen (Urkunden) der Kirchspielsgemeinschaft.
Erst später, als die Selbstverwaltung des Kirchspiels durch den Einfluss der Amtmänner und Gutsherren auf Hanerau immer mehr beschnitten wurde, hörte auch der Gebrauch eines eigenen Siegels durch die Kirchspielsgemeinschaft auf.
Neben dem Hademarsher Kirchheiligen aus dem alten Kirchensiegel gilt es, ein Symbol für den Ortsteil Hanerau in das Wappen aufzunehmen.
Wie Hademarschen asls Kirchenort so hatte Hanerau als Sitz der Obrigkeit Bedeutung nicht nur für Hanerau sondern für alle damaligen Dörfer des Amtes. Ein eigenes Siegel Hanerau ist nicht feststellbar. Hanerau ist erst seit 1801 ein Ort. Vorher bestand es nur aus dem Gut (Herrenhaus mit entsprechenden Nebengebäuden), weit vorher aus der Burg "Hanerau".
Burgen und Güter hatten in unserem Lande kein eigenes Siegel, sondern sie führten, da ihre Besitzer oft wechselten, immer das Siegel des jeweiligen Burg- oder Gutsherren. Um 1525 wurde Hanerau aus einer königlichen Burgvogtei in ein adeliges Gut umgewandelt. 1799 wurde die Familie Mannhardt Besizer des Gutes. Ihr Wappen zeigt einen Mann mit Wams, der einen jungen Baum in der rechten Hand hält, die Arme des Mannes sind anscheinend gepanzert.
Der Gutsbesitzer Mannhardt gründete 1801 durch Heranziehung von Arbeitern aus seiner Heimat Würtenberg den Ort Hanerau und richtete kleinere Industriebetriebe ein. Dem Gründer von Hanerau zu Ehren ist die frühere Hanerauer Dorfstraße vor einigen Jahrzehnten in Mannhardtstraße umbenannt worden.
Das untere Drittel des Wappens symbolisiert mit der blauen Wellenlinie die Hanerau, d.h. den Wasserlauf, an dem Hanerau gelegen ist.
Der gepanzerte Arm, der im Begriff ist, das Bäumchen in den Boden zu senken, weist auf Mannhardt, den Gründer des Ortes Hanerau und darüber hinaus auch allgemein auf die Gründung von Industriebetrieben und die damit verbundene Kultivierung der Gemarkung durch Menschenhand hin.
Im blau-silbern gespaltenen Schild ein Radtatzenkreuz in verwechselten Farben.
Der auf dem Gemeidegebiet von Hohenwestedt gefundene Schalenstein trägt als kultisches Symbol aus vorgeschichtlicher Zeit ein Radkreuz. Die Bedeutungsvielfalt dieses in das Wappen aufgenommenen Zeichens repräsentiert die Vielschichtigkeit der Ortsgeschichte. In vorchristlicher Zeit mag das Radkreuz als Symbol der Sonne gegolten haben. 1217 wird „Westede” als Kirchort erwähnt; für diese Zeit kann das Radkreuz als christliches Zeichen aufgefasst werden. Die Lage am Kreuzpunkt der „Lübschen Trade” und des „Ochsenweges” verband Hohenwestedt mit den vier Städten Rendsburg, Neumünster, Itzehoe und Heide. Diese vorteilhafte verkehrsgeografische Situation kann ebenfalls im Radkreuz erkannt werden. Im Hinblick auf die neueste Zeit soll das Rad gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt, vertreten durch die sich ansiedelnde Industrie und die rege Bautätigkeit versinnbildlichen. Der geschlossene Kreis um das Kreuz betont daher den Gemeinschaftssinn der Einwohner. Die Schildspaltung und die „Verwechslung” der Farben bringt die hemmenden und fördernden Faktoren zum Ausdruck, deren wechselvolles Zusammenspiel die Entwicklung der Gemeinde bestimmt hat.
Unter goldenem Wellenschildhaupt und über silbernem Wellenschildfuß, darin ein blauer Wellenbalken, in Grün zwei gekreuzte goldene Sensen, darüber zwei gekreuzte silberne Birkenzweige.
Die Gemeinde Meezen liegt im Naturraum "Hohenwestedter Geest" am Rande der "Holsteiner Vorgeest". Der Ortsname Meezen leitet sich her von „Metsin” (1474)- „Metsinge” (1600) und lässt sich mit „Grasland-Wiesenland” deuten. (Quelle:W.Laur, 1992, Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein). Er bezieht sich auf ein ausgedehntes Niederungsgebiet im Nordwesten der Gemeinde, eine eiszeitliche Abflussrinne. Die gestreckte Wellenlinie im Schildhaupt symbolisiert die seichten Hügel in der „Hohenwestedter Geest”. Der blau-weiße Wellenschildfuß bezieht sich auf die Buckener Au im nord-westlichen Gemeindegebiet sowie auf die Teichanlagen im Nordosten. Die gekreuzten silbernen Birkenzweige weisen auf die starke Verbreitung dieser Baumart auf den trockenen Geeststandorten hin sowie auf die feuchten Moorstandorte, aber auch auf die Waldflächen im nord-östlichen Gemeindegebiet, Ausläufer des Naturparks Aukrug. Die gekreuzten Sensen beziehen sich auf den Ortsnamen und erinnern damit an die frühere Nutzung der Wiesen und Weiden zur Heugewinnung. Die Hintergrundfarbe Grün weist auf die ausgedehnten Wald- und Wiesenflächen hin, der goldene Hintergrund auf die Lage der Gemeindein der „Hohenwestedter Geest”.
Von Gold und Grün im Schlangenschnitt leicht gesenkt geteilt, darauf ein vierblättriger Laubbaum in verwechselten Farben.
Die Gemeinde Nienborstel liegt im Naturraum „Hohenwestedter Geest”, am Nordrand der Naturparks Aukrug. Die Landschaft wird geprägt durch eine inselartige aus der Umgebung herausragenden Moräne mit einer Höhe von über 60 m, an die im Norden und Westen das Niederungsgebiet der Eider- Treene- Sorge- Region und im Süden und Osten Auenniederungen angrenzen. Diese besondere topografische Situation soll durch die Wappenteilung symbolisiert werden. Die Gemeinde wird aus 4 Ortsteilen gebildet, nämlich „Barlohe”, „Dörpstedt”, „Hütten” und den Namen gebenden Ortsteil „Nienborstel”. Der 4-blättrige Laubbaum bezieht sich auf die vier Ortsteile und er weist zugleich auf den Waldreichtum dieser Landschaft hin. Die Farbe Grün bezieht sich auf die vielen Waldgebiete in der Gemeinde, das Gold (Gelb) symbolisiert die Geest.
Über grünem Schildfuß ein goldener Hügel auf blauem Grund, überdeckt von einem silbernen, oben offenen und links und rechts in einem Laubblatt endenden Ring, aus dem fünf schmale, nach oben der Hügellinie verstutzte, auf Grün silberne, auf Gold blaue Pfähle wachsen.
Das Nindorfer Wappen bezieht sich auf die Landschaftliche Lage in Schleswig-Holstein.
Das gelbe Dreieck steht für die Lage auf einem Höhenzug, für die Wasserscheide und stellt die fünf Quellen dar, die die Umgebung mit Wasser versorgen.
Die Eichenblätter stehen für die Doppeleiche im Dorfzentrum sowie für die waldreiche Umgebung.
Die Farben Blau/Weiß symbolisieren den Schleswig-Holsteinischen Himmel, Gelb und Grün für Feld und Land.
Von Blau und Grün durch zwei silberne Wellenbalken leicht gesenkt geteilt, oben eine silbern-schwarze Kettenfähre, unten drei silberne Häuser 2:1.
Die Gemeinde Oldenbüttel liegt auf einer Bodenerhebung, die ringsherum von Niederungen und Mooren umgeben ist.
Prägend für das Ortsbild der Gemeinde Oldenbüttel sind die Niederungen des Eiderflussgebietes mit der Gieselau und insbesondere der im Jahre 1895 fertig gestellte Nord-Ostsee-Kanal.
Durch den Nord-Ostsee-Kanal wurden die Gebiete der Gemeinde Oldenbüttel getrennt.
Im Norden des NOK liegt der Ortsteil Bokelhoop und im Süden der Ortskern Oldenbüttel sowie der Ortsteil Bokhorst.
Die Verbindung über den NOK wird durch eine Fähre aufrechterhalten, die bis zur Verbreiterung im Jahre 1990 als Kettenfähre betrieben wurde.
Der obere Bereich des Gemeindewappens der Gemeinde zeigt auf blauem Grund die ehemalige Kettenfähre geteilt durch zwei silberne Wasserlinien für die Eider und den Nord-Ostsee-Kanal.
Im unteren Bereich des Wappens symbolisiert der grüne Grund die Landwirtschaft und Natur in der Gemeinde Oldenbüttel und die drei Häuser stehen für die drei Ortsteile, aus denen der Ort Oldenbüttel entstanden ist.
Von Grün und Gold im Wellenschnitt schrägrechts geteilt. Oben eine zur Teilung schwebende, halbe goldene Sonne, unten ein zwei zur Teilung fächerförmiggestellte grüne Weißdornblätter mit einem zum Schildfuß weisenden mit roten Früchten versehenen grünen Zweig.
Die Gemeinde Osterstedt liegt im Naturraum Hohenwestedter Geest. Die goldene Hintergrundfarbe soll darauf hinweisen. Das Gemeindegebiet wird durchquert von der osterstedter Au, die die besiedelte Ortslage in zwei Ortsteil teilt: Im Süden der Ortsteil Alsen und im Nord das namensgebende Osterstedt. Die Wappenteilung soll diese historisch gewachsene Situation beschreiben. Der Ortsteil ist mit "Östliche Stätte, Wohnstätte, östlicher Wohnplatz" zu deuten(W.Laur, 1992). Die aufgehende Sonne bezieht sich auf die Ortsnamendeutung. Der Weißdorn gehört zu den am häufigsten vorkommenden Straucharten der Landschaft um Osterstedt, die geprägt wird von den landschaftstypischen Knicks. Er symbolisiert eine von Knickwällen vielfältig strukturierte bäuerliche Kulturlandschaft. Das Grün im Schildhintergrund bezieht sich sowohl auf die Landschaft als auch auf die ehemalige Bedeutung der Landwirtschaft.
In Silber ein blauer Wellenbalken, begleitet oben von einem bewurzelten grünen Eichbaum, unten von einem roten Hufeisen mit den Stollen von oben.
Die Gemeinde liegt am Oberlauf der Stör, auf die der Wellenbalken im Wappen hinweist. Die Eiche zeigt den für die Landschaft um Padenstedt charakteristischen Baumbewuchs, während das Hufeisen als Symbol für die Bedeutung der Landwirtschaft in der Vergangenheit gewählt wurde.
Über goldenem, durch einen blauen Wellenbalken abgeteilten Schildfuß in Grün eine silberne Spitze, darin ein rotes Mühlenrad mit schwarzer Radnabe. Oben rechts zwei goldene Ähren, oben links ein goldener Pferdekopf.
Der Ortsname Rade leitet sich her von „Rade=Rodung” (W. Laur), Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein, 1992). Die silberne Spitze im Schildhaupt bezieht sich auf die Deutung der Ortsnamen und symbolisiert eine keilförmig in den Wald eingeschlagene Siedlungsfläche. Das rote Mühlenrad erinnert an die Rader Mühle, eine durch das dänische Königreich privilegierte Zwangsmühle. Das Rot des Mühlenrades auf weißem Grund entspricht den dänischen Landesfarben, die 14 Schaufeln beziehen sich auf 14 Dörfer, die dieser Zwangsmühle unterlagen. Der blaue, aus drei Wellenbestehende Wellenfadenweist sowohl auf den Mühlenbach als auch auf die drei ehemaligen Mühlenteiche hin, durch welche die Rader Mühle angetrieben wurde. Der gelbe (goldene) Schildfuß bezieht sich auf die Lage der Gemeinde am Rande der Hohenwestedter Geest. Das Pferd nimmt Bezug auf die Pferdezucht, die in Rade eine lange Tradition hat. Die Kornähren weisen auf die einseitige Bedeutung der Landwirtschaft hin.
Unter gebogenem goldenen Schildhaupt in Grün ein silberner Wasserturm mit einem roten in das Schildhaupt ragenden Dach, begleitet rechts und links von je einem silbernen Ahornblatt, darunter ein goldenes Posthorn.
Die Gemeinde Remmels liegt im Naturraum Hohenwestedter Geest, inmitten einer von Laubwäldern, Wiesen und Äckern geprägten bäuerlichen Kulturlandschaft. Die Farben Gelb (Gold) und Grün sollen darauf hinweisen.
Das weithin bekannte Wahrzeichen von Remmels ist der Wasserturm. Dieser bildet die Hauptfigur des Wappens. Er wird von den Gemeindewerken Hohenwestedt gespeist und versorgt die Gemeinde Remmels mit Trinkwasser.
Der Ortsname Remmels läßt sich mit „Hain, lichtes Gehölz" übersetzen. (W. Laur.1992) Zwei silberne Ahornblätter sollen die Namensgebung symbolisieren.
Das Posthorn bezieht sich auf die Postgeschichte dieses Ortes. Als im Jahre 1762 eine Poststation zwischen Itzehoe und Rendsburg errichtet wurde, entschied man sich für den Standort in Remmels. Noch heute ist man mit Recht stolz darauf, dass der Poststempel der benachbarten, viel größeren Gemeinde Hohenwestedt damals „Hohenwestedt bei Remmels" lautete.
Von Blau und Grün durch einen schrägen silbernen Wellenbalken leicht gesenkt geteilt, oben ein oberhalbes silbernes Wagenrad, unten eine goldene Haferähre und ein goldenes Lindenblatt mit einem Samenstand.
Die Gemeinde Seefeld liegt im südlichen Bereich des Kreises Rendsburg-Eckernförde im Naturraum Hohenwestedter Geest. Das nördliche Gemeindegebiet liegt in der Eider-Treene-Niederung unweit des Nord-Ostsee-Kanals. Der Ort fand seine erste urkundliche Erwähnung im Jahre 1447. 1633/34 erhielt er zunächst den Ortsnamen Sehefelde und 1649 Seefelt = „Feld am See“. Mit dem Bau des Nord-Ostsee-Kanals und umfangreichen Entwässerungsmaßnahmen wurde der See trocken gelegt und die Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt. Der Ortsname Seefeld hat sich dennoch bis heute erhalten. Die überwiegend landwirtschaftlich geprägte Gegend ist eingebettet in die leicht hügelige Knicklandschaft Schleswig-Holsteins. Das Dorfbild wird geprägt durch seinen schönen alten Baumbestand, in der die Linde von besonderer Bedeutung ist. Das halbe Wagenrad sowie die Haferähre beziehen sich auf die historische Bedeutung der Landwirtschaft.
Unter silbernen, durch einen blauen Balken abgeteilten Schildhaupt, darin drei grüne Feldsteine, von Silber und Grün zehnmal gestützt - fächerförmig gespalten.
Der Wappeninhalt wird aus den beiden Namensbestandteilen "Steen" 0 Stein und "feld" = Felder dargestellt.
Die drei Steine im Schildhaupt symbolisieren die drei Ortsteile Pemeln, Liesbüttel und Steenfeld.
In der unteren Wappenhälfte wird die Ackerflur in Form von grün-weiß "geständerten" Streifen dargestellt.
Zwischen Steinen und Ackerflur verweist ein blauer Balken auf die Nähe zum Nord-Ostsee-Kanal.
Das "Grün" symbolisiert die Bedeutung der Landwirtschaft.
Das Wappenschild ist dreigeteilt. Oben ein gestäbter roter Zinnenbalken mit sechs Zinnen auf silbernem Grund, unten ein blauer Schlüssel auf silbernem Grund. In der Mitte eine goldene Krone auf rotem Grund.
Die Gestaltung des Wappens geht auf eine Sage zurück. Sie erzählt von einem König, der einen Goldklumpen in einer verschlossenen Lade aufbewahrte, den er zuvor von seinem Diener als Geschenk erhielt.
Der Flurname „Goldberg" in der Gemarkung Tappendorf weist auf ein Goldstück hin, das in der Gemeinde gefunden wurde, und das mit der o. g. Sage in Zusammenhang gebracht wird.
Die Mauerzinne, die goldene Krone und der Schlüssel sollen an diese Sage erinnern.
In Silber auf einem grünen Hügel, darin ein goldener Zuber (Himpten), drei grüne Buchen.
Die Gemeinde Thaden verweist in ihrem Wappen auf die zahlreichen Hühnengräber im Gemeindegebiet durch ein mit Buchen bestandenes Hühnengrab. Im unteren Feld erinnert ein in Gold gehaltener Himpten auf die Lieferungen von Korn und anderer landwirtschaftlicher Güter an Hanerau und Schenefeld.
Von einem Wellenschnitt schräglinks geteilt oben in Blau ein silbernes Eichenblatt, unten in Silber ein blaues Eichenblatt.
Die Gemeinde Todenbüttel entstand aus dem Zusammenschluß der Orte Todenbüttel und Maisborstel. Der Wellenschnitt weist hin auf die Todenbütteler Au, die Eichenblätter stehen für den Rendsburger Wald.
In Gold ein erhöhter schräglinker durchbrochener blauer Wellenbalken, ober rechts ein rotes Rad, unten links über einem im Schildfuß wachsenden grünen Palisadenzaun eine grüne Binse.
Wapelfeld liegt in der Hohenwestedter Geest. Die Grundfarbe Gelb (Gold) bezieht sich auf die naturräumliche Lage der Gemeinde.
Durch das Gemeindegebiet fließt die Wapelfelder Au. Beidseitig der Au haben sich zwei Ortsteile entwickelt, die in sich geschlossen sind. Die beiden Figuren, Rad und Binse, beidseitig des Wellenbalkens, sollen dieses symbolisieren.
Der historische Landweg von Hohenwestedt nach Schenefeld führte durch die Gemeinde und querte die Wapelfelder Au über eine Brücke. Hierbei handelte es sich um eine der ersten Brücken im ehemaligen Amt Rendsburg.
Der durchbrochene Wellenbalken soll an diese historisch bedeutsame Brücke erinnern.
Das Rad symbolisiert den alten Landweg und es erinnert zugleich an die einstige Kreisbahnstrecke, die durch Wapelfeld führte.
Die Binse bezieht sich auf die Namensdeutung. Der Ortsname leitet sich her von Wapelfelde = „Feld am stehenden Wasser; am Sumpf“. (W. Laur 1992)
Im südlichen Gemeindegebiet auf einer kleinen Höhe an der Wapelfelder Au, auf der jetzigen Burgkoppel wurde im 13. Jahrhundert durch den Grafen Johann eine Burg erbaut.
Es wird berichtet, dass im Jahre 1248 der holsteinische Landtag in Wapelfeld tagte und dass der Dänenkönig Erich die versammelten Holsteiner überfiel und gefangen nahm. Es wird vermutet, dass dieses der Grund für den Grafen Johann war, hier eine Schutzburg zu bauen, um sich gegen solche räuberischen Überfälle zu schützen. Ob diese Burg jemals fertiggestellt wurde, scheint fraglich, denn schon im Jahre 1249 wurde sie wieder zerstört.
Die grüne Palisadenreihe im Schildfuß soll die ehemalige Schutzburg symbolisieren und an diese bewegte Zeit der Dorfgeschichte erinnern.