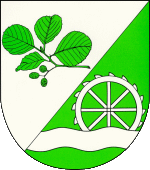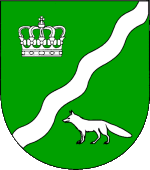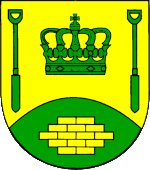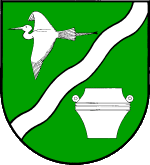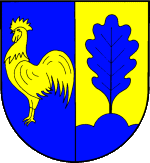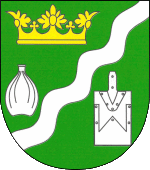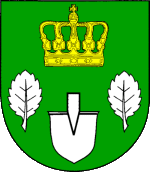In Gold ein erhöhter grüner Dreiberg, geteilt von einem goldenen Schrägwellenbalken, oben ein goldenes Eichblatt, unten eine goldene Urne.
Das Wappen wurde „redend” gestaltet. Nach Feststellung des Forschers für die Herkunft der Ortsnamen in Schleswig-Holstein, Wolfgang Laur, leitet sich der Name Bargstall von „Erhöhung, erhöhter Platz” als eine Zusammensetzung von nd. Barch = „Berg” und Stähl = „Erhöhung” ab.
Während der Schrägwellenbalken den Fluss der Eider, der das Leben der Bewohner von Bargstall in der Vergangenheit nachhaltig geprägt hat, symbolisiert, steht das Eichenblatt für den früheren Waldreichtum im Gemeindegebiet.
Die Urne soll auf einen Urnenfriedhof aus der Jungsteinzeit hinweisen, der im Gemeindegebiet gefunden wurde, aber wegen fehlender Kenntnis von Konservierungsmaßnahmen verschwunden ist. Das Vorhandensein von Urnengräbern aus der Jungsteinzeit ist ein Beleg dafür, dass das Gelände der Gemeinde bereits vor ca. 4000 Jahren besiedelt war.
Für das Wappen wurde das Metall Gold, sowie die Farbe Grün festgelegt. Während Gold aus ästhetischen und heraldischen Gründen gewählt wurde, soll die Farbe Grün auf die Landwirtschaft und den ländlichen Raum, in dem die Gemeinde liegt hinweisen.
In Blau zwischen zwei silbernen Wellenbalken nebeneinander drei bewurzelte silberne Eichbäume.
Die drei nebeneinanderstehenden Eichbäume im Wappen der Gemeinde bringen den Ortsnamen bildlich zum Ausdruck. Breiholz ist, volksetymologisch gedeutet, die verkürzte Form von „breites Holz”; deshalb nehmen die Bäume im Wappen die gesamte Schildbreite ein. Der Name ist auf die vormals waldreiche Umgebung des Ortes zurückzuführen.
Die beiden Wellenbalken des Wappens bezeichnen die geographische Lage der Gemeinde zwischen Eider und Nord-Ostsee-Kanal. Die Anbindung an die Eider hat das Wirtschaftsleben des Ortes entscheidend gefördert. Breiholz soll aus einer Fischersiedlung hervorgegangen sein. Bis in das vorige Jahrhundert wurde von hier aus eine rege Schiffahrt betrieben, wozu eine im Ort gelegene Schiffswerft beitrug.
Neben dem Transportverkehr auf der Eider fuhren Schiffe aus Breiholz nach England, Holland, Hamburg und den Ostseehäfen. Durch die Eider und viele kleinere Wasserläufe waren die Bewohner häufig Überschwemmungen ausgesetzt, die insbesondere die Viehhaltung beeinträchtigten. Die Verbindung zum Umland war deshalb zuweilen unterbrochen. Dies wird durch die blaue Schildfarbe angedeutet.
In Grün ein goldener rechter Bogenpfahl, rechts begleitet von einem goldenen Torfmesser und links von einer goldenen Bügelkrone.
Mit dem goldenen, rechten Bogenpfahl soll der Anfangsbuchstabe C des Ortsnamens Christiansholm angedeutet werden.
Das Torfmesser steht für die Kultivierung der Moorgebiete im Gemeindegebiet.
Die goldene Bügelkrone soll auf den dänischen König hinweisen, der die Anordnung für die Kolonisierung der Moor- und Heidegebiete im Landesteil Schleswig gab und dessen Namen der Ort trägt.
Die Farbe Grün wurde gewählt, um auf den landschaftlichen Charakter des Gemeindegebietes und die Landwirtschaft, die in der Vergangenheit die Haupternährungsquelle der Menschen im Ort war, hinweisen.
Die Farbe (Metall) Gold wurde aus ästhetischen Gründen festgelegt.
Schräglinks geteilt von Silber und Grün; oben ein früchtetragender Erlenzweig, unten ein im unteren Viertel von einem Wellenbalken überdecktes Mühlrad in verwechselten Farben.
Der geteilte Wappenschild bezieht sich auf die im Jahre 1867 erfolgte Vereinigung der beiden Orte Elsdorf und Westermühlen zu einer Gemeinde.
Oben wird Elsdorf im Hinblick auf die ältere Namensform „Elerstorppe” „redend” ins Bild gesetzt. Die erste Silbe ist dabei volksetymologisch als die niederdeutsche Form der Erle, „Eller”, gedeutet. Die wissenschaftliche Namensdeutung sieht in dem Ort richtiger „das Dorf des Eler” und leitet den Ortsnamen damit von einem gleichnamigen Gründer oder Besitzer ab. Mit Rücksicht auf eine eingängige Deutung mag die Rückführung auf die geläufige, den Landschaftsraum charakterisierende Erle zeitgemäßer sein. Zusätzlich ist der Erlenzweig ein Hinweis auf die im Gemeindegebiet gelegenen, früher königlichen Gehege „Osterhamm” und „Mittelhamm”.
Westermühlen verfügte bis ins 20. Jh. über eine durch die Familie des Dichters Theodor Storm bekannte Wassermühle, die dem Ort den Namen gegeben hat. Das Mühlrad in der unteren Wappenhälfte steht deshalb „redend” für den Ortsnamen und zugleich für dieses gewerbliche Unternehmen. Der Wellenbalken vertritt die Mühlenau.
In Grün ein schräglinker silberner Wellenbalken, begleitet oben von einer silbernen Königskrone und unten von einem stehenden silbernen Fuchs.
Die silberne Krone soll auf den dänischen König Friedrich V. hinweisen, auf dessen Befehl im 18. Jahrhundert die Moor- und Heidegebiete in Schleswig-Holstein kolonisiert wurden. Nach ihm wurde das Kolonistendorf Friedrichsgraben benannt.
Der Wellenbalken symbolisiert den Fluss Eider, der das Leben der Bewohner des Ortes in der Vergangenheit nachhaltig geprägt hat und auch in der Gegenwart und in der Zukunft auf dem Gebiet des Tourismus beeinflussen wird.
Der Fuchs deutet auf ein Flurstück im Gemeindegebiet hin, das „Fuchsberg” genannt wird und den Ort in der Umgebung bekannt macht.
Für das Wappen wurden das Metall Silber sowie die Farbe Grün festgelegt. Während Silber aus ästhetischen und heraldischen Gründen gewählt wurde, soll die Farbe Grün auf die Landwirtschaft und den ländlichen Raum, in dem die Gemeinde liegt, hinweisen.
In Gold über einem grünen Hügel eine grüne Königskrone, beiderseits begleitet von einem grünen Torfmesser. Der grüne Hügel ist belegt mit einem Mauerteil bestehend aus 14 goldenen Ziegeln 2 : 3 : 4 : 3 : 2.
Die Königskrone des Wappens führt auf die Gründungszeit der Gemeinde zurück, die zur Erschließung der Moor- und Heidegebiete nördlich der Eider des 18. Jahrhunderts als Kolonistendorf eingerichtet und nach dem regierenden König Friedrich V. von Dänemark als Landesherrn benannt wurde.
Das Grundwort des Ortsnamens -holm verweist auf eine Erhebung in einer Niederung, die durch den Hügel im Schildfuß des Wappens ausgedrückt wird. Auf die Torfvorkommen in dem Gemeindegebiet nehmen die beiden Torfmesser Bezug, während die Ziegelsteine im Schildfuß den ehemaligen Ziegeleibetrieb im Gemeindebezirk belegen.
Für das Wappen wurden die Farben Gold und Grün gewählt. Während das Gelb des Schildes und der Ziegelsteine auf die Bedeutung der Ziegelei hinweisen, betont das Grün der Wappenmotive und des Schuldfußes die Situation des ländlichen Raumes und das Gewicht der Landwirtschaft, die das Gemeindeleben bis heute prägen.
In Grün ein schräglinker silberner Wellenbalken, begleitet von einem fliegenden silberner Reiher, unten von einer silbernen Urne.
Der silberne Wellenbalken bezieht sich auf die Lage der Gemeinde Hamdorf an der Eider. Der erste Namensbestandteil ist eine verkürzte Form des Wortes „Hamme” und bedeutet wohl „tiefgelegenes Land am Fluß”, dargestellt durch das Grün der den Wellenbalken rahmenden Schildfarbe. Der Ortsname wäre demnach teilweise eine Kurzbeschreibung der Topographie.
Der fliegende Reiher zeigt an, dass es in der Gemeinde eine größere Brutkolonie dieses Vogels gibt, dessen Zahl auch in Schleswig-Holstein rückläufig ist. Frühgeschichtliche Funde in Form von Brandgräbern, vertreten durch die Urne im Wappen, belegen eine Besiedlung lange vor der ersten urkundlichen Nennung des Ortes im Jahre 1285. Die grüne Schildfarbe ist auch als Hinweis auf den Haupterwerbszweig, die Landwirtschaft, aufzufassen.
Gespalten von Blau und Gold. Vorn ein Hahn, hinten ein wachsender, oben mit einem Eichenblatt besteckter blauer Dreiberg in verwechselten Farben.
Die niederdeutsche Aussprache des Wortes Hahn ist „Hohn”. Diese Klanggleichheit mit dem Ortsnamen wurde dem Wappeninhalt zugrunde gelegt. Die Figur des Hahnes gibt also in volkstümlicher Deutung den Namen der Gemeinde Hohn bildlich wieder, deren Wappen sich damit als „sprechendes” ausweist.
Sprachwissenschaftlich ist die Ortsbezeichnung auf eine „Höhe” zurückzuführen, was der Dreiberg in der hinteren Wappenhälfte zum Ausdruck bringt. Zugleich ist er in Verbindung mit dem Eichenblatt eine stilisierte Wiedergabe des „Eichberges”, einer markanten Anhöhe auf dem Gemeindegebiet.
Historisch bemerkenswert ist die Kirche im Ort, welche König Christian V. zwecks Erweiterung des Rendsburger Festungswerks in Kampen abtragen und in Hohn 1692-93 wieder aufbauen ließ. Die Farben Blau und Gold sind an die Farben Schleswigs angelehnt und dokumentieren die Zugehörigkeit zu diesem Landesteil.
Unter eingebogenem silbernem Schildhaupt in Grün eine goldene Krone, begleitet rechts von einem schwebenden silbernen Torfmesser und links von einem schwebenden silbernen Torfsparten, darunter ein silberner Wellenbalken mit einem silbernen Boot.
Das Wappen wurde „redend” gestaltet. Die Krone symbolisiert den Gründer der Gemeinde, den dänischen König Friedrich V., der die Kolonisierung der Moor- und Heidegebiete nördlich der Eider in der Mitte des 18 Jahrhunderts angeordnet hat.
Die beiden Werkzeuge, das Torfmesser und der Torfspaten, stehen stellvertretend für das Moor, das Anlass zur Besiedelung der Landschaft war, und für die Torfvorkommen im Gemeindegebiet, die in den zurückliegenden Jahrhunderten ein wichtiger Erwerbszweig für die Gemeinde darstellten.
Das Boot weist auf das wichtigste Transportmittel hin, das in diesem Moorgebiet in der Vergangenheit den Menschen zum Transport von Torf und anderen schweren Lasten zur Verfügung stand.
Der Hügel soll auf den zweiten Teil des Ortsnamens hinweisen.
Für das Wappen wurden die Metalle Silber und Gold sowie die Farbe Grün festgelegt. Während Silber und Gold aus ästhetischen Gründen gewählt wurden, soll die Farbe Grün auf die Landwirtschaft und den ländlichen Raum in dem die Gemeinde liegt, hinweisen.
In Grün ein silberner schräg-linker Wellenbalken, oben ein silberner dreiblättriger Eichenzweig, unten zwei gekreuzte aufrechte silberne Schwerter.
Die drei Eichenblätter stehen für die drei Orte, die die Gemeinde heute bilden: Lohe, Föhrden und Sorgbrück. Darüber hinaus sollen die Eichenblätter auch auf den Namen des Ortsteils Lohe hinweisen, der mit kleinem Wald oder Eichenwäldchen gedeutet wird.
Die gekreuzten Schwerter sollen auf die Geschichte der Gemeinde hinweisen und daran erinnern, dass in der Vorzeit zahlreiche Kämpfe in der „Lohheide” stattgefunden haben, wie Heinrich Rantzau 1595 berichtete, und auf den Nordischen Krieg, der 1712 teilweise in der Lohheide stattgefunden hat.
Der Wellenbalken steht für den Fluss Sorge, der für das Gemeindegebiet prägend ist und auf den sich der Ortsname Föhrden = Furt bezieht.
Für das Wappen wurden die Farben Silber und Grün bestimmt. Während Silber aus ästhetischen Gründen gewählt wurde, steht die Farbe Grün für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum, in dem die Gemeinde liegt.
In Grün ein schräglinker silberner Wellenbalken, begleitet oben von einer goldenen Krone, unten von einem silbernen hölzernen Torfspatenblatt mit eiserner Bewehrung. Unter der Krone ein enghalsiges, bauchiges Gefäß.
Der silberne Wellenbalken deutet auf die Lage der Gemeinde an der Eider hin. Die goldene Krone (offene Adelskrone ohne Rangbedeutung) weist redend auf den Namen des Ortes hin.
Die bauchige Flasche erinnert an die im 19. Jahrhundert in Prinzenmoor vorhandenen Glashütten. Der aus der Gemeinde stammende Torfspaten soll auf die großen Torfvorkommen im Gemeindegebiet hinweisen, die der Anlass für die Gründung des Ortes im Rahmen der Moor- und Heidekolonisierung waren und die Ansiedlung der Glashütten ermöglichten.
Für das Wappen wurden die Farben Grün, Gold (Gelb) und Silber (Weiß) gewählt. Damit soll auf die Lage im ländlichen Raum und auf die dort betriebene Landwirtschaft hingewiesen werden.
In Grün unter einer goldenen Königskrone ein silbernes Spatenblatt, beiderseits erhöht begleitet von einem silbernen Buchenblatt.
Die goldene Krone soll auf die Namensgeberin der Gemeinde Sophienhamm hinweisen, die dänische Königin Sophie-Magdalena (1700-1770)
Der Spaten steht für das Kolonistendorf im Moor und die Buchenblätter sollen die Hamme, hier als Wald definiert, symbolisieren.
Für das Wappen wurden die Farben Grün, Gold/Gelb und Silber/Weiß gewählt. Damit soll auf die Hamme und die königliche Namensgeberin hingewiesen werden. Silber/Weiß wurde aus ästhetischen Gründen gewählt.