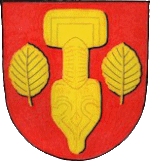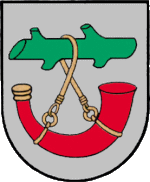in rot ein silberner Balken, überdeckt von einem dreiblättrigen „Eichenring“.
Dieses eigentümliche und unverwechselbare Wappenschild deutet auf den Eichberg von Gielde und auf die noch sichtbaren Wälle der Kukeriulenburg, die auch Sachsenring genannt werden. Der Balken hält die Erinnerung an das erloschene Geschlecht von Gielde wach, das ihn in der Helmzier seines Wappen führte. Die Farben Rot-Gold weisen auf die maßgebliche Rolle, die das Fürstenbistum Hildesheim, eines der wichtigsten Rivalen der Welfen in unserem Gebiet, Landesherr in der Ortsgeschichte gespielt hat. Das Wappen wurde am 31. März 1960 durch Ratsbeschluss der damals noch zum Kreis Goslar gehörenden Gemeinde beschlossen und am 30. Juni desselben Jahres vom braunschweigischen Verwaltungspräsidenten genehmigt.
In Rot ein silberner Löwe.
Der silberne Löwe im roten Feld ist derjenige der Edelherren von Dorstadt, die sich seit 1175 Grafen von Schladen nannten, nachdem sie den Hof Schladen, der aus dem Wirtschaftsbezirk der alten Kaiserpfalz Werla hervorgegangen war, 1110 vom Bischof von Hildesheim zu Lehen erhalten hatten. Im Jahr 1362 ist dieses Dynastengeschlecht ausgestorben.
Ein Wappenlöwe aber lebt nicht nur im Schladener Wappen fort, sondern auch im Goslarer Kreiswappen.
Ortsteile von Schladen
In Rot eine goldene Fibel zwischen zwei goldenen Buchenblättern.
Der Ortsname, 1174 „Boketho“, bedeutet „Buchenstätte“. Darum zieren zwei Buchenblätter stellvertretend und seinen untergegangenen Schwesterort, den roten Schild. Gold-Rot waren die Farben des Fürstbistums Hildesheim, zu dem Beuchte annähernd sieben Jahrhunderte lang bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts in landesgeschichtlicher Hinsicht gehört hat. Die Fibel verweist auf einen bedeutenden archäologischen Fund, auf die heute im Braunschweigischen Landesmuseum verwahrte „Beuchter Fibel“, eine feuervergoldete silberne Gewandschnalle als Grabbeigabe aus dem 5. Jahrhundert, die bei Ausgrabungen in der Beuchter Feldmark gefunden wurde. Sie bezeugt, dass Beuchte schon in der Merowingerzeit besiedelt war.
Das Wappen wurde auf einer Bürgerversammlung zu Beuchte am 1. März 1999 mit großer Mehrheit als Ortswappen angenommen.
In Rot ein oberhalbes silbernes Mühlrad über einem wachsenden silbernen Rodestuken.
Die zweite Hälfte des Ornaments zeigt an, dass es sich um einen Rodungsort handelt. Der Stuken versinnbildlicht mithin die Gründungsgeschichte von Isingerode. Im Ort gibt es zwei Wassermühlen, die Steinfelder Mühle und die Mühle in Isingerode, die zeitweilig von überörtlicher wirtschaftlicher Bedeutung war. Sie werden durch das Mühlrad vertreten. Isingerode unterscheidet sich von den sonstigen Orten im Kreis Wolfenbüttel dadurch, dass es ursprünglich nicht zum Land Braunschweig gehörte, sondern zum Fürstbistum und danach zum Kreis Halberstadt. Deren weiß-rote Wappenfarben sind deshalb auch die Farben von Isingerode.
Das Wappen wurde am 18. Oktober 1999 von einer Bürgerversammlung angenommen.
Die Wehrhaftigkeit des Ortes dokumentiert das Wappen von Wehre. Das vom Zeichner Wilhelm Krieg entworfene Wappen lehnt sich an das Wappen der um 1370 ausgestorbenen Herren von Wehre an, die einen Schild von Eisenhutfeh führen. Feh ist ein grafisch abstrahiertes Pelzwerk. Wegen seiner Ähnlichkeit mit einem Helm wurden die Teilstücke Eisenhüte genannt.
In silber ein querliegender gestümmelter grüner Ast, an dem an goldener Fessel ein goldbeschlagenes rotes Jagdhorn hängt.
Dass das Aussehen des Hamburger Wappens in früheren Jahrhunderten nicht einheitlich war, ist nicht verwunderlich, denn so verhält es sich bei vielen Städten mit älteren Wappen, die nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt verliehen worden sind, sondern sich "von selbst" entwickelt haben. Zentrales Motiv war jedenfalls immer das Horn, das volksetymologisch den Stadtnamen "redend" deutlich macht, obwohl es wahrscheinlich nicht "Horn-Burg" bedeutet, sondern von einer altdeutschen Bezeichnung für „Sumpf“ abzuleiten ist (wegen der Lage am Großen Bruch).
Die älteste nachgewiesene Darstellung (1552) findet sich am Dammtor, wo das Horn noch nicht an einem Ast hängt und der Schild von Eva und Adam gehalten wird. Im Siegel der Ratsmänner zu Hornburg aus dem späteren 16. Jahrhundert hängt das Horn bereits an einem gestümmelten Ast. In späteren Siegeln wechselt die Stellung des Horns, wobei dieser Umstand eher zufällig ist.
Die Farben wurden erst 1903 vom Heraldiker Otto Hupp in seinem Werk über die deutschen Ortswappen festgelegt: In Silber ein querliegender gestümmelter grüner Ast, an dem an goldener Fessel ein goldbeschlagenes rotes Jagdhorn hängt. Diese Farbgebung wurde von der Stadt 1969 als richtig anerkannt.
Kurioserweise bediente sich aber die Stadtverwaltung in ihren Briefköpfen einer ganz anderen Variante des Wappens, die erst um die Jahrhundertwende aufgekommen ist und die Stadtfarben GrünRot (abgeleitet von dem Ast und dem Horn) in den Schild "eingearbeitet" zeigt: Von Rot über Grün schräggeteilt mit einem goldenen Horn (das zuweilen an einem goldenen Pfeil hängt) nebst schwarzer bzw. goldener Fessel. So befindet sich das Wappen auch am Rathaus; das hier silberne Horn hängt mit goldener Schnur an einem braunen Ast. Diese Variante war durch eine örtliche Zeitung aufgebracht worden, ohne dass ihr ein amtlicher Charakter zukam. Dass sie sich bis heute neben der richtigen gehalten hat, ist wohl auf die Popularität der Stadtfarben bei den Vereinen zurückzuführen. Da die beiden Wappen sich aber weit über das Maß der zulässigen Variabilität in der grafischen Gestaltung hinaus unterscheiden, da es eben zwei gänzlich verschiedene Wappen sind, hat der Rat der Stadt Hornburg am 30.01.1990 dieses Wappen bestimmt.
Von Gold und Blau im Zinnenschnitt geteilt. Obnen ein blauer Adler, unten ein goldener Schrägbalken.
Werlaburgdorf kann für sich den Ruhm in Anspruch nehmen, einmal eine Hauptstadt des Deutschen Reiches gewesen zu sein oder dieselbe zumindest innerhalb seiner heutigen Gemeindegrenzen beherbergt zu haben, nämlich die erst in jüngerer Vergangenheit wiederentdeckte und in den Grundmauern ausgegrabene Kaiserpfalz Werla. Die deutschen Könige und Kaiser des Hochmittelalters hatten keine feste Residenz, sondern zogen ständig umher. Wo sie gerade Hof hielten, dort war dann eben der Mittelpunkt des Reiches, so wie Werla es unter den sächsischen und salischen Herrschern des öfteren war. Der rot bewehrte, blaue Adler, der im oberen goldenen Feld aus drei blauen Zinnen (sie symbolisieren die Pfalz) wächst, ist demzufolge kein anderer als der deutsche Adler, obwohl man ihm das wegen seiner Färbung nicht auf den ersten Blick ansieht. Eigentlich müsste er schwarz sein, aber die Werlaburgdorfer bestanden auf Blau-Gelb als Wappenfarben, um ihre Anhänglichkeit an das Braunschweiger Land zu bekunden. Der goldene Schräglinksbalken im unteren, blauen Feld ist dem Wappen des ausgestorbenen Geschlechts von Burgdorff entnommen. Der Rat nahm das Gemeindewappen in Zusammenhang mit der Änderung des Namens von „Burgdorf“ in „Werlaburgdorf“ am 9. Oktober 1958 an, und der braunschweigische Verwaltungspräsident genehmigte es am 26. November desselben Jahres.