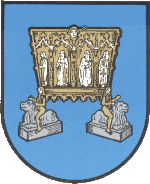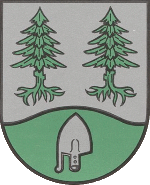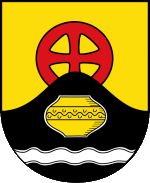In Rot über wachsendem, goldenen Löwen ein liegender, rechtsgewendeter silberner Schlüssel.
Das Wappen erinnert an das Siegel des ehemaligen Amtes Bederkesa. Der Schlüssel ist dem Wappen der Stadt Bremen entlehnt, der das Amtsgebiet - zum Teil seit 1381 – bis 1654 gehört hat.
In Blau auf zwei silbernen liegenden, abgewandten Löwen zwei zottige, goldene Männer, ein goldenes gotisches Taufbecken auf ihren Schultern tragend.
Es ist nicht genau geklärt, ob der Name von „de Ebbestätte“ oder von dem Personennamen „Dibbo“ herrührt. Es ist das älteste Kirchdorf in der Stadt Langen. Die Feldsteinkirche besteht seit dem 12. Jh. Im Innern der Kirche befindet sich eine besondere Kostbarkeit, ein prächtiges Taufbecken aus dem Jahre 1497. Nach zwei Großbränden in den Jahren 1847 und 1912 erhielt Debstedt ein neuzeitliches Gesicht. Der Wiederaufbau zog sich bis 1914 hin. Die Kirche war bereits am 4. Advent 1913 fertig; die Schule erst 1914. Bis dahin wurde notdürftig in einem Bäckerladen unterrichtet.
Bis zum Jahre 1852 bildeten die Kirchspiele Debstedt und Holßel den Verwaltungsbezirk „Börde Debstedt“; beide gehörten zum Amt Bederkesa. Heute gehören dem Kirchspiel nur noch Debstedt, Sievern und Wehden an. Bis vor einigen Jahren waren noch Langen, Spaden und Laven dabei. Debstedt gehörte von 1971 bis 1974 zur Samtgemeinde Langen; nach der Gebiets- und Verwaltungsreform ab 1. März 1974 zur Gemeinde Langen, ab 1. Juli 1990 Stadt Langen.
In den Jahren 1959-1962 entstand auf der „Schwarzen Höhe“ das große Krankenhaus „Seepark“ des DRK, das vor ein paar Jahren wesentlich vergrößert wurde. Im Jahre 1974 erhielt Debstedt den Anschluß an das Autobahnnetz. Es siedelten sich einige neue Gewerbebetriebe und die Autobahnmeisterei und -polizei an.
In Silber zwei schwebende bewurzelte grüne Tannen über einem grünen Hügel, belegt mit einem goldenen, silbergehörnten Ochsenkopf; der Hügel über einem silbernen Schildfuß.
Die Tannen sind Sinnbilder des Drangstedter Forstes. Der Hügel erinnert an die Steingräber und deren Schutzhügel. Der Ochsenkopf über dem silbernen Schildfuß weist auf die Deutung des Ortsnamens als Viehtränke hin.
Das Wappen der Gemeinde Elmlohe zeigt in blau drei goldene Ulmenblätter 2:1 zwischen zwei zum Halbkreis gelegten Eichenzweigen über einem silbernen Fluss.
Das Wappen ist entstanden aus den Wappen der ehemals eigenständigen Gemeinden Elmlohe und Marschkamp. Die Ulmenblätter weisen auf das Ulmengehölz hin, welches der Gemeinde den Namen gab. Die Eichenzweige sind Sinnbilder des Waldes, der Balken in Wellenschnitt deutet auf die Geeste hin.
In Blau über silbernem Wellenfuß zwei abgekehrte silberne Kranichflügel.
Die Kranichflügel weisen auf den Namen der Gemeinde hin. Nach einer Vermutung von Eduard Rüther hatte auch das im 13. Jahrhundert urkundlich erwähnte Adelsgeschlecht - die Vlogelingen - ein vom Ortsnamen abgeleitetes, redenes Wappen. Der silberne Wellenfuß deutet auf den Flögelner See.
In Silber über grünem, mit einer aufgerichteten silbernen Hirtenschaufel belegten Hügel zwei bewurzelte grüne Tannen.
Eine geschichtliche Besonderheit bietet die Ortschaft Holßel. Die im Jahre 1111 erbaute Kirche wird seit dem Mittelalter bis heute ununterbrochen von reformierten Pastoren betreut.
Eine alte Urkunde berichtet, dass zu Holleborg zwischen Debstedt und Holßel Edelleute wohnten und einer von diesen in Gemeinschaft mit einer adligen Witwe zu Schönstede bei Midlum die Kirche zu Holßel erbaut habe. Im Innern der Kirche, zwischen dem Chor und dem Schiff, befindet sich ein Deckenbalken mit der Inschrift „Soli Deo gloria“ (Gott allein die Ehre).
Unter der Herrschaft des Schwedenkönigs Gustav Adolf wurden 1654 Flögeln, Bederkesa und Debstedt mit lutherischen Predigern besetzt. In Holßel hatte man sich mit Erfolg dagegen gewehrt.
Holßel war Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Neuenwalde und wurde bei Verschmelzung der Samtgemeinden Langen und Neuenwalde 1974 Ortschaft der neuen Gemeinde, jetzt Stadt Langen.
In Blau ein silberner Moorspaten in schräglinker Stellung, rechts oben und links unten begleitet von einer goldenen Biene.
Als charakteristische Moorsiedlung 1829 nach einem einheitlichen Plan durch das Hannoversche Amt Bederkesa nach dem Muster der Finndorfschen Moorkolonie gegründet. Zur Erschließung des Moores wurden zunächst schnurgerade feste Wege angelegt. Dann durchzog man das Moor mit einem Kanalnetz, Die Hauptkanäle dienten gleichzeitig als Transportwege für kleine Torfkähne.
In dem vier Kilometer langen Hymendorf gibt es die genaue Nachbildung einer alten Moorkate, der ersten Hausform, die die Kolonisten vor zweihundert Jahren benutzten. Das Leben im Moor war hart und entbehrlich. Nicht umsonst gilt der Spruch: „Dem Ersten den Tod, dem Zweiten die Not, dem Dritten das Brot.“.
In unserer hektischen Zeit ist ein alter Hochzeitsbrauch in Hymendorf erhalten geblieben. Mehrere Tage vor einer Hochzeit sucht der Hochzeitsbitter die einzuladenden Familien auf und überbringt die Einladung zur frohen Feier. Seine besonderen Kennzeichen sind seine mit bunten Bändern geschmückte Mütze und der ebenso verzierte Handstock. In jedem Haus trägt er seinen althergebrachten Inbittervers vor. In manchen Häusern wird dem Inbitter ein „Schluck“ spendiert und ein neues Band an die Mütze gesteckt.
In Grün über silbernem Schildfuß ein goldener Turm.
Unmittelbar hinter dem Deich der Außenweser liegt die Ortschaft Imsum. Die erste Landnahme begann mit dem Bau von 18 Wurten zum Schutz vor dem Meer bereits im 1. Jahrhundert n. Chr. Im Jahre 1091 findet Imsum erste urkundliche Erwähnung. Beliebtes Ausflugsziel ist der „Ochsenturm“ am Fuße des Weserdeichs.
Die Ortsteile Weddewarden, Dingen und die Bauernschaft Lebstedt bildeten das Kirchspiel Imsum. Die alte „Ochsenkirche“ stand mitten zwischen den drei Dörfern, nachdem Lebstedt von der vordringenden See zurückerobert wurde, und zwar in der Weihnachtssturmflut am 25. Dezember 1717. Danach erschien die Lage der alten Kirche am Deich so unsinnig, �ass sich zur Erklärung die bekannte „Sage von dem Ochsenturm“ bildete.
Wie kam es zu der Bezeichnung „Ochsenkirche“? Die Bewohner der drei Dörfer Imsum (früher Dingen), Weddewarden und Lebstedt konnten sich nicht über den Standort einigen, nachdem sie einstimmig beschlossen hatten, gemeinsam eine Kirche zu bauen. Ein Wurster kam auf den sonderbaren Gedanken, Ochsen die Entscheidung zu überlassen. Er schlug vor, zwei gleichstarke Tiere zusammenzubinden und sie zwischen den Orten laufen zu lassen. „Dort,“ so sagte der Wurster, „wo die beiden Tiere sich zuerst niederlegen, wollen wir unsere Kirche errichten.“ Alle waren einverstanden. Nach langem Hin und Her legten sich die Ochsen dort nieder, wo heute der Turm steht.
Ein großes kommunales Unglück befiel Imsum nach 1927: Weddewarden wurde in die Unterweserstadt Bremerhaven eingemeindet, und Imsum verlor seine Schulhoheit und Kirchenaufsicht an Bremerhaven.
In Gold über einem schwarzen Meiler mit goldenem Buchstaben K belegt, rechts und links ein grüner aufgerichteter zweiblättriger Eichenzweig mit Frucht.
Der mit einem K belegte Kohlenmeiler weist auf den Namen der Gemeinde hin. Die Eichenzweige erinnern an die früheren Eichenwälder.
In Silber eine sechzehnstrahlige rote Sonne über einem schwarzen, mit einer silbernen Henkelurne belegten Hügel.
1280 wird Krempel erstmalig urkundlich erwähnt. Der Ursprung des Namens dieses Geestdorfes ist nicht bekannt. Die Schreibweise änderte sich im Laufe der Jahrhunderte von Krempelinge, Crempeling, Crempelig, Cremelinge, Crimpelinge in Krempel.
Freigelegte Brandgruben, die als Opfergruben anzusehen sind, lassen darauf schließen, dass Krempel zwischen 1000-700 v. Chr. ein heidnisch-religiöses Kulturzentrum war. Auf dem Sonnenberg am nördlichen Dorfrand, wo fünf bronzezeitliche Grabhügel lagen, war lange Jahre eine Raketenstation der Bundeswehr.
Nachdem das Dorf 1906 die erste Telefonanlage und eine „Posthülfsstelle“ erhalten hatte, wurde am 23. Juli 1925 eine Kraftpostverbindung mit Otterndorf hergestellt. Im Zuge der Gebiets- und Verwaltungsreform kam Krempel über die Samtgemeinde Neuenwalde zu Langen.
Das Wappen der Gemeinde Kührstedt zeigt im oberen Teil auf rotem Grund eine silberne Eiche mit zwei Eicheln und im unteren Teil auf grünem Grund eine silberne Wellenlinie mit einem beladenen schwarzen Frachtkahn.
Die Eiche steht für die Wichtigkeit dieser Baumart der Gemeinde und die beiden Eicheln symbolisieren die beiden Ortsteile. Die Wellenlinie weist auf den die beiden Gemarkungen durchschneidenden Bederkesa-Geeste-Kanal hin. Sie erinnert an die große Bedeutung der Frachtschifffahrt für unsere Gemeinde in der Vergangenheit.
In Gold über schwarzem Hügel, belegt mit goldener Urne über silbernem Wellenstreifen, ein rotes aufgehendes Sonnenrad.
Bis zum 31. Dezember 2014 bildete Langen mit sieben umliegenden Gemeinden die eigenständige Stadt Langen, die sodann mit der Samtgemeinde Bederkesa zur Stadt Geestland fusionierte.
Die rasante Entwicklung vom kleinen Dorf zur Stadt
Langens vorgeschichtlicher Reichtum spiegelt sich in den Symbolen seines Wappens: Das Sonnenrad wurde in Form einer älterbronzezeitlichen Radnadel (um 1500 vor Chr.) im "Langen Berg" gefunden, der Hügel weist auf den "Paschberg" auf dem heutigen Friedhof hin.
Die Urne erinnert an das völkerwanderzeitliche Gräberfeld beiderseits der Debstedter Straße und der Wellenstreifen an die nahe Weser.
Noch 1549 bestand Langen aus nur 4,5 Höfen und 23 Katen.
Seit dem frühen Mittelalter gehörte Langen, das 1139 erstmalig in einer Urkunde erwähnt wird, jahrhundertelang zum Kirchspiel und zur Börde Debstedt sowie zur Herrschaft und zum Amt Bederkesa.
Daraus ergibt sich, daß es Langen sozusagen seit 860 Jahren "amtlich" gibt. Dieses Datum hatte der Ortsrat Langen aufgegriffen und zum Anlaß genommen, im Jahre 1989 die 850-Jahrfeier zu begehen. Die echte Urkunde, der Beweis, liegt zwar in Moskau, doch eine fotografische Reproduktion liegt hier vor und dient als Nachweis.
Nach der Gebiets- und Verwaltungsreform per 1.3.1974 und dem Zusammenschluß der Ortschaften Debstedt, Holßel, Hymendorf, Imsum, Krempel, Langen, Neuenwalde und Sievern zur Einheitsgemeinde Langen wurde täglich mit dem Durchbruch der "Schallmauer", das Erreichen der Einwohnerzahl 15.000, gerechnet. Das Ergebnis der Volkszählung brachte die Gewißheit: Langen zählte am 25. Mai 1987 15.224 Einwohner, am 31.12.1994 ist diese Zahl auf 16.720 geklettert und betrug am 30.06.1998 bereits 17.635.
Ab 1. Juli 1990 ist Langen "Stadt". In seiner Sitzung am 23.10.1989 hatte der Rat der Gemeinde Langen einstimmig beschlossen, die Verleihung der Bezeichnung "Stadt" zu beantragen.
Aus einem Bauerndorf über lange Zeiten wurde ein dynamisches städtisches Gemeinwesen. Von wesentlicher Bedeutung dürfte dabei die 1986 durchgeführte Bebauung der Ortsmitte mit dem "Lindenhof" sein.
Gespalten, vorn in Rot ein silberner Kranichflügel, hinten in Silber ein aufgerichteter, mit dem Bart nach rechts gekehrter roter Schlüssel.
Der Kranichflügel ist ein Teil des Wappens des Adelsgeschlechts von der Lieth, das im 15. Jahrhundert in – Lyrtge - besitzlich war. Der Schlüssel ist dem Wappen der Stadt Bremen entlehnt, die bis 1654 die Grundherrschaft in Lintig besaß, doch sind Farbe und Stellung des Schlüssels verändert.
In Rot auf grünem, mit silbernen Wellenstreifen belegten Schildfuß ein silberner Glockenturm mit goldener Glocke in schwarzem Schallloch, goldenem Tor und goldenem Kreuz auf der Spitze.
Das Dorf auf der Geest. Erstmalig im Jahre 1334 urkundlich erwähnt. Bedeutungsvoll für die Entwicklung des Ortes war die Verlegung des Benediktinerinnenklosters im Jahre 1334 von Altenwalde nach Neuenwalde. 1683 ging das Kloster in den Besitz der Bremischen Ritterschaft als Stift für unverheiratete adelige Fräulein über. Noch heute ist das Kloster Neuenwalde als Stift bewohnt.Der Bau des Klosters war mühsam und dauerte viele, viele Jahre.
Der Klosterkomplex bestand zunächst aus der Kirche, zwei Gebäuden, dem Amt mit vier Gebäuden, dem Pfarrhaus, dem Küsterhaus und der Erbzinsmühle. Später erfolgten etliche Erweiterungsbauten: Anbau des Südflügels (1719) ,Torfstall und Kornscheune (1873), Erweiterung der Kirche (1910).
Das Kloster entwickelte sich zu einer Grundherrschaft und vergrößerte ständig den Besitzstand und den Machteinfluß. Als die Wurster die schwarze Garde des Herzogs von Lauenburg am 26. Dezember 1499 bei Weddewarden geschlagen hatten, zogen die Lauenburger Landknechte „up Nie Yars dach“ (am Neujahrstag) nach dem Lande Hadeln. Und genau im Jahre 1500 brannte das Kloster ab. Mit dem Wohlstand war es vorbei. In einer Urkunde vom 20. Dezember 1520 heißt es … „dem durch Brand und Verheerung verarmten Kloster Neuenwalde“ …
Im Jahre 1971 war die Samtgemeinde Neuenwalde mit den Gemeinden Krempel, Holßel, Hymendorf und Neuenwalde gebildet worden. Diese Gebietskörperschaft hörte auf zu bestehen als die Samtgemeinde am 1. März 1974 bei der großen Gebiets- und Verwaltungsreform mit sieben anderen Gemeinden zur Einheitsgemeinde Langen, jetzt Stadt Langen, zusammengefasst wurde.
In Blau ein goldener Ring, darin ein goldener Adlerkopf mit rotem Schnabel und roter Zunge.
Der Ring weist auf den Ortsnamen hin. Der goldene Adlerkopf ist ein Sinnbild des Gerichts und erinnert daran, dass Ringstedt früher als Hauptort einer Börde Gerichtsort gewesen ist.
In Grün über erniedertem silbernem Wellenbalken ein gestürztes silbernes Schwert in fränkischer Form mit goldenem Griff, beseitet von je einer schräggestellten goldenen Ähre.
Am Nordufer des Sieverner Auetals erhebt sich ein mächtiger Rundwall, die Pipinsburg. Das genaue Alter der Pipinsburg ist ebenso unbekannt wie die Entstehung des eigentümlichen Namens. In der Nähe der Pipinsburg befinden sich weitere bedeutende Kultstätten, wie z.B. Bülzenbett und Heidenschanze.
Im Jahre 1139 wird Sievern erstmalig in einer von dem Bremer Erzbischof Adalbero (1123 -1148) ausgestellten Urkunde über die Schenkungen an das Kloster St. Pauli bei Bremen erwähnt. Mit Sicherheit haben jedoch schon vor fünftausend Jahren Menschen in diesem Gebiet gelebt. Ab 3000 v. Chr. lassen sich in dieser Region Bauernkulturen nachweisen. Aus dieser Zeit stammen Grabhügel bei der Heidenschanze, der Pipinsburg und den östlich der Heidenstadt gelegenen „Sieben Bergen“.
Auch in der Neuzeit geht es aufwärts. 1957 bekommt Sievern eine Umgehungsstraße. Es wird an das Wassernetz angeschlossen. Das Flurbereinigungsverfahren (1962 - 1983) wird für rund 10 Millionen DM durchgezogen. Sievern wird Ferienort. 1970 wird Sievern mit Langen, Debstedt und Imsum Samtgemeinde Langen. 1971/72 entsteht der „Sieverner See“, ein Wochenendgebiet. Am 1. März 1974 wird Sievern im Zuge der Gebietsreform der „Einheitsgemeinde Langen“, jetzt Stadt Langen, zugeordnet.