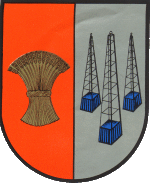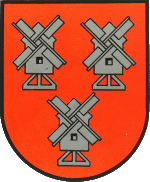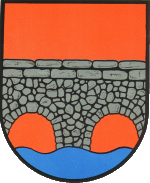Auf rotem Grund ein hellbrauner Sparren des Dachstuhls der Dorfkirche, darunter eine Rose, die an das Rittergeschlecht von Saldern erinnert.
Die erste Erwähnung des Dorfes findet sich in einem Einnahmeregister des Dompropstes Johann aus den Jahren 1277 - 1786. Darin wird das Dorf "Bettenem" genannt. Andere Schreibweisen des 0rtsnamens sind 1317 Betthenem, 1325 Bettenum, 1412 Bettelem und 1542 Bettrem.
Die Ortssage erzählt: Noch bevor das Dorf einen Namen hatte, erbaute man die Kirche. Als ihr Dachstuhl aufgerichtet wurde, stand ein Sparren schief. Da rief ein Zimmermann dem andern zu: "Bett'n rumme!" (etwas herum). Der Ruf gefiel den Leuten so gut, dass sie ihr Dorf Bettrum nannten. Diese Sage erklärt den Sparren im Gemeindewappen. Die Rose erinnert an das Rittergeschlecht von Saldern, das im Mittelalter in Bettrum begütert war und eine Rose im Wappen führte.
Ein goldener Hügel mit fünf goldenen Ähren darüber auf grünem Grund.
Unter Berücksichtigung des 0rtsnamens zeigt das Ortswappen einen Berg mit 5 Ähren darüber. Es ist somit ein "redendes Wappen", das auf den Namen und die Lage des Dorfes Feldbergen in einer äußerst fruchtbaren Landschaft am "Messeberge" hinweist.
Von 300 Reitern begleitet, ließ hier am 13. November 1528 der zum Bischof von Hildesheim gewählte Vizekanzler des Kaisers Karl V. (1519 - 1556) Balthasar Merklin beim Einzug in sein Bistum halten. Überrascht blickte er weit ins Land hinaus und erklärte, er habe bisher noch keine schönere Landschaft im Reiche seines kaiserlichen Herrn mit solchen vielen schmucken Dörfern und fruchtbaren Feldern gesehen.
Eine goldene spätgotische Sakramentsnische der Dorfkirche mit schmiedeeiserner Gittertür auf rotem Grund.
Ein "Hemstide" wird 1151 erstmals genannt. Das Moritzstift vor Hildesheim hatte dort 4 Morgen Grundbesitz. Es wird ihn wohl bald wieder abgegeben haben, da weitere Nachrichten darüber fehlen.
Der Name Himstedt wird als Wohnstätte eines Hemo oder Heimo gedeutet. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts (1166) wird ein Rotmann von Himstedt erwähnt, der mit der edlen Frau Sophia, Gräfin von Assel, Tochter des Grafen Heinrich von Assel-Winzenburg, verheiratet war. Rotmann und sein Bruder Siegfried hatten in Stockheim bei Wolfenbüttel Besitzungen, die sie dem Kloster Steterburg verkauften. Ein Sohn Rotmanns begleitete 1195 als Hildesheimer Ministeriale den Bischof Konrad I. nach Worms. Sophie, die Frau Rotmanns, soll in 2. Ehe Graf Burchard I. von Wohldenberg geheiratet haben. Von einem anderen Geschlecht, das sich auch "von Himstedt" nannte, ist überliefert, dass Amelung von Himstedt um 1194 von seiner dem Wahnsinn verfallenen Frau getötet sei. Ein Sohn erbte Grundstücke in Himstedt, andere kamen an das Kloster Steterburg. 1331 - 1343 wird der Knappe Konrad von Himstedt erwähnt. Im Besitz bischöflicher Lehen in Himstedt war 1390 der Stiftsmarschall Hans von Schwicheldt und 1481 Ludolf von Saldern. Ein Siegel hat das Rittergeschlecht von Himstedt nicht hinterlassen. Bei der Wahl eines Ortswappens musste deshalb nach einem anderen entsprechenden Zeichen gesucht werden. Als solches nahm man ein Bild der spätgotischen Sakramentsnische mit schmiedeeiserner Gittertür, die sich an der 0stseite der Dorfkirche befindet, in das Ortswappen.
In Gold ein roter Doppeladler.
Der langgestreckte Ort besteht aus dem Ober- und dem Unterdorf. Beide Ortsteile, von denen jeder eine Kirche besitzt, sind zusammengewachsen. Stolz überragt der mächtige Wehrturm der St. Martinuskirche die weite fruchtbare Landschaft. Der Doppeladler des alten Kronleuchters aus dem Jahre 1656 in der ehrwürdigen Dorfkirche kann als Zeichen der Verbundenheit von Heimatkirche und Heimatdorf gedeutet werden. Man hat ihn deshalb zum Wappenbild der Ortschaft bestimmt. Das Vorkommen des Doppeladlers auch anderswo, wie z.B. in der Kirche zu Hohenhameln, weist aber auf einen allgemeinen tieferen Sinn hin. Darin wird nämlich die Darstellung des Gegensätzlichen, des Dunkeln und Hellen, des Alten und Jungen, zum Ausdruck gebracht. Geschichtliche Beziehungen zum Doppeladler des alten deutschen Kaiserreiches bleiben ausgeschlossen.
Die goldfarbene Kirchenglocke der Dorfkirche mit den Meisterzeichen des Glockengießers auf rotem Grund.
Den Zehnten von Klein Himstedt und einen Sattelhof daselbst mit 5 Hufen Land trugen 1451 die von Saldern vom Bischof Magnus (1424 - 1452) zu Lehen und 1481 desgleichen vom Bischof Barthold II. (1481 - 1502). Im Jahre 1480 kam dieser Besitz an das Kloster Steterburg. Als der Zehnte 1838 abgelöst wurde, waren 20.000 Taler an die von Hammerstein zu zahlen. Kirchlich gehörte Klein Himstedt immer als Tochterkirche zu Groß Himstedt. Beide Gotteshäuser im einstigen Archidiakonat Nettlingen stammen aus romanischer Zeit (vor 1300), wie an den Türmen zu erkennen ist. Klein Himstedt besitzt eine Glocke, die 1511 der berühmte Hildesheimer Glockengießer Harmen Koster gegossen und mit seinem Meisterzeichen geschmückt hat. Die Westwand des Turmes und die Südwand des Langhauses wurden 1957 erneuert. Noch heute wie vor 500 Jahren ruft die genannte Glocke zum Gottesdienst. Es lag daher nahe, ein Bild der Glocke als Gemeindewappen zu nehmen.
Wappen gespalten, rechts in Rot eine Getreidegarbe und links in Silber drei Bohrtürme.
Der Ortsname Mölme hat sich oft geändert, bis die heutige Form entstand. Von Muilnem 1260 treten als weitere Benennungen auf: Molnem 1264, Molhem 1275, Mollem 1422, Molme 1521 und 1544 Molem bzw. Molin.
Am 21. August 1260, dem Tag, da Mölme erstmalig genannt wird, übertrug Bischof Johann I dem Kloster Loccum 20 Hufen Land der Mölmer Feldmark mit den dazu gehörigen Höfen. Bis dahin hatten 11 Hufen der Ritter Bertold von Gadenstedt, 3 Hufen Ludolf von Bortfeld, 3 Hufen Werner von Borsum und 3 Hufen Johann von Saldern besessen. Die Loccumer Zisterzienser hatten die Ritter durch Geldzahlungen abgefunden. Die Bauern mussten fortan Zins und Abgaben dem Kloster entrichten. In den folgenden Jahren gelang den Mönchen die Abrundung des Besitzes. Der Edelherr Volrad von Depenau aus Ahrbergen verkaufte 1264 dem Kloster 5 Mölmer Hufen. Die letzte Loccumer Erwerbung in Mölme 1302 waren 40 Morgen Land und ein Hof, welchen Besitz der Ritter Ludolf Rasehorn dem Kloster verkaufte.
Mölme gehörte zur Go Eggelsen, die 1446 endgültig vom Amt Peine abgetrennt und zum Amt Steinbrück gelegt wurde. Durch die Stiftsfehde kam dieses Amt für 120 Jahre unter braunschweigische Landeshoheit. Als 1542 die Reformation in Hoheneggelsen eingeführt worden war, haben auch die Einwohner in Mölme das evangelische Bekenntnis angenommen. 1592 gab es in Mölme 3 Vollspänner, 6 Halbspänner und 2 Kotsassenhöfe.
Um 1935 begann die Gewerkschaft Eleverath in der Mölmer Feldmark mit Bohrungen auf Erdöl. Etwa 50 Ölpumpen waren 1950 in Aufbau und Bohrung, aber die Ölfelder sind erschöpft. Zur Erinnerung hat das Gemeindewappen im geteilten Schild im linken Feld Bilder von Bohrtürmen, im rechten Getreidegarben.
Wappen geteilt, oben in Silber ein liegender schwarzer Doppelhaken, unten in Rot eine silberner Helm mit silbernen Adlerflügeln.
In Nettlingen war ein Rittergeschlecht begütert, das mit Udo von Nettlingen 1166 zuerst urkundlich erwähnt wird. Es trug einen Doppelhaken (Wolfsangel) im Wappen, hat aber eine besondere Bedeutung nicht erlangt. Der Knappe Johann von Nettlingen war 1358 bischöflicher Vogt auf der Winzenburg. Werner und Hans von Nettlingen erwarben 1426 vom Michaeliskloster ein Haus in der Stadt Hildesheim. Knappe Hans von Nettlingen verkaufte 1490 seinen Besitz in Garbolzum und Wöhle dem Domkapitel. In der Michaeliskirche hing ein Wappenschild des erloschenen Geschlechts.
Größere Bedeutung für Nettlingen gewann das Rittergeschlecht von Saldern. Es wurde 1102 vom Michaeliskloster mit dem Zehnten belehnt. Im 14. Jahrhundert besaß das Geschlecht dort Lehnsgüter von den Herzögen von Braunschweig und von den Hildesheimer Bischöfen. Die Grafen von Wohldenberg hatten um 1325 die Ritter mit der Gerichtsbarkeit über das Dorf und mit der Holzgrafschaft über das Vorholz belehnt.
Um 1570 erbaute Kurt von Saldern das Nettlinger Schloss. Über den Verkauf desselben nahm 1605 die Brauergilde in Hildesheim Verhandlungen auf, die 1611 zum Abschluss kamen. Aber schon im folgenden Jahre trat die Brauergilde das Schloss für 28.000 Reichstaler dem Landdrost Arend von Wobersnow ab. Der dem pommerschen Adel entstammende Landdrost stand in Diensten des Herzogs Friedrich Ulrich von Braunschweig und hatte durch unlautere Geschäfte sich große Geldsummen zu verschaffen gewusst. Sein Reichtum wuchs, als ihn 1617 der Herzog zum Münzkommissar ernannte und er darauf Münzstätten errichtete, in denen nach Art der Kipper und Wipper minderwertige Münzen geprägt wurden. Der Landdrost, 1620 wegen Münzfälschung vor das Reichskammergericht zitiert, flüchtete nach Nettlingen. Auf der Rückreise von Paris nach Moskau übernachtete Zar Peter der Große mit Frau 1717 im Nettlinger Schloss. Nordwestlich von Nettlingen liegt links der Klunkau der Weiler Helmersen. Der Knappe Jordan von Helmersen führte 1325 in seinem Siegel einen Helm mit Adlerflügeln. Das untere Feld des zweigeteilten Ortswappens zeigt das redende Wappen der Ritter von Helmersen, während sich im oberen Feld der Doppelhaken aus den Siegeln der Brüder Johann und Hermann von Nettlingen vom Jahre 1362 befindet.
Drei (2:1) silberne Bockwindmühlen auf Rot.
Das Dorf gehörte zur Go Eggelsen. Diese kam 1446 endgültig zur Burg Steinbrück. Durch die Stiftsfehde fiel 1523 das Amt Steinbrück an Braunschweig. Im Kriege des Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Kulmbach gegen Herzog Heinrich d.J. wurde am 20. Juni 1553 Söhlde durch die Raubscharen des Markgrafen niedergebrannt. 1592 gab es dort 4 Ackerleute, 8 Halbspänner und 72 Kotsassen. Das Amt Steinbrück kam 1643 an Hildesheim zurück. Am 19. Februar 1644 wurde in Söhlde ein Meierding gehalten. Zu den an das Amt Steinbrück zu leistenden Diensten gehörten u.a. die Saat-Tage. Jeder Einwohner, der Pferde hielt, musste in der Saatzeit einen Tag mit dem Pfluge dienen oder 8 Gotegroschen (96 Pfennig) bezahlen. In der Erntezeit hatte jeder Einwohner 5 Tage Erntedienst zu leisten oder für jeden Tag 48 Pfennig zu entrichten.
Südlich von Söhlde steigt leicht gewellt der Söhlder Berg (148 m) an. Er besteht aus den Kalksteinen des Cenomans und Turons. Im Jahre 1815 kam der Glaser Christoph Behrens aus Großlafferde durch Heirat nach Söhlde, wo er Gast- und Landwirt wurde und nebenbei sein Glaserhandwerk weiter betrieb. Dabei entdeckte er, dass die geschabten Steine aus dem Kreiderücken sich vorzüglich zur Herstellung von Kitt eigneten. Behrens errichtete um 1820 die erste von Windkraft getriebene Kreidemühle und wurde so Begründer der blühenden Söhlder Kreideindustrie. Über ein Dutzend Kreidemühlen wurden für die Verarbeitung der Steine zu Schlämmkreide erbaut. Die Windkraft ist später durch die Elektrizität abgelöst worden. Eine Kreidemühle, eine so genannte Bockmühle, ist zum Andenken stehen geblieben. Die Bedeutung der Söhlder Kreide ist seit Ausfall der Kreidewerke auf Rügen ständig gestiegen. Die Ortschaft führt deshalb 3 Kreidemühlen in ihrem Wappen.
In Rot über blauem Wellengrund eine silberne Steinbrücke mit 2 Bögen.
Das Wappen ist „redend“ und gibt den Namen der Ortschaft wieder.
Im Jahr 1367 fiel der Herzog von Braunschweig mit Verbündeten raubend und plündernd in das Bistum Hildesheim ein. Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit besiegte ihn Bischof Gerhard von Hildesheim mit einem kleinen Heer in der Schlacht bei Dinklar und konnte hohes Lösegeld fordern. Mit einem Teil dieses Lösegeldes versuchte er seine Ostgrenze zu sichern, indem er in der Flussniederung mit dem Bau einer Burg begann, die nach der über die Fuhse führenden steinernen Brücke benannt wurde. 1425 ging die Burg in den Besitz des Domkapitels über, zusammen mit der Gerichtsbarkeit und den Diensten und Abgaben der Dörfer Hoheneggelsen, Söhlde, Gr. und Kl. Himstedt, Mölme, Bettrum, Feldbergen und Garbolzum, die heute fast alle zur Gemeinde Söhlde gehören. Bis ins 19. Jahrhundert bildeten sie das Amt Steinbrück mit Markt- und Stadtrecht.
Nach der Stiftsfehde kam die Burg Steinbrück zum Herzogtum Braunschweig. 1573 ließ Herzog Julius als zusätzliche Befestigung den damals 30 m hohen Kehrwiederturm bauen. Am Ende des Dreißigjährigen Krieges wurde die Burg wieder dem Domkapitel Hildesheim zugesprochen, das einen Teil der Befestigungswerke zum Aufbau eines Wirtschaftshofes abtragen und neu nutzen ließ. 1810 wurde das Gut Steinbrück Staatsdomäne, 1862 kaufte die Klosterkammer Hannover das Gut, das von Pächtern bewirtschaftet wurde.
Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden hier viele Familien aus dem Osten eine neue Heimat. Sechs industrieverdrängte Landwirtsfamilien aus dem Salzgittergebiet siedelten zehn Jahre später das Gut auf. Langsam begannen die Einwohner zu einer Dorfgemeinschaft zusammenzuwachsen mit einem Rat und einem Bürgermeister, der 200 Jahre alten katholischen Kirche, einer im Kehrwiederturm neu eingerichteten evangelischen Kapelle (Wappen der Gemeinde Söhlde), einer Schule (bis 1964) und der Feuerwehr als erstem gemeinsamen Verein.