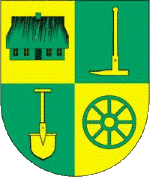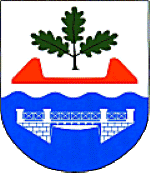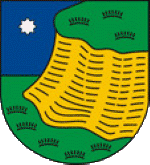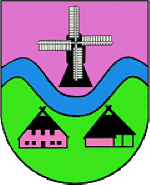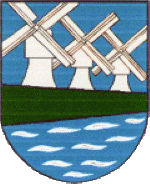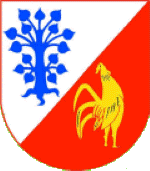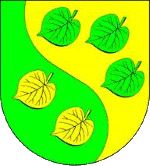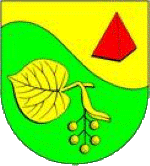Heraldisch nicht beschreibbar. Wappenfiguren und Farben: Haus, Nesselblatt, blau, grün, weiß.
Ein Sonderfall sind die heraldisch nicht beschreibbaren "Wappen" der Gemeinden Bekdorf, Huje, Kleve, Krummendiek, Moorhusen, Oldendorf und Willenscharen. Diese Gemeinden liegen im Kreis Steinburg. Strenggenommen handelt es sich nicht um Wappen, da Thematik und Darstellungsart diese Hoheitszeichen den Bildsiegeln zuordnen. Sie waren 1946 von der britischen Militärregierung genehmigt worden, ohne dass eine heraldische Prüfung stattgefunden hatte. So kommt es, dass diese "Wappen" nicht den heraldischen Darstellungsregeln entsprechen und in der heraldischen Terminologie nicht beschreibbar sind. Auch eine historische Begründung fehlt, dennoch lassen sie erkennen, was mit ihnen zum Ausdruck gebracht werden soll. So zeigt das Bildsiegel von Bekdorf das Selbstverständnis als Bauerndorf und die Bindung an die engere Heimat durch die Andeutung der Naturlandschaft in Gestalt der Flüsse.Näheres zu diesen Bildsiegeln bei: Martin Reißmann: Die Wappen der Kreise, Ämter, Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein (Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs 49), Husum 1997, S. 379-381. (Quelle: Kommunale Wappenrolle Schleswig-Holstein)
Von Grün und Blau durch einen gestürzten silbernen Wellengöpel erhöht geteilt. Unten die geöffneten silbernen Tore einer Schleuse, darunter ein silberner Stör.
Das Gemeindewappen zeigt die Verbindung Bekmündes zur Bekau und zur Stör sehr deutlich.
Der Wellengöpel stellt die Mündung der Bekau dar, wie es aus dem Namen der Gemeinde abgeleitet werden kann. Der Stör soll auf die Lage der Gemeinde am gleichnamigen Fluss und auf die ehemals reichen Störfänge hinweisen. Die beiden grünen Felder stehen für die Landwirtschaft. Mit den Schleusentoren wird an die alte Schleuse erinnert, die an der Mündung der Bekau stand.
Unter einem goldenen Zinnenschildhaupt durch einen schmalen silbernen Wellenbalken von Grün und Blau geteilt. Oben zwei fächerförmig gestellte goldene Haferrispen zwischen drei goldenen Buchenblätter, unten ein silbernes Boot mit seitlichem Steuerruder.
Das Wappen der Gemeinde Drage ist gedrittelt. Das silberne Boot im blauem Wappenfuß weist darauf hin, dass die Gemeinde einst Stapelplatz war. Das silberne Band der Bekau trennt den Fuß vom Hauptfeld, dessen Farben Gold und Grün auf die Landwirtschaft hinweisen. Land- und Forstwirtschaft, die immer noch die Gemeinde präge, sind durch einen Strauß aus drei goldenen Buchenblättern und zwei goldenen Haferrispen dargestellt. Das goldene Schildhaupt erinnert an das Schloss Friedrichsruh in Drage, das trotz seiner kurzen Geschichte prägend auf die Region gewirkt hat. Die drei Zinnen, welche Hauptfeld und Schildhaupt voneinander trennen, weisen auf die drei Ortsteile Schäferei/Dorfstraße, Hansch und Tiergarten hin, welche aus dem einstigen adligen Gut Drage hervorgegangen sind.
In Silber über blaugewelltem Schildfuß eine rote Klappbrücke, zwischen deren aufgezogenen Hälften der Bug eines einmastigen roten Bootes sichtbar wird.
Der bereits Ende des 11. Jh. als "Holigenstat" nachgewiesene Ort liegt an beiden Ufern der Stör. Die im Wappen abgebildete Klappbrücke, die beide Uferseiten verbindet, stammt aus dem 16. Jh. Als zentrale Figur bildet sie das eigentliche Wahrzeichen der Gemeinde. Die Stör, dargestellt durch den Wellenschildfuß, war ein wichtiger Schiffahrtsweg, der den Zubringerhandel von der Elbe nach Itzehoe ermöglichte. Der Wasserweg als Handelsund Verkehrsverbindung wird durch das Boot im Wappen ausgedrückt. Heiligenstedten war eine der ältesten Kirchengründungen im Lande, die, wie der Ortsname nahelegen könnte, vielleicht ein älteres Heiligtum ersetzte. 1928 wurde der aufgelöste Gutsbezirk Heiligenstedten mit der gleichnamigen Landgemeinde zur heutigen Gemeinde vereinigt. Die Wappenfarben sind diejenigen Schleswig-Holsteins.
Von Gold und Grün geviert: 1 eine grüne Kate, 2 eine goldene nach unten weisende Spitzhacke, 3 ein goldener Spaten, 4 ein grünes Rad.
Das Wappen ist viergeteilt in den Farben Gold und Grün. Diese Farben stehen für den Sand in Heiligenstedtenerkamp und das Land. Oben links steht eine grüne Kate im Feld, da Heiligenstedtenerkamp früher von Kätnern bewohnt wurde, die überwiegend im Dienste des Schlosses Heiligenstedten standen. Die weiteren drei Felder zeigen das ländliche Werkzeug, das für den Sandabbau, die Spanndienste und den Gemüsebau der Bewohner benötigt wurde.
In Grün unter einem silbernen Wolkenbalken mit nur einer großen Wolke ein goldenes Hallenhaus mit gold-schwarzen Ständern.
Das Wappen zeigt auf grünem Grund in der oberen Hälfte die charakteristische Flussschleife der Stör bei Hodorf in Silber. In der unteren Hälfte ist ein goldenes, schwarz tingiertes Hallenhaus in Ständerbauweise dargestellt, wie es um 200 n.Chr. in Hodorf stand. Dieses "Hodorfer Haus" wird in der Fachwelt als der Vorläufer des Niedersachsenhauses bezeichnet. Der grüne Grund weist auf die Marschenzugehörigkeit der Gemeinde hin.
In Gold auf grünem Hügel die rote Hohenasper Kirche, vom hölzernen Glockenturm aus gesehen, im linken Obereck ein grünes Espenblatt.
Zusammen mit dem Dorf Aspe wird die im Wappen dargestellte Kirche dieses Ortes bereits 1281 erwähnt. Mit dem freistehenden hölzernen Glockenturm war und ist das auf einem Hügel errichtete Gebäude weit in der Umgebung sichtbar. Wegen dieser hervorgehobenen Lage der Kirche wurde vermutlich der Ortsname im Laufe der Zeit in Hohenaspe verändert. Einer Legende zufolge soll 1648 der vorher weiter entfernt stehende Kirchturm durch ein mit Sturm verbundenes Erdbeben näher an die Kirche herangerückt worden sein. Das im linken Obereck des Wappens abgebildete Espenblatt bezieht sich auf den Ortsnamen, da "Aspe" die niederdeutsche Form von "Espe" (= Zitterpappel) ist. Es kann gleichzeitig als ein Zitat aus dem Familienwappen der Krummendiek aufgefaßt werden, der Stifter und Patrone der Hohenasper Kirche, die zugleich ihre Grablege war. Das Wappenzeichen dieser Adelsfamilie war ein Baum mit deutlichen Blättern. Die Farben Grün und Gold weisen sowohl auf die geographische Lage der Gemeinde zwischen Marsch und Geest hin als auch auf ihren agrarwirtschaftlichen Charakter.
Heraldisch nicht beschreibbar. Wappenfiguren und Farben: Haus, Segelboot, Wellen, blau, rot, weiß.
Ein Sonderfall sind die heraldisch nicht beschreibbaren "Wappen" der Gemeinden Bekdorf, Huje, Kleve, Krummendiek, Moorhusen, Oldendorf und Willenscharen. Diese Gemeinden liegen im Kreis Steinburg. Strenggenommen handelt es sich nicht um Wappen, da Thematik und Darstellungsart diese Hoheitszeichen den Bildsiegeln zuordnen. Sie waren 1946 von der britischen Militärregierung genehmigt worden, ohne dass eine heraldische Prüfung stattgefunden hatte. So kommt es, dass diese "Wappen" nicht den heraldischen Darstellungsregeln entsprechen und in der heraldischen Terminologie nicht beschreibbar sind. Auch eine historische Begründung fehlt, dennoch lassen sie erkennen, was mit ihnen zum Ausdruck gebracht werden soll. So zeigt das Bildsiegel von Huje das Selbstverständnis als Bauerndorf und die Bindung an die engere Heimat durch die Andeutung der Naturlandschaft in Gestalt der Flüsse. Näheres zu diesen Bildsiegeln bei: Martin Reißmann: Die Wappen der Kreise, Ämter, Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein (Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs 49), Husum 1997, S. 379-381. (Quelle: Kommunale Wappenrolle Schleswig-Holstein)
Durch Wellenschnitt von Silber und Blau leicht erniedrigt geteilt. Oben unter einem dreiblättrigen grünen Eichenzweig (mit schwarzem Stengel und schwarzen Blattstielen) und diesen unten einschließend der rote Schnitt durch einen von einem Erdringwall umgebenen Platz; unten eine silberne Brücke mit quadergemauerten, seitlichen Fundamenten, Betonbalkengestützter Fahrbahn und einem aus Eisengitterelementen bestehenden, von vier Steinstützen gehaltenem Geländer. Die Fahrbahn wird zusätzlich durch unten gerundete Eisenstreben gehalten.
In der oberen Hälfte zeigt das Wappen eine Schnittzeichnung der Kaaksburg, einen Erdringwall aus dem 9. und 10. Jahrhundert. Im Wall steht ein Eichbaum mit 3 Blättern, die für die heute zu einer Gemeinde zusammengefassten Orte Everstorf, Kaaksburg und Kaaks stehen. Der untere Teil zeigt im Wasser der Bekau die Fischbauchbrücke aus dem Jahre 1909, die das einzige heute in Schleswig-Holstein erhaltene Original einer besonderen Konstruktionsform ist, die aus den Anfängen des Stahlbetonbaus kommt und aus Betonbalken besteht, die unterseitig von kreisförmig gebogenen Flacheisen (Fischbauch) gestützt wird.
Heraldisch nicht beschreibbar. Wappenfiguren und Farben: Klippe, Stern, Strandgras, blau, grün.
Ein Sonderfall sind die heraldisch nicht beschreibbaren "Wappen" der Gemeinden Bekdorf, Huje, Kleve, Krummendiek, Moorhusen, Oldendorf und Willenscharen. Diese Gemeinden liegen im Kreis Steinburg. Strenggenommen handelt es sich nicht um Wappen, da Thematik und Darstellungsart diese Hoheitszeichen den Bildsiegeln zuordnen. Sie waren 1946 von der britischen Militärregierung genehmigt worden, ohne dass eine heraldische Prüfung stattgefunden hatte. So kommt es, dass diese "Wappen" nicht den heraldischen Darstellungsregeln entsprechen und in der heraldischen Terminologie nicht beschreibbar sind. Auch eine historische Begründung fehlt, dennoch lassen sie erkennen, was mit ihnen zum Ausdruck gebracht werden soll. So bezieht sich das Bildsiegel von Kleve auf den Ortsnamen (Kliff = Steilhang zwischen Geest und Marsch). Näheres zu diesen Bildsiegeln bei: Martin Reißmann: Die Wappen der Kreise, Ämter, Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein (Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs 49), Husum 1997, S. 379-381. (Quelle: Kommunale Wappenrolle Schleswig-Holstein)
Heraldisch nicht beschreibbar. Wappenfiguren und Farben: Haus, Wellenbalken, Windmühle, grün, blau, rot.
Ein Sonderfall sind die heraldisch nicht beschreibbaren "Wappen" der Gemeinden Bekdorf, Huje, Kleve, Krummendiek, Moorhusen, Oldendorf und Willenscharen. Diese Gemeinden liegen im Kreis Steinburg. Strenggenommen handelt es sich nicht um Wappen, da Thematik und Darstellungsart diese Hoheitszeichen den Bildsiegeln zuordnen. Sie waren 1946 von der britischen Militärregierung genehmigt worden, ohne dass eine heraldische Prüfung stattgefunden hatte. So kommt es, dass diese "Wappen" nicht den heraldischen Darstellungsregeln entsprechen und in der heraldischen Terminologie nicht beschreibbar sind. Auch eine historische Begründung fehlt, dennoch lassen sie erkennen, was mit ihnen zum Ausdruck gebracht werden soll. So zeigt das Bildsiegel von Krummendiek das Selbstverständnis als Bauerndorf und die Bindung an die engere Heimat durch die Andeutung der Naturlandschaft in Gestalt der Flüsse. Die Jahrhunderte lange Auseinandersetzung mit dem Wasser in den tiefgelegenen Marsch- und Moorgebieten findet sich in Form von Deich und Schöpfmühle wieder. Näheres zu diesen Bildsiegeln bei: Martin Reißmann: Die Wappen der Kreise, Ämter, Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein (Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs 49), Husum 1997, S. 379-381. (Quelle: Kommunale Wappenrolle Schleswig-Holstein)
In Silber ein gesenkter, schräglinker blauer Wellenbalken, begleitet oben von einem frontal gestellten, geschirrten roten Ochsenhaupt, unten von einem aus einem Blatt und zwei Eicheln bestehenden roten Eichenzweig.
Das Figurenprogramm des Wappens von Lohbarbek orientiert sich primär am Ortsnamen. Der Name des 1525 erstmals als "Loobarbeke" erwähnten Ortes bezeichnet einen "Bach, der durch eine sumpfige Niederung oder einen Hain" fließt, wo "Eber oder Bären sind". Die Gemeinde nahm, dieser Namensdeutung folgend, stellvertretend für den Hain, einen Eichenzweig und für den Bach einen blauen Wellenbalken in ihr Wappen auf. Zwei der drei Wappenfiguren weisen damit "redend" auf den Ortsnamen hin. Als Bauerndorf war Lohbarbek durch Landwirtschaft, insbesondere Viehhaltung geprägt, die bis heute bedeutsam geblieben ist. So repräsentiert der Ochsenkopf im Wappen zugleich die vergangene und die gegenwärtige ökonomische Grundlage der Gemeinde. Die Farben Blau, Weiß (Silber) und Rot sind die Landesfarben Schleswig-Holsteins.
Von Silber und Blau im Wellenschnitt gesenkt geteilt. Oben eine rote Fachwerkscheune, begleitet von je einem grünen Stern in der rechten und linken Oberecke, unten ein silbernes Mühlrad.
Das Wappen zeigt die alte Scheune des Gutes Mehlbek und erinnert zugleich an die landwirtschaftliche Prägung der Gemeinde. Das Mühlrad ist eine Reminiszenz an den Ortsnamen „Möhlenbeke“, = Mühle am Fluss Bekau. Die grünen Sterne stehen für die verlorene Heimat der Flüchtlinge, die nach dem Zweiten Weltkrieg in diesem Ort eine neue Heimat fanden und die Gemeinde mit weiter entwickelten.
Heraldisch nicht beschreibbar. Wappenfiguren und Farben: Windmühle, blau.
Ein Sonderfall sind die heraldisch nicht beschreibbaren "Wappen" der Gemeinden Bekdorf, Huje, Kleve, Krummendiek, Moorhusen, Oldendorf und Willenscharen. Diese Gemeinden liegen im Kreis Steinburg. Strenggenommen handelt es sich nicht um Wappen, da Thematik und Darstellungsart diese Hoheitszeichen den Bildsiegeln zuordnen. Sie waren 1946 von der britischen Militärregierung genehmigt worden, ohne dass eine heraldische Prüfung stattgefunden hatte. So kommt es, dass diese "Wappen" nicht den heraldischen Darstellungsregeln entsprechen und in der heraldischen Terminologie nicht beschreibbar sind. Auch eine historische Begründung fehlt, dennoch lassen sie erkennen, was mit ihnen zum Ausdruck gebracht werden soll. So zeigt das Bildsiegel von Moorhusen die Jahrhunderte lange Auseinandersetzung mit dem Wasser in den tiefgelegenen Marsch- und Moorgebieten findet sich in Form von Deich und Schöpfmühlen. Näheres zu diesen Bildsiegeln bei: Martin Reißmann: Die Wappen der Kreise, Ämter, Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein (Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs 49), Husum 1997, S. 379-381.
Heraldisch nicht beschreibbar. Wappenfiguren und Farben: Haus, Nesselblatt, blau.
Ein Sonderfall sind die heraldisch nicht beschreibbaren "Wappen" der Gemeinden Bekdorf, Huje, Kleve, Krummendiek, Moorhusen, Oldendorf und Willenscharen. Diese Gemeinden liegen im Kreis Steinburg. Strenggenommen handelt es sich nicht um Wappen, da Thematik und Darstellungsart diese Hoheitszeichen den Bildsiegeln zuordnen. Sie waren 1946 von der britischen Militärregierung genehmigt worden, ohne dass eine heraldische Prüfung stattgefunden hatte. So kommt es, dass diese "Wappen" nicht den heraldischen Darstellungsregeln entsprechen und in der heraldischen Terminologie nicht beschreibbar sind. Auch eine historische Begründung fehlt, dennoch lassen sie erkennen, was mit ihnen zum Ausdruck gebracht werden soll. So zeigt das Bildsiegel von Oldendorf das Selbstverständnis als Bauerndorf und die Bindung an den Landesteil Holstein. Näheres zu diesen Bildsiegeln bei: Martin Reißmann: Die Wappen der Kreise, Ämter, Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein (Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchivs 49), Husum 1997, S. 379-381.
Von Silber und Rot schräglinks geteilt. Oben ein bewurzelter blauer Lindenbaum, unten ein linksgewendeter, krähender goldener Hahn.
Der Lindenbaum im Wappen der Gemeinde Ottenbüttel ist dem Wappen der mittelalterlichen Adelsfamilie Krummendiek entnommen; der Hahn bezieht sich auf den Preis der schleswig-holsteinischen Landesregierung in dem Wettbewerb "Schönes Dorf". Bereits für die erste Hälfte des 12. Jh. ist der landesherrliche Vogt Heinrich von Ottenbüttel urkundlich bezeugt, Stammvater eines Zweiges der Familie Krummendiek. Dieses in Holstein mächtige Geschlecht bestimmte über 400 Jahre die Ottenbütteler Geschehnisse, bis es 1598 ausstarb. 1969 wurde die Gemeinde Ottenbüttel von der Landesregierung als "Schönstes Dorf" Schleswig-Holsteins beurteilt und mit dem "Goldenen Hahn" ausgezeichnet. Es ist das Verdienst aller Bürger, daß das Dorf diese nicht eben häufige Auszeichnung erhalten hat, die heute als Bronzeplastik einen ehrenvollen Platz im Ort einnimmt. Die Abbildung des "krähenden Hahns" im Wappen hält sich an die Darstellung des Kunstwerks. Der Wappenentwurf verbindet die Erinnerung an das in festen Herrschaftsformen sich abspielende Leben in der Vergangenheit mit dem Hinweis auf die auf Gleichberechtigung beruhenden Verhältnisse der Gegenwart in Ottenbüttel. Die Farben sind diejenigen des Landeswappens.
Von Silber und Gold durch einen schräglinken grünen Wellenbalken gesenkt geteilt. Oben ein rotes achtspeichiges Rad in einem Kranz von acht grünen Birkenblätter, unten eine rote Urne.
Das Wappen der Gemeinde ist schräg geteilt durch das grüne Band des Ochsenweges, der seit Jahrhunderten durch die Gemeinde Führt. Der Kranz aus Birkenblättern steht für die acht Hufe, aus denen Peissen entstand. Das Rad im Inneren des Kranzes verweist auf die Land- und Forstwirtschaft, die noch immer die Haupterwerbszweige der Gemeinde bilden. Die tönerne Urne erinnert an die frühzeitlichen Funde auf dem Gemeindegrund, die davon zeugen, dass die Gegend bereits zur Zeit der Völkerwanderung besiedelt war.
Von Grün und Gold im Schlangenschnitt geteilt, oben drei grüne schräggestellte Lindenblätter 2:1, unten zwei goldene schräggestellte Lindenblätter 1:1,5.
Aus Anlass der 700-Jahr-Feier im Jahr 2003 hat die Gemeinde ein eigenes Wappen eingeführt.
Der Ortsname Schlotfeld leitet sich her von nd. Slotfeld = "Feld am Wassergraben, an der Wasserrinne" (W. Laur). Die S-förmige Schildteilung bezieht sich auf die Namensdeutung. Diese Wellenlinie symbolisiert zugelich die durch das Gemeindegebiet fließende in die Rantzau mündende Bek. Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes, der damals noch "Slotveld" geschrieben wurde, steht in Zusammenhang mit der Festlegung der Stadtgrenzen Itzehoes. Diese am 5. Oktober 1303 festgesetzten Grenzen haben sich für Schlotfeld bis zum heutigen Tage nur unwesentlich verändert. Es wird vermutet, daß die alte Dorflinde eine Art Grenzmarkierung gewesen ist. Die Lindenblätter sollen darauf hinweisen und an die alte Dorflinde erinnern, die im Jahre 1983 einem Orkan zum Opfer fiel. Die Gemeinde besteht aus den fünf Ortsteilen Amönenwarte, Rothenmühlen, Mühlenweg, Oesau und Schlotfeld als Ortskern. Die fünf Lindenblätter sollen zugleich diese fünf Ortsteile symbolisieren. Schlotfeld liegt im Süden des Naturraumes "Hohenwestedter Geest". Der Talraum der Bek und der Rantzau, ein Nebenfluss der Stör, verbindet das Gemeindegebiet mit der Störniederung. Die Farben Gelb (Gold) und Grün sollen die naturrämliche Lage und das sich daraus ergebende reizvolle durch landwirtschaftliche Nutzung geprägte Landschaftsbild am Rande des Naturparks Aukrug symbolisieren.
Von Gold und Grün in einer stärker gekrümmten Schlangenlinie erhöht geteilt. Oben links eine rote Pyramide, unten rechts ein goldenes auswärts weisendes Lindenblatt mit einem nach unten weisenden Fruchtstand.
Die Gemeinde Silzen führt seit dem Jahr 2003 ein eigenes Wappen.
Die Gemeinde Silzen ist ein kleines Haufendorf auf einem Geestrücken im Naturraum "Hohenwestedter Geest". Grabhügel in der Nähe des Ortes weisen auf eine frühe Besiedlung hin. Die S-förmige Teilungslinie symbolisiert den Geestrücken und die Hügelgräber sowie die angrenzenden Niederungsgebiete mit feuchten Wiesen- und Weideflächen. In seiner ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1342 heißt dieser Ort noch "de Selzingh" und weist auf seinen Ursprung hin. Silzen entstand aus dem Gutshof der adligen Familie von Seltslinger und läßt sich als "Ort des Selze" übersetzen (W. Laur 1992). Die rote Pyramide ist ein Zitat aus dem Familienwappen der Familie von Seltslinger. Sie symbolisiert die Gerichtsstätte im Hofe des Adelssitzes. Das Dorf liegt am Rande des Naturparks Aukrug in einer reizvollen Landschaft mit ausgedehnten Laubwäldern, Geestrücken und vermoorten Feuchtgebieten, die durch die Rantzau in die Stör entwässert werden. Das Grün im Schildfuß und das Gelb im Schildhaupt sollen auf diese attraktive Landschaft hinweisen. Das Gelb bezieht sich auch auf die wirtschaftliche Bedeutung des Kiesabbaus in der Gemeinde Silzen. Die Teilungslinie beschreibt zugleich das typische, durch den Kiesabbau geformte Relief der Landschaft am Rande der Abbaugebiete. Das Lindenblatt bezieht sich sowohl auf die ausgedehnten Laubwälder im Gemeindegebiet als auch auf die stattliche Lindenallee, die durch das Dorf führt.
Das Wappen der Gemeinde zeigt auf grünem Hintergrund einen von oben rechts nach unten links in Schlangenlinien verlaufenden silbernen Balken, welcher oben links und unten rechts von je einer auf dem Kopf stehenden silbernen Blütenglocke flankiert wird.
Der Wellenbalken symbolisiert die durch den Ort verlaufende Rantzau, die auch die Abbruchkante von der Marsch zur Geest darstellt. Die auf dem Kopf stehende Blütenglocke stellt die Schachbrettblume oder auch Schachblume dar, die in der Auniederung wächst. Der grüne Grund bezieht sich auf die Wiesen um Winseldorf.