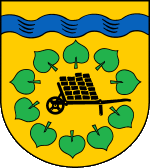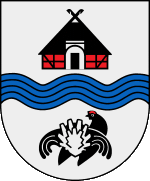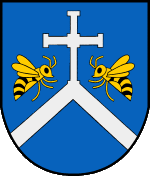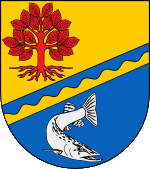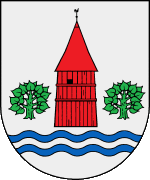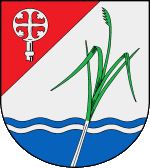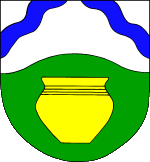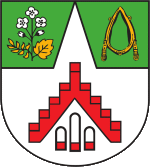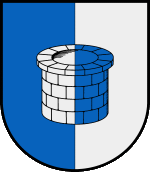Beschreibung der Wappen der amtsangehörigen Kommunen vom
Amt Leezen Über erniedrigtem roten Dreiberg und in diesem wurzelnd in Silber drei aus einer Wurzel wachsende, eine gemeinsame Krone bildende natürlich tingierte Birken.
Die Gemeinde liegt an der Barker Heide, ein 700 ha großes Naturschutzgebiet am Südrand des Segeberger Forstes. An diese geographische Lage erinnert der rote Dreiberg im Schildfuß. Die drei grünenden und aus einer Wurzel wachsenden Birken symbolisieren die enge Verbundenheit und Gleichwertigkeit der drei Ortsteile Bark, Schafhausen und Bockhorn, welche die heutige Gemeinde Bark bilden. Die Birken stehen auch "sprechend" für den Gemeindenamen Bark = (niederdeutsch) Birke.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Über silbernem, mit zwei blauen Wellenfäden belegten Wellenschildfuß in Gold ein erhöhter grüner Hügel, darin die goldene Blüte einer Sumpfdotterblume, links und rechts begleitet von je einem silbernen Rohrkolben mit schwarzen Kolben.
Die Gemeinde Bebensee liegt im Naturraum "Seengebiet der oberen Trave" zwischen dem Neversdorfer See im Süden und der mittleren Trave im Osten. Die Landschaft ist zudem gekennzeichnet durch kleinräumige Hügel und Täler. Die silbernen und blauen Wellenfäden im Schildfuß sowie der auf Gold dargestellte grüne Hügel im Schildhaupt symbolisieren und beschreiben diese reizvolle Landschaft. Der grüne Hügel bezieht sich zugleich auf ein Hügelgrab und damit auf die sehr frühe Besiedlung dieses Landschaftsraumes um Bebensee. Der Ortsname Bebensee früher "to deme bevende se" läßt sich mit "zum bebenden See" übersetzen und er bezieht sich auf bebenden Sumpfboden am Ufer oder auf Wasserpflanzen.(W. Laur, 1992). Die stilisierte Blüten der Sumpfdotterblume und die beiden Rohrkolben gehen auf die Namensdeutung ein. Die Sumpfdotterblume ist zugleich Symbol für die landwirtschaftlich genutzte Kulturlandschaft im Gemeindegebiet von Bebensee.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Gold unter einem blauen Wellenbalken ein schwarzer Torfkarren, umringt von zehn grünen Lindenblättern.
Das Fredesdorfer Moor, im Wappen dargestellt durch den Wellenbalken, bildet das Quellgebiet der Schmalfelder Au, die eine wesentliche Bedeutung in der Be- und Entwässerung der Region hat (z. B. Wasser- und Bodenverband Schmalfelder Au). Im Zentrum des Ortes befindet sich ein das Ortsbild prägender und mit Linden umsäumter Dorfanger, der früher wie heute Mittelpunkt des kulturellen Dorflebens ist. Dieser Dorfanger wird durch den Ring aus zehn Lindenblättern symbolisiert. Die zehn Lindenblätter stehen gleichzeitig für die zehn Vollhufen, die im 19. Jahrhundert das Dorf bildeten. Der Torfkarren weist auf die geografische Lage des Ortes am Ostrand des Fredesdorfer Moores hin. Der Torfabbau hatte bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts eine große wirtschaftliche Bedeutung für die Bevölkerung.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Silber ein blauer Wellenbalken, darüber die Giebelseite eines Bauernhauses mit schwarzem Dach unter Giebelbrettern in Form von abgewendeten Pferdeköpfen über silbernem Eulenloch, roter Mauerung zwischen schwarzem Fachwerk und silbernem Dielentor mit schwarzer Schlupftür; darunter ein Birkhahn in Imponierstellung mit schwarzem Gefieder, silbernen Schwanzfedern und roter Kopfzeichnung.
Die Teilung des einheitlich silbernen Wappenschildes der Gemeinde Groß Niendorf durch den blauen Wellenbalken entspricht der Topographie. Der Ort wird durch die Groß Niendorfer Au in zwei Ortsteile geteilt, die sich in gleicher Ausdehnung auf beiden Seiten des Wasserlaufs erstrecken. Die Landwirtschaft ist bis heute für das Wirtschaftsleben in Groß Niendorf bestimmend geblieben. Die für die frühere Zeit typischen bäuerlichen Fachwerkhäuser wurden als kombinierte Wohn- und Wirtschaftsgebäude benutzt und bildeten über Jahrhunderte die Lebens- und Arbeitswelt der Ortsbewohner. Die umliegenden Moorgebiete beherbergten früher zahlreich den heute selten gewordenen Birkhahn. Die Jägerschaft des Ortes ist bemüht, das Birkwild durch Pflege der Moorflächen wieder heimisch zu machen.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Blau ein silberner mit einem Balken-Firstkreuz bestecker Sparren, rechts und links je eine goldene Biene.
Die Gemeinde Högersdorf im Amt Leezen grenzt im Südwesten an die Kreisstadt Bad Segeberg. Sie liegt an dem historischen Landweg von Segeberg nach Hamburg, im Verlaufe der heutigen Hamburger Chaussee und der neueren Autobahn A 21. Högersdorf (Hagerestorp) wird erstmalig 1138 erwähnt im Zusammenhang der von Vicelin betriebenen Neurichtung des ersten zerstörten Segeberger Klosters. 1149 soll hier eine Klosterkirche geweiht worden sein, 1152 ein Hospital. 1155 siedelt das Kloster wieder auf seinen alten Standort über. Das Firstkreuz auf dem Sparren steht für das ehemalige Kloster und die Klosteranlage Högersdorf sowie die Häuser des Dorfes, in den Wohnen und Arbeiten unter einem Dach stattfanden. Die Bienen versinnbildlichen die intakte Natur. Högersdorf stellt mit seinen landwirtschaftlich genutzten Flächen die notwendige Blütentracht für das Zentrum der schleswig-holsteinischen Bienenzucht in Segeberg. Der blaue Grund steht für die durch die Gemeinde fließende Trave und die vielen Feuchtbiotope Högersdorfs.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Gold und Blau durch einen in verwechselten Farben im Wellenschnitt geteilten Schräglinksbalken gesenkt geteilt, oben eine rote Rotbuche, unten ein aufgebogener silberner Hecht.
Oben rechts im Wappen ist eine Rotbuche (Blutbuche) dargestellt. Diese Rotbuchen wurden nach dem großen Brand von 1866, der fast das gesamte Dorf auslöschte, als Zeichen der Verbundenheit und Erinnerung gepflanzt. Sie bestimmen auch heute noch das Dorfbild. In der Schildteilung finden wir in einer Wellenlinie die Kükelser Au wieder, die den Mözener See und den Neversdorfer See verbindet. Kükels liegt am Mözener See. Zur Besiedelungszeit hieß der See "Kukelze" und ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Namensgeber für die Gemeinde Kükels. Dieses wird durch einen Hecht symbolisiert, da der See in seiner natürlichen Art erhalten wird. Das Wappen der Gemeinde ist gestiftet vom jetzigen Bürgermeister Holger Möller.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Silber über einem blauen Zwillingswellenbalken ein roter hölzerner Glockenturm, in der unteren Hälfte beiderseits begleitet von einem grünen Lindenbaum.
is 1870 stand in Leezen eine im 12. Jahrhundert erbaute Feldsteinkirche, die 1870 bis auf den hölzernen Glockenturm abgerissen wurde. Dieser wurde in den 1871 erstellten Neubau einbezogen. Die Wellenbalken im Schildfuß verweisen auf die Lage der Gemeinde am Neversdorfer See. Die Linden beziehen sich auf den einzigartigen, von Linden umstandenen Dorfplatz im Zentrum von Leezen und symbolisieren die beiden Ortsteile Krems I und Heiderfeld.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Über blauem Wellenschildfuß mit einer silbernen Wellenleiste unweit der Teilungslinie ein leicht schräg links gestellter grüner, unten silberner Schilfhalm. Im rechten oberen Schrägeck ein abgebrochener silberner Krummstab.
Der 1137 erstmals erwähnte Ort Mözen (vorm. Mozinke, Moitzing) - ein Dorf an der Chaussee von Altona nach Segeberg, in romantischer Lage an dem teilweise mit hohen bewaldeten Ufern umgebenen Mözener See - gehörte ehemals mit dem See der Grundherrschaft des Segeberger Klosters an. Im Wappen wird dies bildlich herausgestellt durch den abgebrochenen Krummstab, der auf rotem Grund die Seeblätter aus dem Wappen des Kreises Segeberg aufzeigt. Der Wellenschildfuß ist Hinweis auf den Mözener See und die Mözener Au, welche in die Trave fließt. Der grüne Reethalm steht für die üppige und erhaltenswerte Ufervegetation am Mözener See.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Über einen blauen Wellenschildfuß, darin ein nach links gewendeter silberner Zander, in Silber ein schwebender abgeflachter und links den Schildrand anstoßender Hügel, der mit drei schwarzstämmigen grünen Laubbäumen bestanden ist. Im linken Obereck ein breiter schrägrechter blauer Wellenbalken.
Der Wellenbalken im Wappen der Gemeinde weist auf das im östlichen Gemeindegebiet verlaufende Travetal. Die Halbinsel im Neversdorfer See mit dem historisch durch Funde und Grabungen belegten slawischen Ringwall (11.-12. Jh.), wird heute als "Kräheninsel" bezeichnet und prägt den westlichen Teil des Sees. Die drei sichtbaren Baumstämme erinnern an die drei Junker vom Neversdorfer See, die nach der ältesten Aufzeichnung im Pfarrarchiv von 1564 der Kirche in Leezen 100 Tonnen Land für eine Seelgerätstiftung geschenkt haben. Der Zander steht für den reichen Fischbestand im See, die frühere wirtschaftliche Bedeutung und den heutigen Freizeitwert des Sees. Die Teilung des Wappens im Wellenschnitt soll auf die geographische Lage des Ortes am gleichnamige See hinweisen.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Silber unter einem erhöhten schräglinken und schrägrechten blauen Wellenbalken ein grüner Hügel, darin eine goldene Urne.
Die zwei Wellenbalken im Wappen von Schwissel weisen auf die im Gemeindegebiet verlaufenden Flüsse Mäzener Au und Trave hin. 1137 stiftet Kaiser Lothar III. das Kloster Segeberg. In diesem Zusammenhang wird Schwissel erstmals unter dem vorgermanischen Namen Zuizle als Teil der klösterlichen Besitzungen urkundlich erwähnt. Der leicht eingebogene Hügel bezieht sich auf die zahlreichen Hügel- und Steingräber, die sich westlich und nördlich des Ortes befinden. Auf einem Gebiet von 1,5 x 2,0 Kilometern lassen sich etwa 30 Gräber dieser Art nachweisen, die zum größten Teil der Bronzezeit zugeordnet werden. Die Urne steht in dieser Form für ein großes Urnengräberfeld der vorrömischen Eisenzeit, das während des Baus der Kreisstrasse 12, Anfang des 20. Jahrhunderts, und beim Bau der Bundesstrasse 404, im Jahre 1956, gefunden wurde.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Grün und Silber durch einen unten abgewinkelten schmalen Keilschnitt erhöht geteilt. Oben rechts ein dreiblütiges silbernes Wiesenschaumkraut mit einem goldenen gefiederten Blatt rechts und einem goldenen gezahnten Blatt links, oben links ein goldenes Pferdegeschirr (Kumt), unten ein schwebender roter Treppengiebel mit drei roten Rundbogenfenstern.
Das Wiesenschaumkraut im Wappen der Gemeinde Todesvelde ist ein Hinweis auf die Lage des Ortes entlang von Moor und feuchten Wiesen im Westen der Gemeinde. Die Gemeindebezirke Poggensahl und Voßhöhlen (Sahl/Söhlen = Sumpf) benennen diese Lage. Die unterschiedlichen Blätter symbolisieren die Ortsteile Todesfelde (Ortslage) und Voßhöhlen (Streusiedlung). Das Kumt, ein Pferdegeschirr, erinnert an die jahrhundertelang betriebene Landwirtschaft und ein florierendes Handwerk. Seit 1898 bildet Todesfelde einen selbständigen Kirchspielbezirk mit einer eindrucksvollen 1900 geweihten Kirche. Das dargestellte Motiv, Treppengiebel mit Kirchenfenstern, befindet sich über dem Eingangsportal und ist ein typisches architektonisches Stilelement des Baustils um 1900. Die Schildteilung mit der aufsteigenden Spitze verstärkt die Wichtigkeit der Kirche als Mittelpunkt eines lebendigen Gemeindelebens im Ort.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Gespalten von Blau und Silber, überdeckt mit einem aus Werkstein gemauerten Brunnen mit breitem Rand in verwechselten Farben.
Die zur Erstausstattung des 1136 gegründeten Klosters Segeberg gehörende Gemeinde Wittenborn liegt an der Landstraße von Bad Bramstedt nach Segeberg (heute B 206). Die Eigenschaft als Klosterdorf ist der Grund für die verhältnismäßig frühe Erwähnung des Ortes (1137). Die Spaltung des Wappens in zwei gleiche Felder macht deutlich, daß die heutige Gemeinde in ältester Zeit wahrscheinlich aus zwei gleichnamigen Dörfern zusammengewachsen ist, von denen das eine wohl noch slawische Bevölkerung hatte.Der Brunnen im Gemeindewappen bezieht sich auf den Ortsnamen und weist dem Wappen damit den Charakter eines "sprechenden" Wahrzeichens zu. Die Tinktur des Wappens in den beiden für die Darstellung von Wasser in der Heraldik üblichen Farben, Blau und Silber, deutet darauf hin, daß der Ort Wittenborn in der Nähe des Mözener Sees gelegen ist, der das Gemeindegebiet an der südöstlichen Seite begrenzt. Auf der sandigen, um die Mitte des 19. Jh. noch große Heideflächen einschließenden Feldmark befanden sich mehrere Hünengräber. Wege der Flugsandgefahr wurde der ältere Waldbestand durch Neuanpflanzungen ergänzt.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen.