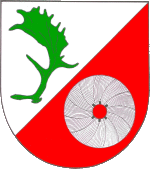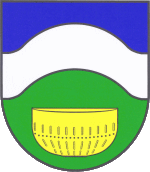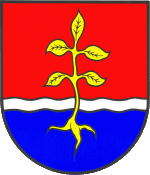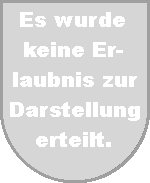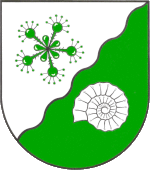Beschreibung der Wappen der amtsangehörigen Kommunen vom
Amt Bornhöved In Blau der freischwebende holsteinische Wappenschild (in Rot ein silbernes Nesselblatt), auf dessen oberem Rand ein schwarzes flaches Gefäß (Quelleneinfassung) steht, aus dem nach rechts und links je drei lange Wellenlinien sich an beiden Seiten des Nesselblatts herunterziehen. Über der Quelle ein schwebendes goldgelocktes Menschenhaupt.
Das Gemeindewappen ist zunächst "redend" gemeint. Der Name Bornhöved bedeutet "Quellenhaupt". Dieses wird durch die wasserspeiende Schale und den darüber schwebenden Kopf ausgedrückt. Die Bezeichnung "Quellenhaupt" geht darauf zurück, daß Eider, Stör und Schwentine auf dem Höhenrücken von Bornhöved entspringen. Das holsteinische Nesselblatt deutet nicht nur auf die Zugehörigkeit des Ortes zu Holstein, sondern verweist auch auf mehrere für die Geschichte Holsteins wichtige Ereignisse: Nach der Schlacht auf dem "Schwentinefeld" von 798, in welcher Karl der Große im Bündnis mit den Abodriten die Sachsen bezwang, wurde das Gebiet slawisch besiedelt. Am 22. Juli 1227 besiegten hier Graf Adolf IV. und andere norddeutsche Fürsten und Städte den dänischen König Waldemar II. Dies bedeutete das Ende der dänischen Herrschaft über weite Gebiete des Ostseeraums. Im Mittelalter hielt der holsteinische Adel auf dem "Viert" bei Bornhöved seine Versammlungen ab. In dieser Zeit hatte der Ort möglicherweise für einige Jahrzehnte Stadtrecht. 1813 schließlich fand hier ein Gefecht zwischen dänisch-schleswig-holsteinischen und schwedisch-russisch-preußischen Truppen statt. Das Wappen wurde in Anlehnung an ein "Stadtsiegel" des 15. Jh. gestaltet. Überlegungen, die heraldischen Härten zu mildern, wurden nicht verwirklicht.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Silber und Rot schräg links geteilt. Vorn eine aufrechte grüne Damwildschaufel, hinten ein silberner Mühlstein.
Die Grundfarben des Wappens, Rot und Silber, sind die holsteinischen. Die Damwild-schaufel weist auf den Namen des Ortes, auf die natürliche Landschaft und den Wildreichtum hin, der Mühlstein auf die Landwirtschaft, die früher die hauptsächliche Erwerbsgrundlage bildete, und speziell auf die im 18. Jahrhundert entstandene und 1941 abgebrochene Korn- und Graupenwindmühle.
Von Blau und Grün erhöht geteilt durch ein breites silbernes Wellenband, bestehend aus einem halben Wellental, einem Wellenberg und einem halben Wellental, darunter eine goldene Schüssel.
Die blaue Farbe steht für das Quellgebiet der Schwale, silber bzw. weiß soll den hellen Sand der Gönnebeker Heide symbolisieren und die Erhöhung steht für den sog. Schwarzen Berg in dessen vier Grabkammern u. a. die ebenfalls aufgeführte goldene Schale gefunden wurde.
Durch einen silbernen Wellenfaden erniedrigt von Rot und Blau geteilt, überdeckt mit einem fünfblättrigen, bewurzelten goldenen Schößling
Die einzige Figur im Gemeindewappen von Schmalensee stellt ein Zitat aus dem Wappen der adligen Familie Schmalensee dar. Dabei ist die Figur des Schößlings dem Wahrzeichen des ostdeutschen Zweiges der Familie entlehnt, da das Wappen der holsteinischen Familie Schmalensee, die in Urkunden des 14. Jh. faßbar ist, nicht überliefert ist. Die Übernahme dieses Wappens ist aber nicht nur sprachlich durch die Namensidentität zwischen Ort und Familie begründet, sondern auch historisch durch die zwar nicht beweisbare, aber doch wahrscheinliche Annahme, daß die Familie Schmalensee sich nach dem holsteinischen Ort bzw. See gleichen Namens benannt hat. Im Unterschied zum Ursprungswappen erfolgt die Tingierung des Wappenschildes in den Farben Blau-Weiß-Rot, wodurch die Zugehörigkeit der Gemeinde zum Bundesland Schleswig-Holstein zum Ausdruck gebracht wird. Der "Schmale See", an dem sich der Ort erstreckt, hat als Wellenfaden, der die besondere Form des Gewässers im Unterschied zu einem mit einem Wellenbalken wiederzugebenden See normalen Zuschnitts im Gemeindewappen seinen Niederschlag gefunden.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Silber und Blau im Wellenschnitt geteilt. Oben zwischen zwei roten bewurzelten Baumstümpfen ein grünes Ährenbündel, unten ein silberner Einbaum.
Stocksee, 1347 erstmalig urkundlich erwähnt, liegt am gleichnamigen See. Die Baumstümpfe erklären den historischen Begriff "Stock = Stumpf = Baumstumpf; Stocksee = See bei den Stöcken". Die grüne Ähre steht für den Haupterwerbszweig, die Landwirtschaft. Das Blau und die Wellenlinie symbolisieren den eigentlichen See; der Einbaum erinnert an den Bootsfund im See 1985. Es stammt wahrscheinlich aus dem 13. Jahrhundert.
Von Silber und Grün im Wellenschnitt schräglinks geteilt. In verwechselten Farben oben die Moorpflanze Sonnentau, unten ein Ammonit.
Der Ort wurde erstmals 1342 in einer Segeberger Urkunde als "Tentzefelde" erwähnt. Der Name wird vermutlich in Anlehnung an den slawischen Personennamen "Tenzo" als "Feld des Tenzo" entstanden sein. Die Wellenteilung des Wappens bezieht sich auf die Tensfelder Au, die das Hochland von der Niederung mit den Wiesen und einem ausgedehnten Moor trennt. Der vom Aussterben bedrohte Sonnentau, eine fleischfressende Pflanze, vertritt das Moor bei Tensfeld. Der seit 1914 stattfindende Kiesabbau in der Feldmark, dort neben der Ackerwirtschaft ein wichtiger Erwerbszweig, ist durch den Ammonit symbolisiert.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Grün eine goldene Spitze.
Das Wappen von Trappenkamp ist eindrucksvoll nach Art eines mittelalterlichen Heroldsbildes konzipiert und gibt die keilförmig in den Wald geschlagene Siedlungsfläche wieder. Im Schutz des großen Waldgebietes auf der zur Gemeinde Rickling gehörigen Gönnebeker Heide entstand ab 1936 ein Marinesperrwaffenarsenal. Bei der ebenfalls 1936 erfolgten Umbenennung in "Trappenkamp" griff man auf den Namen eines zur Gemeinde Tarbek gehörenden benachbarten Flurstücks zurück. Nach Kriegsende entwickelte sich Trappenkamp zu einer provisorischen Siedlung der Heimatvertriebenen. Seit 1946 siedelten sich Gablonzer Glasbläser aus dem Sudetenland hier an, aber die schwierigen Nachkriegsverhältnisse erschwerten den Aufbau einer Glas- und Schmuckwarenindustrie im Norden. Die Glashütten-Siedlung wurde 1949 als Ortsteil in Bornhöved eingemeindet. 1956 erhielt Trappenkamp die Rechtsstellung einer selbständigen Gemeinde.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen.