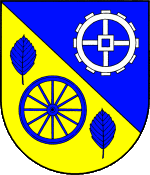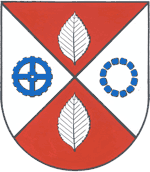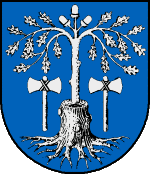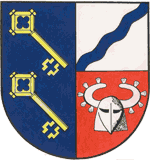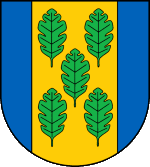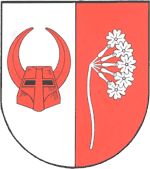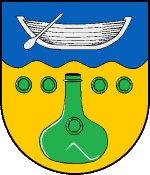Gespalten. Vorn in Blau ein liegender silberner stilisierter Adlerkopf am Spalt mit dem Schnabel nach oben, hinten in Rot ein aufgerichteter goldener Löwe.
Das Bosauer Wappen wurde 1952 von Gerhard Pause geschaffen (gestorben 1971 in Flensburg). Anlaß war die Achthundertjahrfeier von Dorf und Kirche Bosau.
Zur Heraldik des Wappens ist zu bemerken, daß die Frühgeschichte Bosaus die Anregung zu den Emblemen gab.
Das Wappenschild ist senkrecht gespalten. Das linke Feld ist blau, wie die Fläche des großen Sees. Ein weißer senkrecht gestellter Adlerkopf symbolisiert die Halbinsel Bosau in den See hinein, mit dem großen Warder als Ober- und dem kleinen Warder als Unterschnabel. Das Auge bezeichnet etwa den Platz der Kirche auf der Halbinsel.
Der Adlerkopf erinnert auch an die Förderung der germanischen Rückbesiedlung gegen die Slawen unter Heinrich dem Löwen, weil sich damit gewissermaßen der deutsche Adler hier im Lande wieder niedergelassen hat. Den Naturfreund erinnert dieses Symbol aber auch an die Tatsache, daß der Große Plöner See Brutgebiet des deutschen Wappenvogels ist, des Seeadlers.
Im rechten roten Feld ist der aufsteigende Löwe verwendet, das Wappentier von Herzog Heinrich.
Dem Lokalpatrioten präsentieren sich die Feldfarben als die blauroten Landesfarben des Herzogtums Oldenburg, der Unbefangene erkennt in der Farbenskala des Wappens die Landesfarben Schleswig-Holsteins, blau-weiß-rot.
Das obige „Gebrauchswappen“ verleiht gewisssen Papieren und Schriftstücken des täglichen Lebens den Charakter von Urkunden. Es wird daher verwendet für Stempel, Siegel und Klischees.

Daneben besitzt Bosau ein Prunkwappen. Dieses trägt den Charakter des Einmaligen und Festlichen. Es ist daher immer handgearbeitet und findet Verwendung auf künstlerisch gestalteten Urkunden, dient als Wandschmuck und als Geräteschmuck.
Die Gestaltung des Schmuckwappens geht in der Idee, den Elementen und der Ausführung ebenfalls auf Gerhard Pause zurück.
Über dem Schild ist eine Reetkante dargestellt mit rechts und links einfliegenden Schwänen, den auffallenden Großvögeln auf dem See. Die Schwäne sind umschlungen von einer stilisierten blauen Woge.
Umrahmt wird das Schild von Hopfengerank. Hopfen ist eine weit verbreitete Unkrautpflanze in der Holsteiner Knicklandschaft.
Durch seine interessante Blattform und sein üppiges Geranke ist der Hopfen Augenweide und Unkraut zugleich.
Im Gerank sind die Anfangsbuchstaben der Vierzehn Ortschaften eingestellt, die mit Bosau als der fünfzehnten die Gemeinde Bosau bilden.
Im Ganzen spiegelt das Schmuckwappen die Schönheit der Ostholsteiner Landschaft wider und ihre biologische Einmaligkeit in Mitteleuropa.
Wanderer, kommst du nach Bosau, so sage und erzähle, du habest deutsche Geschichte und deutsche Landschaft erlebt.
Von Blau und Gold schräg geteilt. Oben ein silbernes Mühlrad, unten ein blaues Wagenrad, begleitet oben rechts und unten links von je einem aufrechten blauen Erlenblatt.
Die Gemeinde Dersau im Amt Plön-Land grenz}: im Norden an die Gemeinde Ascheberg, im Westen an die Gemeinden Kalübbe, Stocksee und Belau, im Süden an die Gemeinde Nehmten. Im Osten bildet der Große Plöner See die natürliche Gemeindegrenze. Das Dorf Dersau gehörte viele Jahrhunderte zum Gut Ascheberg selbst, später wie die Dörfer Kalübbe und Langenrade (heute Ortsteil der Gemeinde Ascheberg) zum Erbpachtdistrikt des Gutshofes. Nach dessen Auflösung zum Amtsbezirk Ascheberg und seit 1977 zum Amt Plön- Land. Das Blau steht für den Großen Plöner See, das Gold für das "goldene" Land mit großflächigem Getreide- und Rapsanbau, die Erlenblätter für den reichen Naturraum und Baumbestand. Das Mühlenrad steht für den ehemalig bedeutenden Mühlenstandort im Gutsbezirk Ascheberg mit einer Wasser- und einer Windmühle. Das Wagenrad steht für das Straßendorf Dersau an der historischen Hauptverkehrsachse Segeberg-Kiel mit heute noch erhaltenen (drei) Ausspanngasthöfen.
Von Silber und Blau im Wellenschnitt geteilt. Oben ein aus zwei überkreuz gestellten stilisierten Pferdeköpfen bestehendes rotes Giebelbrett, unten ein silbernes Boot mit seitlichem Steuerruder.
Die über Kreuz gestellten stilisierten Pferdeköpfe sind heute noch auf dem ehemaligen Rinderstall (heutiges Wohnhaus) und dem alten Pferdestall des Reiterhofes Hohelieth zu sehen.
Von Rot und Silber schräg geviert. 1 und 4 ein silbernes Hainbuchenblatt, 2 ein blaues Mühlrad, 3 ein zwölfgliedriger blauer Steinkreis.
Die Quadrierung des Wappens der Gemeinde Grebin bezieht sich auf die vier Ortsteile. Nach Auflösung der Gutsbezirke im Jahre 1928 wurde die heutige Gemeinde Grebin aus dem Gutshof Schönweide, den vormals dazu gehörigen Dörfern Grebin und Görnitz und dem Ort Behl gebildet. Das doppelt vertretene Buchenblatt gibt bildlich Auskunft über den Gemeindenamen. Grebin bedeutet im Slawischen "Hainbuche" bzw. "Hainbuchengehölz". Mit Buchen bewachsen ist auch die frühgeschichtliche Nekropole am Timmberg, auf die der Steinkreis hinweist, der zugleich ein Zeugnis für die frühe Besiedlung des Raumes ist. Das Mühlrad erinnert an die historische Wassermühle des Gutes Schönweide und damit in einem allgemeineren Sinn an die Gutsherrschaft, der die Dörfer Grebin und Görnitz über Jahrhunderte unterstanden. Die Farben des Wappens entsprechen den schleswig-holsteinischen Landesfarben.
In Blau ein bewurzelter silberner Eichenstumpf, aus dessen Mitte ein silberner, oben in einen Fruchtstand mit drei Eicheln mündender junger Eichbaum hervorwächst, beiderseits begleitet von je einem aufrechten, doppelschneidigen silbernen Steinbeil.
Der Eichenstumpf mit dem aus der Mitte herauswachsenden jungen Eichbaum ist sowohl als bildliche Wiedergabe des Ortsnamens wie auch als Sinnbild für die Entstehungsgeschichte des Ortes zu verstehen. Der Name des als slawisches Dorf gegründeten Kalübbe kann auf das altpolabische Wort "kadelub" zurückgeführt werden, welches "Rumpfbaum" bedeutet. Der Eichenstumpf ist deshalb als wörtliche Umsetzung des Ortsnamens zu verstehen. Zugleich wird durch ihn auf den Rodungsvorgang und, durch den Schößling, auf das daraus sich entfaltende dörfliche Leben verwiesen. Der Ort wird 1341 als "Karlybbe" erstmals erwähnt. Die Besiedlung dieses Gebietes schon während der Steinzeit ist jedoch anhand zahlreicher Funde zu belegen. Als Zeichen für diese vorgeschichtliche Epoche stehen die beiden Steinbeile im Wappen. Kalübbe ist der bisher nördlichste Fundort eines Faustkeils, welcher ca. 70 000 Jahre alt ist. Die Dreizahl der Eicheln an dem Eichenschößling soll daran erinnern, daß Kalübbe zusammen mit Dersau und Ascheberg früher zum Gut Ascheberg gehört hat. Die einstige Solidarität unter der Gutsobrigkeit hat sich auch nach der Bildung selbständiger Gemeinden im Jahre 1867 bis heute erhalten. Die blaue Schildfarbe deutet auf die vielen Seen in der Region hin.
Gespalten und hinten geteilt. Vorn in Blau zwei schräggestellte goldene Schlüssel, hinten oben in Silber ein schräglinker blauer Wellenbalken, unten in Rot ein silberner Topfhelm mit zwei außen mit Federbüscheln besteckten Hörnern.
Die heutige Gemeinde Lebrade ist 1928 aus den Dörfern Lebrade und Kossau sowie dem Gutshof Rixdorf gebildet worden. Bei der Auflösung der Gutsbezirke wurde der sehr große Rixdorfer Bezirk auf die drei Gemeinden Lebrade, Mucheln und Rathjensdorf (bsi 1949: Tramm) aufgeteilt. Der in drei Plätze geteilte Wappenschild weist auf die Zusammensetzung der Gemeinde Lebrade aus drei weit auseinanderliegenden Siedlungskernen hin. Die rechte Schildhälfte zeigt zwei Schlüssel. Es sind dies die Kerkerschlüssel des römischen Kerkermeisters Hippolyt, des Bewachers des heiligen Laurentius. Hippolyt starb später selbst als christlicher Märtyrer; als solcher ist er Patron der Lebrader Kirche. Der Wellenbalken im linken oberen Feld steht für die Kossau, die auf dem Gebiet der Gemeinde entspringt und um die sich die drei Gemeindeteile geographisch gliedern. Sowohl Lebrade als auch Kossau hatten über Jahrhunderte zum Gut Rixdorf gehört. Daran erinnert in der linken unteren Hälfte des Schildes der Büffelhelm mit den aufgesetzten Federn. Die Darstellung dieses Helms entstammt dem 1349 bezeugten Siegel des Ritters Johann von Rixdorf oder, wie der Name damals lautete, "Ricklikesdorp". Die Farben sind diejenigen des Landeswappens.
In Blau ein breiter goldener Wappenpfahl mit fünf grünen gestellten Eichenblättern 2 : 1 : 2.
Die Gemeinde Nehmten im Amt Plön-Land liegt zwischen dem südwestlichen Ufer des Großen Plöner Sees und umfasst den nördlichen Teil des Stocksees, im Westen grenzt sie an die Gemeinden Dersau und Stocksee, im Süden an die Gemeinde Seedorf. Die heutige Gemeinde Nehmten besteht aus fünf Ortsteilen: dem Gutshof Nehmten, erste Erwähnung im Jahre 1244, dem 1351 erstmals erwähnten Hof Pehmen sowie den 1433, 1244 und 1649 erstmals bezeugten Dörfern Sepel, Godau und Bredenbek. Die heutige Gemeinde ist entstanden durch die Zusammenfassung des Gutshofes Nehmten und der bis 1777 zum herzoglichen Amt Plön gehörenden Dörfern Bredenbek und Pehmen im Jahre 1928. Die fünf grünen Eichenblätter stehen für die fünf Gemeinde teile und gleichzeitig die größten und ältesten Eichwaldbestände im Kreis Plön. Die durch den Wappenpfahl verbliebenen blauen Wappenfelder stehen für den Stocksee und den Großen Plöner See.
Von Silber und Rot gespalten. Vorn in Frontalsicht ein Topfhelm mit mondsichelförmigen Büffelhörnern, hinten eine abgerissene Schlüsselblume, deren fünf Blüten auswärts weisen, in verwechselten Farben.
Der gespaltene, rot-silberne Schild ist das Wappen der Adelsfamilie Rantzau, des lange Zeit zahlreichsten und mächtigsten der holsteinischen Adelsgeschlechter. Der Helm mit den Büffelhörnern geht gleichfalls auf frühe sphragistische Zeugnisse dieses Wappens zurück und betont seinerseits die historische Verbindung des Ortes mit der gleichnamigen Familie. Der ursprüngliche Ort "Ranzov" und die Adelsfamilie, die sich nach diesem Ort nannte, werden 1226 erstmals erwähnt. Die heutige Gemeinde Rantzau ist 1928 nach Aufhebung des gleichnamigen Gutsbezirks entstanden. Das Gut war bis ins 18. Jh. im Besitz der Familie Rantzau, zuletzt des Breitenburger Zweiges, und hatte zahlreiche Besitzer mit bekanntem, in der Landesgeschichte klangvollem Namen. Die Schlüsselblume im Wappen schlägt den Bogen in die Gegenwart. Etymologisch liegt dem Ortsnamen vielleicht das slawische Wort "ran" in der Bedeutung "früh", "frühzeitig" zugrunde. Die Einbeziehung des "Frühblühers" Schlüsselblume (primula elatior) in das Gemeindewappen ist aber nicht nur durch den Ortsnamen begründet, sondern vor allem durch das unter Naturschutz stehende Kossautal, das wegen seiner seltenen Pflanzen bekannt ist. Schließlich weist die Fünfzahl der Blüten und Blütenteile darauf hin, daß die Gemeinde aus fünf Ortsteilen besteht.
Von Rot und Gold schräglinks geteilt. Vorn ein oben abgeflachter silberner Topfhelm des 13. Jahrhunderts, besetzt mit zwei silbernen, außen mit Dornen besteckten Rädern (Helmzier), hinten ein vierblättriges grünes Kleeblatt.
Der ritterliche Helm im oberen Teil des Wappens der Gemeinde Rathjensdorf ist dem Siegel eines "Johann von Ratmerstorp" aus dem Jahre 1336 entlehnt. Er legt Zeugnis ab von der adligen Grundherrschaft, welche das Leben in der Frühzeit des Ortes Rathjensdorf bestimmte. Ihr verdankt Rathjensdorf seine verhältnismäßig frühe Erwähnung in einer schriftlichen Quelle (1246). Die Identität zwischen dem historischen "Ratmerstorp" und dem heutigen Rathjensdorf ist zwar nicht sicher, aber doch wahrscheinlich. Das vierblättrige Kleeblatt im unteren Teil des Wappens weist auf die Entstehung der Gemeinde Rathjensdorf nach der Auflösung des Gutsbezirks Rixdorf 1928 hin, als die heutigen Gemeindeteile Theresienhof, Tramm, Neutramm und Rathjensdorf vereinigt wurden, und zwar bis 1949 unter dem Namen "Tramm". Die drei Meierhöfe und das Gutsdorf Rathjensdorf hatten über Jahrhunderte zum Gut Rixdorf gehört. Das Gut ist heute Bestandteil der Gemeinde Lebrade. Der Sinngehalt des Kleeblattes als Glückszeichen soll auch für die wappenführende Gemeinde gelten.
Von Blau und Gold im Wellenschnitt erhöht geteilt. Oben ein silbernes Boot, unten ein grüne Glasflasche (Bocksbeutel) mit Siegel, begleitet von je zwei grünen Glassiegeln rechts und links.
Die Gemeinde Wittmoldt im Amt Großer Plöner See grenzt im Norden an die Gemeinde Wahlstorf, im Osten an die Gemeinden Lehmkuhlen und Rathjensdorf im Süden an die Stadt Plön mit dem Kleinen Plöner See und im Westen an die Gemeinde Dörnick mit dem hier breiten Flusslauf der Schwentine. Das Gut Wittmoldt wird, vermutlich dem Geschlecht der Familie von Moldt zugeordnet, mehrfach im 14. Jahrhundert erwähnt. Im Laufe der Geschichte gehörte es zum Besitz fast aller bekannten adligen Geschlechter der Herzogtümer Schleswig und Holstein, seit 1893 bis heute der Familie von Bülow. Die heutige Gemeinde wurde nach Auflösung der adeligen Gutsbezirke im Jahre 1928 gegründet. Sie besteht heute aus insgesamt fünf Siedlungskernen. Aufgrund der Vorkommen von geeigneten Sanden und dem Brennstoff Holz gab es in Wittmoldt im Verlaufe des 18. Jahrhunderts eine bedeutende Glasmanufaktur insbesondere zur Herstellung von Flaschen. Die Wellenlinie und das Blau stehen für die Gewässer Schwentine und den Kleinen Plöner See im Gemeindegebiet. Das silberne Boot, das in spiegelbildlicher Form Figur im Wappen der Nachbargemeinde Dörnick verwendet wird, steht für die diese beiden Orte verbindende historische Fähre über die Schwentine. Die grüne Flasche für die bedeutende historische Glashüttenkultur in der Gemeinde sowie die Anzahl der insgesamt fünf Glassiegel für die Siedlungsplätze der heutigen Gemeinde.


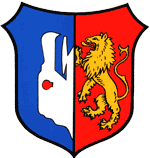
 Daneben besitzt Bosau ein Prunkwappen. Dieses trägt den Charakter des Einmaligen und Festlichen. Es ist daher immer handgearbeitet und findet Verwendung auf künstlerisch gestalteten Urkunden, dient als Wandschmuck und als Geräteschmuck.
Daneben besitzt Bosau ein Prunkwappen. Dieses trägt den Charakter des Einmaligen und Festlichen. Es ist daher immer handgearbeitet und findet Verwendung auf künstlerisch gestalteten Urkunden, dient als Wandschmuck und als Geräteschmuck.