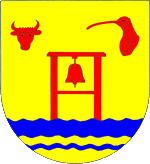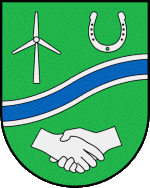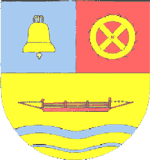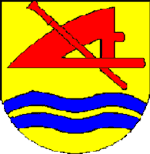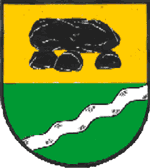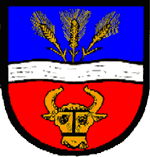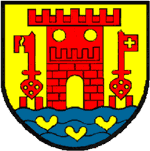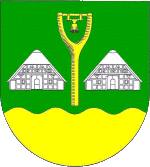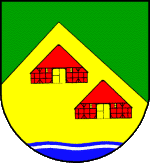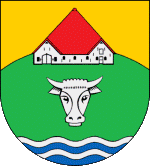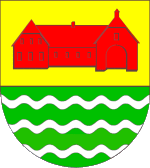Über blauem Wellenschildfuß in Gold ein roter Haubarg, begleitet oben rechts von einem roten Pflug und oben links von einer leicht schräg gestellten roten Heidesense.
Der Inhalt des Wappens der Gemeinde Arlewatt bezieht sich auf die drei Siedlungskerne Arlewatthof, Arlewattheide und Arlewattfeld. Prägend für die Landschaft und von weithin sichtbar ist der Hauberg "Arlewatthof", dargestellt mit seiner Silhouette. Ebenso steht die Heidesense für "Arlewattheide" und der Pflug für "Arlewattfeld" - beides landwirtschaftliche Geräte zur Urbarmachung der Siedlungskerne genutzt. Die nördliche Grenze der Gemeinde wird durch die Arlau - sybolisiert durch den Wellenschildfuss - bestimmt, von der man auch den Namen Arlewatt ableiten kann. Blau, Rot und Gold sind die Farben Frieslands und spiegeln die Zugehörigkeit der Gemeinde zu diesem Landesteils Schleswig-Holsteins wieder.
Über blauem Wellenschildfuß, darin unter einem silbernen Wellenfaden zwei gekreuzte Dornenzweige, eine goldene Spitze, darin eine grüne Kopfweide, darüber im grünen Schildhaupt rechts und links je zwei goldene Sumpfdotterblumen.
Die Gemeinde Drage liegt am Westende des Naturraums Stapelholmer Geest, am Rande der Eiderstedter- und Untereidermarsch. Der Ortsname Drage lässt sich von dän. draw= „schmale Landzunge" oder mda.jüt. drav= "Sumpf, Moor, sumpfiges Wiesengelände" ableiten (W.LAUR,1992). Die wechselvolle Geschichte von Drage steht in engem Zusammenhang mit den verheerenden Sturmfluten des 14. und 18. Jahrhunderts, die zum Untergang des Ortes Dornebüll und zur Neugründung des Dorfes Drage auf dem schützenden Geestrücken führte. Der grüne Hintergrund weist auf die einstige Bedeutung der Landwirtschaft hin sowie auf die grundwassernahen Grünlandflächen der Eider - Treeneniederung, das Gelb (Gold) auf den Stapelholmer Geestrücken. Sumpfdotterblumen gehören zu den markantesten Blütenpflanzen der feuchten Wiesen und Weiden. Sie erinnern an eine einstmals intakte bäuerliche Kulturlandschaft und stellen den Bezug zum Ortsnamen her, der Drage von "Sumpf, Moor oder sumpfiges Wiesengelände" herleitet. Der goldene nach oben gerichtete Keil symbolisiert die westliche "Landzunge" des Stapelholmer Geestrückens, auf der die Bewohner von Dornebüll das Dorf Drage gegründet haben. Die Kopfweide gilt als Charakterbaum von Drage der das Ortsbild prägt. Sie verweist zugleich auf die einstige Bedeutung der hier ansässigen Korbflechterei. Der blau-weiße Wellenschildfuß bezieht sich auf die Eider, den südlichen Grenzfluss der Gemeinde sowie auf die Treene in deren Niederungen das vergangene Dornebüll unterging. Die gekreuzten Dornenzweige im Schildfuß erinnern an den Untergang des Ortes Dornebüll.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Durch einen breiten mit abgeschrägten Scharten ausgeschnittenen silbernen Balken, darin zwei gekreuzte grüne Spaten, von Blau, darin eine silberne Möwe, und Grün, darin eine goldene Sumpfdotterblüte, über einen silbernem Wellenschildfuß mit blauen Wellenbalken im Verhältnis 1:3:2 geteilt.
Das Wappenbild beschreibt mit historischen und naturräumlichen Motiven die Besonderheiten der Gemeinde Elisabeth-Sophien-Koog auf Nordstrand. Die Möwe gilt als Charaktervogel der Meeresküsten. Die fliegende Möwe im Schildhaupt soll als Wappenvogel von Elisabeth-Sophien-Koog zugleich die Bestrebungen der Gemeinde um Unabhängigkeit und Freiheit symbolisieren. Die gekreuzten Spaten erinnern an die Wehrhaftigkeit gegenüber den Sturmfluten und Deichbrüchen der vergangenen Jahrhunderte und zugleich an die Bemühungen um die Trockenlegung der schweren Marschböden für die landwirtschaftliche Nutzung. Die goldene Blüte einer Sumpfdotterblume stellt den Bezug zu der einstmals vielfältig strukturierten bäuerlichen Kulturlandschaft her. Diese heute selten gewordene Wildpflanze wuchs vornehmlich in den feuchten Bereichen der von Weidevieh begrasten nährstoffreichen Flächen und bildete hier im Wechsel mit Hahnenfuß und Löwenzahn im Frühsommer eindrucksvolle gelbe Blütenteppiche. Der trapezförmige Einschnitt des blauen Schildhauptes symbolisiert einen Deichbruch, ein Ereignis, welches diese Gemeinde über Jahrhunderte schicksalhaft prägte. Die trapezförmige Überhöhung der grünen Fläche über dem blau-silbernen Wellenschildfuß bezieht sich auf den Deichbau der im Jahre 1739 abgeschlossen wurde und der zu wesentlichen Veränderungen des Lebensalltags der Bevölkerung führte. Die Farben und die Gliederung des Schildhintergrundes beschreiben die landschaftsprägenden Eindrücke, die man in Elisabeth-Sophien-Koog gewinnt: Das Grün die Wiesen, Weiden und die Deiche, das Blau beschreibt das Meer und den Himmel und der weiß-blaue Wellenschildfuß die Nordsee.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. In Gold über einem schmalen blauen Wellenfaden ein breiter blauer Wellenbalken, daraus hervorwachsend ein roter Glockenstuhl mit roter Glocke, begleitet oben rechts von einem roten Ochsenkopf und oben links von einem roten Großen Brachvogelkopf.
Das Dorf Fresendelf blickt auf eine 5000jährige Geschichte zurück. Es liegt im südöstlichen Zipfel des Kreises Nordfriesland am Übergang der hohen Geest in die Ebene des breiten Urstromtales der Treene, die durch einen Wellenbalken symbolisiert wird. Menschen siedelten immer dort, wo Trinkwasser zur Verfügung stand. Dieses Bedürfnis sicherte die "Beek", die als Wellenfaden dargestellt ist. Seit der Jungsteinzeit (3000 v. Chr.) lässt sich eine produzierende Landwirtschaft (Tierhaltung) nachweisen, die durch den Ochsenkopf repräsentiert wird. Der Große Brachvogel ist der Hinweis auf die ausgeprägte Wiesenwirtschaft. Alte Urkunden und das Zinsbuch des Bischofs von Schleswig (Liber censualis episcopi; 1463) erwähnen den Ort Vresendelue ("Friesengraben"), dessen Name durch mündliche Weitergabe zu Fresendelf wurde. Ebenda sind seit dieser Zeit die bedeutenden Einkünfte aus der Fährverbindung zwischen der friesischen Geest und dem Stapelholm aufgelistet. Der Glockenstuhl mit der Fährglocke ist das Symbol für diese wichtige Verkehrsverbindung. Die günstige geografische Lage ließ Fresendelf zu einem bedeutenden, bäuerlich geprägten Dorf wachsen bis landwirtschaftliche Reformen große Veränderungen brachten.
Das Wappen wurde am 8.9.2021 genehmigt. Entwurfsverfasser war Bertram Frenz.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Von Rot und Blau durch einen breiten goldenen Balken, belegt mit drei roten goldgeflammten Heiderosen, schräglinks geteilt. Oben ein silberner Pferdekopf, unten ein silberner Hut.
Hattstedt wurde 1231 erstmals erwähnt und bezieht sich wohl auf einen Mann namens Hatto. Die Marienkirche im Ort wurde um 1240 erstmals erwähnt. Während der zweiten Marcellsusflut von 1362 stand auch das flache Land vor dem Geestrücken unter Wasser, obwohl es relativ weit landeinwärts gelegen ist. 1460 wurde die Hattstedtermarsch, die bis 1803 Hattstedter Alter Koog hieß, eingedeicht. 1864 wurde ein Armenhaus errichtet, dessen Gebäude noch erhalten ist und sich heute in Privatbesitz befindet und liebvoll restauriert ist.
br>Durch den Pferdekopf wird im Wappen angezeigt, das nach einer Sage, ein Mann namens "Hatte" die Feldmark dieses Kirchspieles erwerben sollte, nachdem es ihm gelang, mit einem Pferd an einem Tage diese Fläche umzupflügen. Die Novelle "Der Schimmelreiter" von Theodor Storm spielte im Raum Hattstedt, welche die Bodenständigkeit und Gegebenheiten von Land und Leute dieser Gegend widerspiegelt und über die Grenzen hinaus bekannt gemacht hat. Theodor Storm war sehr häufig in Hattstedt zu Gast, der Sohn des Hattstedter Pastors besuchte mit ihm gemeinsam die Gelehrtenschule in Husum. Die besondere Verbundenheit Storms mit Hattstedt fand in verschiedenen Werken Storms eine große Bedeutung. Im Besonderen so der Hattstedter Kirchturm: "Der graue spitze Kirchturm", "bis an das Schindeldach... aus Granitquadern aufgebaut", wird erwähnt in "Aquis submersus", im "Schimmelreiter" und im Fragment "Die Armesünderglocke".
Theodor Storm heiratete in Hattstedt im Juni 1866 seine zweite Frau Dorothea, aber nicht in der Kirche, sondern im Kompastorat "Unter den Linden" im Lindenweg 1. Die dortige Örtlichkeit findet sich auch in "Aqius submersus"; das Epitaph zu dieser Novelle aber hängt in der Kirche in Dreisdorf.
Auf dem Friedhof in Hattstedt stehen alte Grabsteine, einer gehört zum Deichgrafen Iwersen-Schmidt, der ein sehr guter Freund Storms war und dem er in der Novelle "Schimmelreiter" in der Person des alten Deichgraf ein Denkmal setzte. Dieses begründet den weißen Pferdekopf des Schimmels im Wappenvorschlag. Die Ausdeutung der Hügelform des Geestrückens der Topographie Hattstedts lässt auf eine Hutform schließen. Der Hut im Wappenvorschlag wurde aus dem Habitus eines Mannes der Hattstedter Familie nachempfunden, (siehe: "Trachten im 16. Jahrhundert", Garding, ohne Jahr). Eine ehemals vorherrschende Wildpflanze der Gegend war das Heidekraut "Erika" (Calluna Vulgaris). Die stilisierte Blütenform in der Hand der weiblichen Person wurde im übertragenem Sinne ins Goldband des Wappens überführt.
In Grün, von einem blauen Wellenbalken zwischen je einen silbernem Wellenfaden geteilt, oben ein silbernes Windrad und ein silbernes Hufeisen mit nach oben gekehrten Stollen, unten eine schwebende silberne Treuhand (Händeschlag).
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Horstedt hat sich dazu entschlossen, ein Wappen für unser Dorf aufzulegen. Bei der Planung für unser Wappen stand im Vordergrund, eine Brücke zwischen unseren Ursprüngen und den Dingen zu schlagen, die unsere Gemeinde heute und in Zukunft prägen. Das Dorf Horstedt ist eine ländliche Gemeinde im Kreis Nordfriesland mit etwa 750 Einwohnern. Landschaftlich ist die Gemeinde von mehreren Faktoren geprägt. Zum einen ist hier die landwirtschaftliche Nutzung der Gemeindeflächen zu nennen. Neben der Grünlandbewirtschaftung hat auch der Ackerbau eine starke Bedeutung erlangt. Zum Dorfgebiet zählt der am Ortsrand gelegene Wald "Hochsodel". Dieser spielt für die Naherholung eine wichtige Rolle. Viele Horstedter Bürger nutzen ihn als Spazierweg und für einen Ausritt mit ihren Pferden. Wie wichtig uns die Erhaltung dieses Naherholungsraums ist, zeigt die Absicht, weitere Flächen für eine Erstaufforstung zu gewinnen. Daneben soll die Teilnahme am Knickschutzprogramm unter anderem die Qualität der Wanderwege weiter steigern. Die Grundfarbe "Grün" in unserem Wappen soll die Bedeutung der Landwirtschaft und der Naherholung in Horstedt symbolisieren. In den zurückliegenden Jahren ist das Dorf immer stärker durch die Entwicklung der erneuerbaren Energien geprägt. Neben zahlreichen kleineren Photovoltaikanlagen im Dorf zählen hierzu diverse Windkraftanlagen, eine Freiflächensolaranlage sowie drei Biogasanlagen im Außenbereich des Ortes. Die Pioniere der erneuerbaren Energien sind in der Landwirtschaft zu suchen, egal, ob es um die Windkraft -und Solaranlagen oder um die in den letzten Jahren gebauten Biogasanlagen geht. Die in unserem Wappen abgebildete Windkraftanlage steht sinnbildlich für die gesamten erneuerbaren Energien, die das Dorfbild in der jüngeren Vergangenheit geprägt haben und bis in die Zukunft hineinwirken. Von dieser Entwicklung haben die Horstedter Bürger und die Gemeinde Horstedt auch in finanzieller Hinsicht profitiert. Ein wichtiger und aus dem Dorfleben nicht wegzudenkender Faktor ist der Reitsport. Viele pferdebegeisterte nutzen die ortsansässige Reithalle für ihr Hobby. Gerade Kinder und Jugendliche begeistern sich für diese Sportart. Das alljährliche Dorfringreiten ist seit vielen Jahren ein Höhepunkt der Vereinsfeste. Der Begriff Pferd (englisch: "horse" = Pferd) findet sich in unserem Dorfnamen deutlich wieder (volksetymologisch, Anm. LASH). Sowohl der Pferdesport wie auch das Ringreiten haben ihren Ursprung in der Landwirtschaft, wurden doch in den Anfangsjahren die Arbeitspferde der Landwirte hierfür genutzt. Das zweite Symbol in unserem Wappen, das Hufeisen, soll nun verdeutlichen, welch große Bedeutung der Pferdesport in Horstedt einnimmt. Als Mittelpunkt der Gemeinde kann das im Jahr 2004 errichtete Dorfgemeinschaftshaus "Uns Huus" genannt werden. Hier ist das Feuerwehrgerätehaus integriert worden und es stehen mehrere Veranstaltungsräume zur Verfügung. "Uns Huus" ist nicht nur geografisch zentral gelegen, sondern hat sich zu einem Zentrum für die Begegnung der Horstedter Bürger entwickelt. Ein kurzer Abriss zeigt, wie groß der Kreis derjenigen ist, die sich in "Uns Huus" wieder finden ; Spielkreis, Miniclub, zwei Pilatesgruppen, Jugendtreff, Tanzkreis, Gesangs - und Akkordeongruppe und der Voltigierverein. Der Ortskulturring nutzt genauso wie der Sozialverband "Uns Huus" als Stätte für Versammlungen und Veranstaltungen. Alljährlich wird ein Adventsbasar veranstaltet, der schon weit über Horstedt hinaus Bekanntheit erlangt hat. Für die Freiwillige Feuerwehr ist hier das Einsatzfahrzeug untergebracht. Daneben steht "Uns Huus" den Feuerwehrkameraden als Schulungsraum zur Verfügung. Mit Freude und Stolz können wir auf unsere Freiwillige Feuerwehr schauen, die engagiert ans Werk geht wenn Hilfe gebraucht wird und die bislang nicht von Nachwuchssorgen geplagt ist. Diese Aufzählung steht sinnbildlich für das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Zusammenarbeit in unserem Dorf. Und diese Zusammenarbeit findet sich auch in der Nutzung der Erneuerbaren Energien wieder. So wurden drei Windkraftanlagen und die Freiflächensolaranlage als Bürgerwindpark bzw. Bürgersolarpark ins Leben gerufen, so dass sich zahlreiche Horstedter Bürger an diesen Anlagen beteiligen konnten. Dieses Zusammenwirken wird auch über die Ortsgrenzen hinaus gepflegt. Zusammen mit den Dörfern Ariewatt und Olderup bildet Horstedt die sogenannten "Osterdörfer". Gemeinsam werden folgende Einrichtungen in Kooperation betrieben: Die Grundschule in Horstedt, der Kindergarten in Olderup und das Dörfergemeinschaftszentrum in Ariewatt mit eigener Sporthalle und Sportplatz. Auch die Jugendfeuerwehren der drei Dörfer Ariewatt, Olderup und Horstedt sind gemeinschaftlich organisiert. Nur diese interkommunale Zusammenarbeit gewährleistet, dass alle Einrichtungen aktiv betrieben werden können. Eine Gemeinde alleine wäre hiermit finanziell und organisatorisch überfordert. Die Zusammenarbeit hat sich bewährt und wird partnerschaftlich durchgeführt. Alle drei Gemeinden legen großen Wert darauf, die Zusammenarbeit zum Wohle der Einwohner, insbesondere unserer Kinder und Jugendlichen, fortzuführen. In unserem Wappen sollen die beiden ineinandergreifenden Hände das gute und erfolgreiche Zusammenwirken der Bürger im Dorf und die Zusammenarbeit mit den beiden anderen Osterdörfern Ariewatt und Olderup repräsentieren. Historisch ist das Dorfbild durch den Verlauf des Baches - im Dorf nur bekannt als "de Beeck" - geprägt worden. "De Beeck" fließt inmitten des Dorfes, bis er sich schließlich in die Marsch begibt. Bis zum Jahr 1956, in dem eine Begradigung und Vertiefung des Bachlaufes vollendet wurde, kam es regelmäßig im Winter und Frühjahr zu ausgedehnten Überschwemmungen im Dorf. Der historische Verlauf des Baches wird durch den Wellenbalken verkörpert, die die beiden Hälften des Wappens teilt.
Halb gespalten und geteilt. Oben rechts in Blau eine goldene Glocke, oben links in Rot ein goldenes Mühlenrad, unten in Gold über einem schmalen und einem breiteren Wellenfaden ein roter Prahm.
Der Name der Gemeinde Hude im Kirchspiel Schwabstedt, Amt Treene, leitet sich von "hüthia" (altsächsisch) bzw. "hüde" (mittelniederdeutsch) her und bedeutet Stapelplatz, Anlegestelle, Fährstelle. Der Prahm im Wappen erinnert an die Bedeutung des Gemeindenames und steht gleichzeitig für die Huder Fähre, eine wichtige Nord-Süd-Verbindung und Anschluss an die Huderingfennen südlich der Trenne. Der breite Wellenfadenr symbolisiert die Treene, der schmale die Huder Beck. Die Glocke verweist auf den Glockenberg, die höchste Erhebung der Gemeinde und das Mühlrad erinnert an die herrschaftliche Wassermühle, die von 1463 bis 1704 an der Gemeindegrenze zu Schwabstedt nachweisbar ist.
Unter grünem Wellenschildhaupt, darin eine waagerechte gesprengte goldene Kette, in Silber zwei schmale blaue Wellenbalken über einem blauen Dreispitzzinnenschildfuß, darin ein schmaler silberner Wellenbalken.
Der Ortsname der Gemeinde Koldenbüttel leitet sich her von nd. Kooln'büttel = "Zur kalten, d.h. erloschenen, alten, verlassenen Siedlung" (Laur). Danach weist dieser Name auf eine verlassene und dann wieder bebaute Siedlung hin.
Das Gemeindewappen befasst sich mit der Namensgebung und zeigt im Schildfuß die Silhouette von drei Hütten, die an diesen vermutlich untergegangenen Ort erinnern sollen.
Zwei blauen Wellenbalken erinnern an die wechselvolle und vom Wasser so abhängige Geschichte dieses Dorfes in der Eiderniederung. Sie symbolisieren zugleich die Eider und die Treene. Der silberne Wellenbalken im Schildfuß symbolisiert die trocken gelegte Nordereider.
Die einstige Insel Eiderstedt wurde zu Beginn des 8. Jahrhunderts durch friesische Einwanderer besiedelt. Etwa um 1000 n. Chr. drangen sie in die siedlungsfeindlichen, schlecht entwässerten Niederungsgebiete der Eidermündung vor, um sie planmäßig in Kultur zu nehmen.
Im Zuge der Bautätigkeit der sich ansiedelnden Menschen wurde die Eidermündung im 12. Jahrhundert beidseitig eingedeicht. Koldenbüttel lag damals noch auf der Insel Eiderstedt, im Mündungsbereich der Treene in die Nordereider. Im Jahre 1362, als 10 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung von Koldenbüttel, durchstieß eine gewaltige Sturmflut die bescheidenen Deiche aus der Zeit der friesischen Kolonisation.
Mit den ersten erneuten Eindeichungen an der schleswig-holsteinischen Westküste entstanden in den Jahren 1380 und 1450 die Köge nordwestlich von Koldenbüttel. Die Sturmflut von 1436 zerstörte jedoch alle fast damals bestehenden Deiche. In den Jahren 1470 bis 1489 wurde die Nordereider abgesperrt und im Jahre 1575 erfolgte die Abdämmung und Umleitung der Treene, die zuvor noch bei Koldenbüttel in die Nordereider mündete.
Das Gemeindewappen nimmt sich dieser wechselvollen und schicksalhaften Geschichte von Koldenbüttel an und erinnert damit auch an einen durch schwere Sturmfluten untergegangenen Ort in der Untereider Marsch.
Die gesprengte Kette im Schildhaupt bezieht sich auf die im 12. Jahrhundert erbaute Koldenbütteler Kirche. Sie erinnert an den heiligen St. Leonhard, dem die Kirche geweiht wurde und der in vielen Darstellungen mit einer solchen Kette gezeigt wird.
In Gold über zwei blauen Wellenbalken ein mit der Spitze nach vorn weisendes, rotes Pflugeisen, durch das ein schrägliegender, aufrechter Pflugstock gesteckt ist.
Mildstedt war der Vorort der Süderharde, des südlichen Bezirks der historischen Südergoesharde. Das Siegel der Südergoesharde enthielt als Symbol ein Pflugeisen, das auch in das Wappen des 1970 aufgelösten Kreises Husum Aufnahme gefunden hat. Wegen seiner Bedeutung als Dinggerichtsort für den südlichen Teil der Südergoesharde erhielt Mildstedt nach einem Vorschlag des Husumer Heimatforschers Goslar Carstens aus den 1950er Jahren ein Wappen mit dem Symbol dieser Harde. Zur Unterscheidung wurde der vermutlich zur Säuberung der Pflugschar bestimmte Pflugstock hinzugefügt. Zusätzlich zu ihrem historischen Bezug kennzeichnet die Figur auch die Gegenwart, weil die Wirtschaftsstruktur in der ehemaligen Süderharde ländlich geblieben ist. Die beiden Wellenbalken im Schildfuß beziehen sich auf die Lage der Gemeinde zwischen dem kleinen Fluß Milde und der Mühlenau. Mildstedt wird 1304 erstmals als Kirchdorf erwähnt. Die Tingierung des Wappens bedient sich der friesischen Farben Blau, Gold und Rot.
Von Gold und Grün geteilt. Oben aus drei Tragsteinen und einem Deckstein bestehendes schwarzes Steingrab, unten ein schrägliegender silberner Wellenbalken.
Das Wappen von Oldersbek verbindet ein historisches mit einem topographischen Zeichen. Das Steingrab steht für die Vielzahl prähistorischer Begräbnisstätten auf dem Gemeindegebiet und in dessen näherer Umgebung und die bei deren Ausgrabung gemachten reichen Funde. Zeitlich lassen sich diese vorzeitlichen Denkmäler in die jüngere Steinzeit und in die Bronzezeit einordnen. Im Jahre 1352 wird das Dorf erstmals erwähnt. Der Name des Ortes bezeichnet diesen als "den Bach des Alder", wobei offen bleibt, um wen es sich hierbei handelt. Der zweite Namensbestandteil des Ortes, die "Bek", ist "redend" in der unteren Wappenhälfte durch den Wellenbalken wiedergegeben. Zugleich wird durch diese Figur die Lage des Dorfes an dem Wasserlauf, der dem Ort den Namen gegeben hat, dargestellt. Die Wiesen an dessen Ufer finden sich in der grünen Schildfarbe wieder, während in der gelben Tingierung die Rapsfelder angedeutet werden.
Über blauem, mit einem silbernen Wellenbalken, abschließenden Wellenschildfuß in Gold eine rote Spitze, darin ein goldenes romanisches Taufbecken.
Die Gemeinde Ostenfeld liegt im Naturraum "Ostenfelder Geest" am Rande der "Eider-Treene-Sorge-Niederung". Das Gelb im Schildhaupt und das Blau im Schildfuß beziehen sich auf die naturräumliche Lage. Der weiße Wellenbalken symbolisiert die Treene, den östlichen Grenzfluß der Gemeinde. Ostenfeld ist das höchstgelegene Dorf in Nordfriesland. Die höchste Erhebung liegt 54 m über NN in der Gemarkung Janhau. Hier befindet sich ein in Schleswig-Holstein sehr bedeutender trigonometrischer Punkt. Der sparrenförmige Keil im Schildhaupt soll darauf hinweisen. Das aus dem 12. Jahrhundert stammende Taufbecken steht als Symbol für die St. Petri-Kirche im Mittelpunkt des Gemeindewappens. Es verkörpert durch sein Alter die Geschichte Ostenfelds. Die Farben Gelb, Rot und Blau beziehen sich als die friesischen Farben auf die Zugehörigkeit zum Kreis Nordfriesland, die Farben Blau, Weiß, Rot auf die Landesfarben.
In grün ein abgeflachter schmaler silberner Sparren, darüber das silberne Gehörn eines Widders, darunter drei goldene Blüten der Sumpfdotterblume in der Stellung 2:1.
Der Ortsname der Gemeinde Ramstedt leitet sich her von schwed.-dial. Ram = "feuchte Wiese, Sumpf" oder von nd. Ramm "Widder" und stede = "Stätte, Wohnstädte". Danach bedeutet der Ortsname soviel wie "feuchte Stätte" oder "Widderstätte". Das Gemeindewappen befasst sich als redendes Wappen mit der Namensbedeutung und zeigt im Schildhaupt das Gehörn eines Widders oder eines gehörnten Schafbocks. Die gelben Blüten der Sumpfdotterblume symbolisieren die feuchten Wiesen und sind zugleich Symbol für eine durch Landwirtschaft genutzte Kulturlandschaft. Der mittlere Sparren ist ein Symbol für die Ramstedter Schanze und erinnert an die Geschichte des Ortes: Die Schanze, dessen Grabenanlagen durch einen kleinen Kanal mit der Treene in Verbindung standen, hatte als Wehranlage im 17. Jahrhundert große Bedeutung. Ihr fiel bei der Absperrung nach Eiderstedt eine besondere strategische Bedeutung zwischen der Husumer Schanze und der Treene zu. Der Straßenname "Dänische Schanze" erinnert noch heute an diese Zeit kriegerischer Auseinandersetzungen. Der grüne Hintergrund symbolisiert einerseits die feuchten Wiesen zwischen der Ortschaft und der Treene, aber auch die naturräumliche Lage der Gemeinde am Rande der Eiderstedter und Untereider Marsch.
Von blau und rot durch einen silbernen Wellenbalken geteilt; oben drei fächerförmig gestellte, aus dem Wellenbalken wachsende, begrannte goldene Getreideähren, unten frontal gestellter, schwarz gezäumter Ochsenkopf.
Die Schildteilung im Wappen von Rantrum bezieht sich auf die Lage der Gemeinde zwischen Geest und Marsch. Der Wellenbalken repräsentiert den Sielzug, welcher, wie in der Wirklichkeit so auch abbildend im Wappen, Geest und Marsch voneinander trennt. Die Getreideähren vergegenwärtigen die Bedeutung des Getreideanbaus in der Gemeinde. Durch den Ochsenkopf wird nicht nur auf die Viehzucht, sondern auch auf den Viehhandel am Ort angespielt. Die saftigen Marschwiesen waren schon immer begehrtes Ziel für die Gräsung des Mastviehs. Von Norden wurden die Ochsen auf die grasreichen Weiden der Südermarsch getrieben, dort gemästet und dann verkauft. Seit dem späten Mittelalter soll in Rantrum ein Viehmarkt vorhanden gewesen sein, welcher dem Ort zu Beginn der Neuzeit eine gewisse wirtschaftliche Blüte verschaffte. Die Farben des Schildes Rot und Blau ergeben zusammen mit dem silbernen Wellenbalken die Farben Schleswig-Holsteins. Das Gold des Ochsenkopfes versinnbildlicht den Ertrag der Viehhaltung und des Viehhandels und bildet zusammen mit Rot und Blau die Friesenfarben.
Über blauen Wellen, die mit drei goldenen Seeblättern in der Stellung 2:1 belegt sind, in Gold zwischen zwei auf roten Dückdalben befindlichen, abgewendeten roten Schlüsseln, in deren Bart ein Kreuz bzw. eine brennende Kerze eingeschnitten ist, ein roter Turm mit offenem Tor, Zinnenplattform.
Die Gemeinde führt ihr historisches Siegel im Wappen, dessen Inhalt auf die mittelalterliche Geschichte des Ortes bezogen ist. 1268 verlegte der Schleswiger Bischof seinen Sitz nach Schwabstedt, einem Dorf an der Treene. Das bisherige Bischofsschloß Gottorf kam durch Tausch an den Schleswiger Herzog. In Schwabstedt wurde an einer Flußschleife ein neues Bischofsschloß errichtet. Wie viele Bischofssitze wurde Schwabstedt bald darauf zur Stadt erhoben. Das heute noch als Typar erhaltene Stadtsiegel zeigt jene neue Bischofsburg an der Treene. Die zu beiden Seiten der Burg befindlichen Schlüssel sind die Attribute des heiligen Petrus, des Schutzpatrons des Schleswiger Bistums. Auf die geistlichen Wurzeln der Stadtgründung bezieht sich wohl auch die besondere Gestaltung der Schlüsselbärte (Kerze, Kreuz). Bei den "Dückdalben" dürfte es sich eher um Teile einer Zinnenmauer als Zeichen der städtischen Rechtsstellung handeln. Anfang des 15. Jh. wurde die Stadt wieder zum Flecken. Die Seerosen im heutigen Gemeindewappen wurden dem überkommenen Siegelbild bei der Genehmigung 1963 hinzugefügt, um den Unterschied zum älteren Amtswappen mit demselben Bildinhalt deutlich zu machen. Da das Siegel nach Verlust des Stadtrechts vom Kirchspiel Schwabstedt weitergeführt wurde, benutzte das gleichnamige Amt, das die Funktion des Kirchspiels als Verwaltungsinstitution teilweise fortführte, seit 1950 ein fast gleiches Wappen wie später der Ort. Seit 1970 ist das Amt Schwabstedt Bestandteil des neuen Amtes Treene.
In Grün über goldenem Wellenschildfuß eine goldene Bauernglocke, rechts und links je ein silbernes Fachhallenhaus.
Die Gemeinde Seeth liegt am nordwestlichen Ausläufer des Stapelholmer Geestrückens, an den die weiten Grünlandflächen der Eider-Treeneniederungen anschließen. Der Ortsname Seeth lässt sich mit mnd. Set = "Sitz" übersetzen und bezeichnet eine Niederlassung oder Ansiedlung. Der Giebel des Bauernhauses, eines Fachhallenhauses, weist auf die Vielzahl eindrucksvoller historischer Reetdachhäuser hin. Die Giebel stehen zudem im Zusammenhang mit der Ortsnamen Deutung, "Sitz -Niederlassung - Ansiedlung." Die Bauernglocke ist typisch für die Landschaft Stapelholm. Durch ihr Läuten wurden die Dorfbewohner früher vor Angriffen und bei Gefahr gewarnt oder zusammengerufen. Die Wellenlinie symbolisiert den nördlichen Grenzfluss der Gemeinde, die Treene. Die Farbe Grün weist auf die grundwassernahen Grünlandflächen der Eider-Treeneniederungen hin, das Gelb (Gold) auf die trockenen Sanderflächen des Stapelholmer Geestrückens.
Die Wappengenehmigung und Annahme erfolgte am 23. März 2009
Über blau-goldenem Wellenschildfuß in Grün eine nach rechts versetzte, goldene Spitze, darin zwei schrägrechte rote Fachwerkhäuser.
Winnert mit seinen 756 Einwohnern (2005) liegt im östlichen Teil des Amtes Treene zwischen den Räumen Schwabstedt und Ostenfeld und ist ein landwirtschaftlich geprägtes Flächendorf mit zur Zeit 22 landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieben. Zur Gemeinde gehören 1885 ha Ländereien. Etwa 7 % der Fläche sind Naturschutzgebiet. Das "Wilde Moor" ist überregional bekannt. Zum Ursprung und die Bedeutung des Namens Winnert gibt es verschiedene Deutungen. Seit Jahrzehnten ist jedoch die Rückführung des Namens auf ein "Rodungsdorf" anerkannt (z.B. Voß, Clausen, Laur und Fanten). In Verbindung mit diesen Rodungen werden zwei ähnliche Erklärungen vertreten. Clausen meint: Winnert = Winderde (1423) = Winne-rott = "Rodung des Winde, Win". Fanten stellt eine Verbindung zu dem alt-dänischen Vornamen Windi her, so dass Winnert dann "Windis Rodung" bedeuten würde. Laur nennt weitere frühe Schreibweisen des Dorfnamens: de Winderde (1423), tho Winnerdt (um 1475), Windern (1542), tho Wradernn 1550, Windering (1570). Das Jahr 1423 steht für die erste urkundliche Erwähnung. Im Wappen ragt das urbar gemachte Land (gold) keilförmig in den nicht gerodeten Wald (grün). Die Ursprung der Ortsgründung wird durch die zwei Fachwerkhäuser am Waldrand symbolisiert. Sinnbildlich stehen das Blau im Schildfuß für die Treene und das schmale blaue Band für den südlichen Grenzgraben im Moor.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Über blauem, mit einem schmalen silbernen Wellenbalken begrenzten Schildfuß in Grün ein durchbrochener silberner Wellenbalken, oberhalb davon drei goldene Laubblätter in der Stellung 1,5:2, unterhalb ein goldener Kuhkopf in Frontansicht.
Der Ortsname der Gemeinde Wittbek leitet sich her von adän. "with", neudän. "ved" = Wald und dän. "baek", nd. "Bek" = Bach und läßt sich somit als "Waldbach" oder "Bach, der durch einen" oder "an einem Wald vorbeifließt (Laur 1992). Die drei Laubblätter im Schildhaupt über dem Wellenbalken sollen daher den Ortsnamen symbolisieren. Die Gemeinde Wittbek liegt im Naturraum "Osterfelder Geest" am Rande der Eider-Treene-Sorge-Niederung. Die Grundfarben Gelb (Gold) und Grün sollen darauf hinweisen. Die höchste Erhebung der Gemeinde bildet mit 38 m über NN der "Ruhberg", der zugleich die zweithöchste Erhebung in diesem Landschaftsraum der sog. "Hohen Geest" ist. Dieses soll durch das erhöhte mittlere Laubblatt angedeutet werden. Durch das Gemeindegebiet verläuft eine Wasserscheide, wobei die Husumer Mühlenau in die Nordsee und die Krummbek in denöstlich verlaufenden Grenzfluß, die Treene fließt. Der unterbrochene Wellenbalken bezieht sich darauf. Der silberne Wellenbalken im Schildfuß symbolisiert die Treene. Der Kuhkopf weist auf die Bedeutung der Landwirtschaft für die Gemeinde hin, insbesondere die Milchwirtschaft hatte für Wittbek eine besondere Bedeutung. Die Farbe Grün steht nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch auf die fruchtbaren Grünlandflächen in der Treeneniederung. Das Blau im Schildfuß weist auf das Grundwasservorkommen in diesem Landschaftsraum hin. IN Wittbek werden große Mengen fossilen Wassers zur Trinkwasserversorgung weiter Landesteile gefördert.
In Gold über schmalem blau-silbernen Wellenschildfuß ein flacher grüner Berg, davor ein silberner Haubarg mit rotem Dach, darunter ein silberner Ochsenkopf.
Die Gemeinde Witzwort liegt im Naturraum "Eiderstedter und Untereider Marsch". Das Grün soll auf die Lage in der Marschenlandschaft und auf die hier vorrangig betriebene landwirtschaftliche Weidenutzung hinweisen. Das Gold bezieht sich auf die in diese Landschaft eingeschlossenen Getreide- und Rapsfelder. Der Ortsname der Gemeinde leitet sich her von Wideswortt = "Wohn- und Siedlungsplatz, besonders auf einer künstlichen Erhöhung in der Marsch" (Laur, 1992). Die bogenförmige Schildteilung soll dieses symbolisieren. Der Haubarg war früher als landschaftstypische Bauform in der Gemeinde sehr verbreitet. Heute bestehen nur noch einige dieser eindrucksvollen Häuser in der Gemeinde, von denen der "Rote Haubarg" weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Der Haubarg im Wappen soll an diese "bis auf wenige Ausnahmen auf Eiderstedt beschränkte Bauform" ( Braun/Strehl, 1985) erinnern. Der Ochsenkopf ist ein Zitat aus dem Wappen des früheren Kreises Eiderstedt. Dieses wiederum leitet sich "mittelbar von dem frühneuzeitlichen Siegel der ehemaligen Landschaft Eiderstedt"(Reißmann, 1997) her. Der Ochsenkopf im Wappen soll auf die Lage der Gemeinde in dieser Landschaft hinweisen. Die beiden silbernen Wellenfäden im Schildfuß symbolisieren die Nähe der Gemeinde zum Wasser, zur nahegelegenen Nordsee, zu der im Osten ehemals verlaufenden und später trockengelegten Nordereider, zur Eider als südlicher Grenzfluß, aber auch die g rund wassernahen Wiesen- und Weideflächen mit ihren Gräben und Sielzügen.
Über grünem Schildfuß, darin drei silberne Wellen, in Gold ein rotes Doppelgiebelhaus.
Am 6. September 2000 erfolgte die offizielle Feststellung der obigen Wappenbeschreibung gemäß Hoheitszeichenerlass des Innenministeriums.
Das Wappen ist geteilt in die Landschaftsteile Geest und Marsch: Oben in Gold die Geest, unten grün die Marsch.
Oben im goldenen Feld befindet sich der sogenannte „Ibenshof“, ein für die Gegend typischer Bondestaven, um 1600 Wohnsitz des Bauern, Hövetmanns, Chronisten und Kartografen Iven Knutzen, 1803-1811 der Sitz des Deichgrafen Harro Wilhelm Martensen, Vater des Freiheitskämpfers, Dichters und Malers Harro Harring.
Unten im grünen Feld symbolisieren drei silberne Wellen die Marsch südlich von Wobbenbüll, die bei hohem Wasserstand vom Meer überflutet und daher auch „Salze Gräsung“ genannt wird.
Erwähnenswert ist, dass Wobbenbüll/Schobüll die einzige Strecke an der Schleswig-Holsteinischen Westküste (Festland) ist, die nicht mit einem Deich geschützt ist. Das Wattenmeer geht unmittelbar in einen flach ansteigenden Geestrücken über.