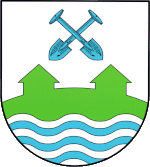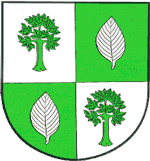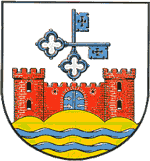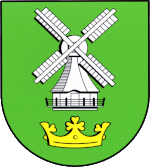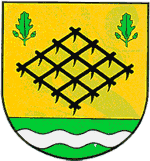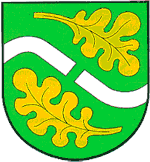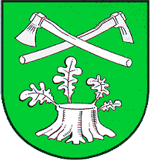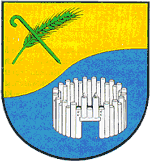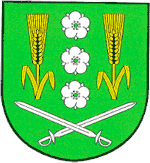Über silbernem, mit drei blauen Wellenfäden belegtem Wellenschildfuß in Silber die grüne Silhouette eines mit zwei giebelständigen Häusern bestandenen Hügels; darüber zwei gekreuzte blaue Spaten.
Die im Wappen dargestellte Silhouette bezieht sich auf das typische Landschaftsbild Averlaks. Die drei blauen Wellenfäden im Schildfuß sind ein Bezug auf die Nordsee, auf den Nord-Ostsee-Kanal und den Kudensee. Die gekreuzten blauen Spaten weisen auf ein in dieser Landschaft früher sehr gebräuchliches Arbeitsgerät hin, mit dem in der Gemeinde Averlak in der Vergangenheit Deiche gebaut, Gräben ausgehoben, Torf gestochen und Landwirtschaft betrieben wurde.
In Silber ein blauer Wellenbalken, begleitet oben von einem grünen Birkenzweig, unten von einem achtspeichigen roten Wasserrad.
Der Ortsname Brickeln wird abgeleitet von "Birke" (Brickloh = Gehölz, Hain, wo man Holz für Scheiben, nd. Bricken, schlägt). Der Überlieferung nach soll in Brickeln einstmals die Herstellung von Scheiben aus Birkenholz betrieben worden sein.
Der Wellenbalken symbolisiert den Helmschen Bach, der die Gemeinde durchfließt.
Das Wasserrad bezieht sich auf die historische Brickelner Wassermühle, die ehemals eine große wirtschaftliche Bedeutung für die Gemeinde hatte.
Geviert; 1 und 4 in Silber ein bewurzelter grüner Laubbaum, 2 und 3 in Grün ein silbernes Rotbuchenblatt.
Das Buchenblatt und die Buche als Baum symbolisieren die Ortsbezeichnung Buchholz.
Im Landschaftsraum um die Gemeinde Buchholz herrschten vor seiner Besiedlung großflächige Laubwälder vor. Hier war es insbesondere die Buche (Rotbuche), auf die sich die Namensgebung des Ortes bezieht.
Das Wappen der Gemeinde Burg i. Dithm. zeigt in silbernem (weißem) Feld über goldenem (gelbem), von 2 blauen Querflüssen durchzogenen Dreiberg eine rote zweitürmige Burg mit geschlossenem blauen Tor, darüber zwei blaue, ins Kreuz gestellte Schlüssel.
Die Hauptfigur des Gemeindewappens, die Burg, versteht sich als klassisches "redendes" Bild für den Ortsnamen. Dieser hält die Erinnerung an die Bökelnburg wach, heute eine der besterhaltenen Burgwälle im Landesteil Holstein. Zusammen mit anderen sächsischen Volksburgen entstand die Bökelnburg am Anfang des 9. Jh. in einer Zeit der Bedrohung der Sachsen durch Franken, Slawen und Dänen. Der Ansturm der slawischen Abodriten konnte 1033 hier und in Itzehoe zum Stillstand gebracht werden. Bei der Auseinandersetzung der Dithmarscher mit den Stader Grafen wurde der letzte Graf Rudolf II. 1144 angeblich auf der Bökelnburg erschlagen und diese anschließend zerstört. Vielleicht geht die Stiftung der zwischen 1148 und 1168 gebauten Burger Kirche auf den Bruder des Grafen, Erzbischof Hartwig von Bremen, zurück. Sie war dem heiligen Petrus geweiht, worauf die Schlüssel im Wappen hinweisen. Vorlage war ein Kirchspielsiegel von 1409. Der goldene Dreiberg deutet das von Hügeln belebte Gemeindegebiet am Geestrand an. Die Wellenbalken am Fuße des Dreibergs sollen die Burger bzw. die Wolber-Au und den Nord-Ostsee-Kanal wiedergeben.
Von Grün und Gold im Wellenschnitt schräglinks geteilt. Oben ein auffliegender (heraldischer) Habicht, unten ein Kastanienblatt in verwechselten Farben.
Die Farben im Wappen repräsentieren das reifende Korn der Geest und die saftigen Wiesen der Marsch.
In Grün über einer goldenen heraldischen Krone eine silberne holländische Windmühle mit fast ebenerdiger Galerie.
Die Krone im Schildfuß des Gemeindewappens ist ein Bildzitat aus dem mittelalterlichen Kirchspielsiegel von Eddelak. Dieses zeigt die Gottesmutter Maria mit der Krone auf dem Haupt und dem Jesuskind neben sich. Die stellvertretende Darstellung der Krone verweist auf Marias Eigenschaft als Himmelskönigin. Für den Ortsteil Behmhusen steht die über der Krone angeordnete Kornwindmühle, die durch ihre Bedeutung für den Getreideanbau zugleich den bis heute anhaltenden ländlichen Charakter der Gemeinde Eddelak insgesamt andeuten soll. Diese Figur verbindet den Ort außerdem heraldisch mit dem gleichnamigen Amt, das ebenfalls eine Windmühle im Wappen führt.
Das Wappen wurde am 26.10.1993 genehmigt. Entwurfsverfasser war Uwe Nagel, Bergenhusen.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen. Über grünem Schildfuß, darin ein silberner Wellenbalken, in Gold eine übereck gestellte schwarze Egge. In den Oberecken je ein aus einem Blatt zwischen zwei Eicheln bestehender grüner Eichenzweig.
Im Gemeindewappen von Eggstedt soll vorzugsweise der Ortsname bildlich zum Ausdruck gebracht werden. Aus volksetymologischer Sicht bleibt offen, ob der erste Namensbestandteil auf die "Egge" als landwirtschaftliches Arbeitsgerät oder auf die niederdeutsche Form der Eiche, also "Eke", zurückzuführen ist. Deshalb sind beide Bildsymbole, Egge und Eiche, in das Wappen aufgenommen worden. Wissenschaftlich ist freilich unbestritten, daß der Namensbestandteil "Egg" soviel wie "Ecke" oder "Kante" bedeutet, also auf eine topographische Besonderheit der ursprünglichen Siedlung schließen läßt. Zugleich betonen die Egge die Bedeutung der Landwirtschaft für den Ort und der Eichenzweig den umfangreichen Eichenbestand im Gemeindegebiet. Der grüne Schildfuß repräsentiert die Viehweiden des Ortes und die Farbe Gold den Ertrag des Ackerbaus.
In Grün zwischen zwei liegenden goldenen Eichenblättern, einem linksgewendeten oben und einem rechtsgewendeten unten, ein liegender, vor konkav, hinten konvex gebogener und in der Mitte ausgebrochener silberner Wellenbalken.
Der Inhalt des reizvoll gestalteten Wappens der Gemeinde Frestedt ist hauptsächlich auf die besondere topographische Lage des Ortes abgestimmt. Die Ortschaft wird von einem Augraben durchquert, der die Ortsteile Weddel und Frestedt voneinander trennt. Die Lücke im Wellenbalken bezeichnet diese Trennung und soll zugleich die vorhandene Brücke andeuten, welche die Gemeindeteile ihrerseits wieder verbindet. Die besondere Form des Wellenbalkens ist auch ein Hinweis auf das Landschaftsbild der zwischen Hügeln und Niederungen gelegenen Ortschaft. Die Eichenblätter stehen nicht nur für die beiden oben genannten Ortsteile, sondern auch für den einstigen Reichtum an Eichenwäldern in dem auf der Süderdithmarscher Geest gelegenen Gemeindegebiet.
Auf grünem Wappengrund im Schildhaupt gekreuzt eine Axt und eine Haue und unten ein Eichenstumpf mit vier austreibenden Laubblättern.
Mit der Besiedlung der Landschaft wurden die Wälder gerodet und landwirtschaftlich nutzbar gemacht.
Der Ortsname Großenrade bedeutet soviel wie große Rodung und weist auf die Besiedlung dieser Landschaft hin.
Die Farbe grün symbolisiert die Bedeutung der Landwirtschaft. Der Inhalt des Wappens ist auch und vorzugsweise auf den Namen des wappenführenden Ortes abgestellt. Das Wappen zählt also zur Gruppe der "sprechenden" oder "redenden" Wappen.
Von Silber und Grün geteilt, oben - schwebend - die auf zwei Fundamentblöcken ruhende blaue Eisenbahnbrücke von Hochdonn, unten zwei an den Stielen sich kreuzende, aus jeweils einem Blatt und einer Eichel bestehende silberne Eichenzweige, zwischen diesen eine einzelne gestielte silberne Eichel.
Der Mitte des 19. Jh. auf dem Hochdonner Moor als Teil der Bauerschaft Eggstedt entstandene Ort gehörte bis 1934 zur Gemeinde Kirchspielslandgemeinde Süderhastedt. Zunächst ausschließlich von der Agrarwirtschaft geprägt, erhielt er seit 1887 durch den Bau des Kaiser-Wilhelm-Kanals neue Wirtschaftsgrundlagen. Die Einwohner verkauften Land, fanden zusätzliche Arbeit und besorgten die Unterbringung und Verpflegung der hinzukommenden auswärtigen Arbeiter. Die Erweiterung des Kanals ab 1907 bewahrte die neuen Einkommensquellen, ebenso der Bau der Hochbrücke ab 1913. Die im Wappen abgebildete, das Landschaftsbild auf weite Sicht prägende Hochdonner Eisenbahnbrücke brachte 1920 den Anschluß der Gemeinde an das Schienennetz. Die Siedlung liegt auf einer Kette flacher Binnendünen, die in vorgeschichtlicher Zeit bewaldet gewesen sein mögen. Darauf und auf die Anpflanzung im Bereich des "Hochdonner Berges" bezieht sich der Eichenzweig. Die Schildfarbe Grün zeigt, daß die Landwirtschaft für den Ort nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch heute noch weitgehend die wichtigste Erwerbsgrundlage ist.
Von Gold und Blau im Schrägstufenschnitt geteilt. Oben schräg gekreuzt eine grüne Getreideähre und ein grüner Wanderstock, unten eine aus einem Palisadenkreis bestehende silberne Burg mit offenem Tor.
Die Gemeinde Kuden liegt im Landschaftsraum zwischen der sandigen Geest und der grundwassernahen Marsch. Auf diese siedlungsgeographischen Grundlagen nehmen die Wappenfarben Gold und Blau Bezug. In ungewöhnlicher Auswahl und Kombination erscheinen zwei der drei Wappenfiguren. Der mit der die Bedeutung der Landwirtschaft symbolisierenden Getreideähre gekreuzte Wanderstab leitet sich von einer mündlich überlieferten, örtlich verbreiteten Sage her, nach der ein Mann, der sich auf Wanderschaft begeben hatte, nach seiner Rückkehr sein Heimatdorf und dessen Bewohner nicht mehr vorfand. Eine Seuche hatte diese dahingerafft, die Häuser waren zerstört. Darauf ließ der Mann sich im Gebiet von Kuden nieder und wurde damit der erste Einwohner dieses Ortes. Die Palisadenburg im Schildfuß weist auf ein möglicherweise frühmittelalterliches Bauwerk hin, das bei Grabungen im Jahre 1994 noch ohne genaues Ergebnis näher untersucht wurde. In der Bevölkerung war das Wissen um eine "Burganlage" seit langem verbreitet, da man bei Erdarbeiten regelmäßig auf fossile Hölzer stieß.
In Grün über zwei fächerförmig gestellten, an den Stielen gekreuzten silbernen Eichenblättern ein goldener Brunnen, bestehend aus Steinbecken, Säule und zwei Röhren, aus denen goldenes Wasser in das Becken fließt. Zu beiden Seiten der Brunnensäule ein silbernes Eichenblatt.
Der um eine natürliche Quelle gebaute Brunnen im Ortswappen von Quickborn ist eine bildliche Anspielung auf den Ortsnamen. Mit seiner Bedeutung "schnell sprudelnde Quelle" bezieht dieser sich auf eine natürliche Gegebenheit als Voraussetzung einer Ansiedlung. Die künstliche Einfassung kann als Symbol der Ortschaft selbst mit ihren die Naturkraft nutzenden Bewohnern verstanden werden. Unabhängig davon ordnet sich das Quickborner Wappen in die Reihe der "redenden" Wappen ein. Die Eichenblätter verweisen auf den Eichenwald, in dem die Dörfer der Umgebung durch Rodung entstanden sind. Quickborn verfügt auch heute noch über eine naturnahe Landschaft, in der die Eiche namhaft vertreten ist. Bis heute ist die Landwirtschaft der Haupterwerbszweig in dieser Gemeinde. Die Schildfarbe Grün versinnbildlicht die Natur und die überkommene bäuerliche Lebensweise.
In Blau ein barhäuptiger, bärtiger Mann (St. Michael) mit blondem Haar in goldener bäuerlicher Kleidung, der einem auf dem Rücken liegenden, rotbewehrten goldenen Drachen eine Lanze mit goldenem Schaft und einem silbernen Sensenblatt als Spitze in den Hals stößt und oben rechts von vier ins Kreuz gestellten goldenen Windmühlenflügeln begleitet wird.
Das Wappen des Ortes gibt den namengebenden Heiligen wieder, und zwar in ungewöhnlicher Kleidung und Bewaffnung, als sei er ein Angehöriger der bäuerlichen Bevölkerung Dithmarschens in der Vergangenheit. Die dem heiligen Michael geweihte Kirche wurde in den Jahren 1610 und 1611 aus den Erträgen einer Kollekte erbaut. Schon 1612 wird der Ort mit Rücksicht auf seine Lage auf dem Donn, der Dithmarscher Binnennehrung, in den Urkunden als „Niekerken upe Dunne“ oder „Karcke upm Dunnen“ bezeichnet. Im Laufe der Zeit übertrug sich der Kirchenname auf die Donnsiedlung: Sankt Michaelisdonn. Das Motiv des Wappens geht auf das alte Kirchensiegel zurück, welches den heiligen Michael im Kampf mit dem Höllendrachen zeigt. Die Windmühlenflügel vertreten die Mühle am Ort, die ein bekanntes Wahrzeichen der Gemeinde darstellt.
Das Wappen wurde von dem Brunsbütteler Heraldiker Willy „Horsa“ Lippert gestaltet.
Es wurde am 26. November 1964 genehmigt.
In Grün über zwei gekreuzten, aufrechten silbernen Schwertern drei pfahlweise gestellte silberne (heraldische) Rosen mit grünen Butzen zwischen zwei begrannten goldenen Getreideähren.
Die in der Mitte des Wappenschildes übereinander angeordneten Rosenblüten weisen auf die Kirche Süderhastedts und den Ort als frühes Zentrum eines Kirchspiels hin und heben dadurch seine Bedeutung für die kirchliche und weltliche Verwaltung hervor. Die Rosenblüten stellen ein Zitat aus dem Altarschmuck der Süderhastedter Kirche dar, die eine der ältesten des Landes Dithmarschen ist. Die gekreuzten Schwerter im Schildfuß nehmen Bezug auf den Ortsnamen, dessen zweiter Teil soviel wie "Heerstätte" bedeutet. Mit den beiden die Rosen flankierenden Kornähren wird die Bedeutung der Landwirtschaft für den Ort in Vergangenheit und Gegenwart symbolisiert.