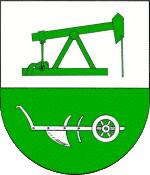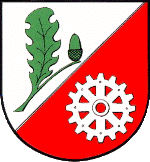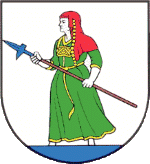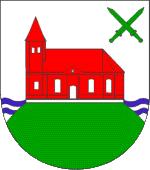Gesenkt geteilt. Oben in Silber, wachsend und schräg gekreuzt, eine an der Kreuzungsstelle zerbrochene, das holsteinische Nesselblattfähnchen tragende schwarze Lanze und eine schwarze Hellebarde, unten in Rot ein goldener Brand.
Die Figuren des Gemeindewappens nehmen auf diejenigen Begebenheiten Bezug, die allgemein mit dem Namen "Hemmingstedt" verbunden werden. Die zerbrochene Lanze und die Hellebarde erinnern, ins Kreuz gestellt, an die Schlacht bei Hemmingstedt, in der die Dithmarscher die Landesfürsten, König Johann von Dänemark und Herzog Friedrich von Schleswig-Holstein, am 17. Februar 1500 besiegten. Der goldene Brand steht für die bei Hemmingstedt gelegene Erdölraffinerie. Durch den Sieg bei Hemmingstedt konnte sich der Dithmarscher Bauernstaat noch nahezu 60 Jahre dem Zugriff der Fürstenmacht entziehen. Der Erfolg der Bauern war umso bemerkenswerter, als er gegen die militärische Überlegenheit sowohl der Söldnertruppe der "Schwarzen Garde" als auch der holsteinischen Ritter erkämpft wurde. Nicht wenige Adelsfamilien des Landes starben durch die damals erlittenen Verluste aus. In der Symbolsprache des Wappens: Die Waffe der Bauern, die Hellebarde, zerbricht die ritterliche Lanze, die zugleich die fürstliche Standarte trägt. Die Erdölraffinerie der DEA bei Hemmingstedt, im Volksmund "Hölle" genannt, verarbeitet heute, nach Versiegen der regionalen Lagerstätten, im wesentlichen importiertes Rohöl. Als eines der ältesten, vor allem aber bedeutendsten Industrieunternehmen des Landes ist es von großer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Region und für die Energiewirtschaft des Landes.
Von Silber und Grün geteilt, oben eine linksgewendete grüne Erdölpumpe, unten ein linksgewendeter silberner Pflug.
Die 1447 erstmals erwähnte Gemeinde Lieth liegt auf der Grenze zwischen Marsch und Geest, die durch die Teilung des Schildes angedeutet wird und in der Bedeutung des Ortsnamens als Anhöhe bzw. Abhang zum Ausdruck kommt. Das Gemeindegebiet wird bis heute sowohl durch die Landwirtschaft als auch durch die Erdölverarbeitung auf dem weitgehend zu Lieth gehörenden Gelände der DEA-Raffinerie von Hemmingstedt charakterisiert. Diese für Lieth bestimmenden Wirtschaftszweige werden durch die noch vorhandene "Pferdekopf-Pumpe" und den Räderpflug symbolisiert. Sie knüpfen zugleich an das Motiv des traditionellen Ehrentellers der Gemeinde an. Die Schildfarben geben die des weiten blassen Himmels und des durch die Landwirtschaft genutzten Bodens wieder.
Von Silber und Rot schräglinks geteilt. Oben ein grüner Eichenzweig mit einem Blatt und einer Eichel, unten ein achtspeichiges, sechzehnzähniges silbernes Maschinenrad.
Im zweigeteilten Wappen sind die beiden Ortsteile vertreten. Der Ortsteil Lohe bezeichnet eine lichte Waldung oder einen feuchten Hain. Im Hinblick auf diese Deutung des Ortsnamens steht der Eichenzweig im Wappen. Beide Orte entstanden als Ansiedlungen am bewaldeten Rand der Geest. Der Ortsteil Rickelshof wird durch ein Maschinenrad symbolisiert, da schon im 19. Jahrhundert eine Eisengießerei und Maschinenfabrik im Ort ansässig war.
Über grünem Schildfuß, darin ein silbernes Wollgras, in Gold die rote Neuenkirchener Kirche.
Die Kirche der Gemeinde Neuenkirchen wird im Jahr 1323 erstmals urkundlich erwähnt. Sie wurde von den Dithmarscher Siedlungsge- geschlechter der Hödienmannen und der Tödienmannen dem heiligen Jakobus dem Älteren zu Ehren gegründet.
Anfang des 14. Jahrhunderts wurde Neuenkirchen selbständiges Kirchspiel. Bis dahin gehörte es zu Wesselburen. In den Jahren 1704 sowie 1729 brannte das Kirchenbauwerk völlig nieder.
Die wechselvolle Geschichte, aber auch die Ableitung des Ortsnamens „Neuenkirchen“ = „zur neuen Kirche“ (Laur ’92) hat dazu geführt, das Kirchenbauwerk als Hauptfigur in das Gemeindewappen aufzunehmen.
Das Wollgras im Schildfuß weist auf das „Weiße Moor“ hin, ein in dieser Landschaft seltenes ausgedehntes Hochmoor, das zum überwiegenden Teil im Gemeindegebiet von Neuenkirchen liegt.
In Silber eine mit einer gefällten Hellebarde bewaffnete, mit bloßen Füßen in niedrigem Wasser watende Frauengestalt in Altdithmarscher Tracht mit goldgesäumtem, golden gegürtetem grünen Rock mit reicher goldener Brustverzierung und roter, mit einem breiten goldenen Knopfband verzierter Kagel.
Das Wappen geht zurück auf einen Entwurf des Hamburger Kunstmalers Oskar Schwindrazheim aus dem Jahre 1901 und thematisiert ein nur als Sage überliefertes, möglicherweise aber historisches Ereignis der Lokalgeschichte. Wie die meisten Gemeinden Süderdithmarschens stiftete die Kirchspielslandgemeinde Nordhastedt 1901 ein Wappenfenster für das neue Kreishaus in Meldorf. Zu diesem Zweck wurde das heraldische Motiv der heldenhaften Frau neu geschaffen, da vorher ein Wappen nicht existierte. Die Kirchspielslandgemeinde führte seit diesem Zeitpunkt das Bild des Wappenfensters inoffiziell als Wappen. Mit der gesetzlichen Anerkennung der Wappenfähigkeit der Landgemeinden wurde das Bildzeichen 1949 als Wappen nunmehr der Gemeinde Nordhastedt offiziell genehmigt. Da dessen Form nicht ganz befriedigte, wurde es 1990 heraldisch überarbeitet. Die Frauengestalt im Wappen bezieht sich auf eine örtliche Sage: In alter Zeit war das Gebiet um Nordhastedt von undurchdringlichen Wäldern umgeben. Diesen natürlichen Schutz nutzten Räuber als Versteck und versetzten von dort aus die umliegenden Dörfer in Angst und Schrecken. Bei einem Überfall auf Nordhastedt stellten sich jedoch die Frauen des Ortes den Räubern entgegen und schlugen sie mit Breitöpfen, Wasserkrügen und anderen häuslichen Geräten in die Flucht. Zu Ehren dieser tapferen Frauen wurde die Frauenfigur in Altdithmarscher Tracht und mit gefällter Hellebarde zum alleinigen Motiv des Gemeindewappens erhoben. Die Sage von den tapferen Nordhastedter Frauen wird seit langer Zeit durch das alle drei Jahre stattfindende Dorffest "Frunsbeer" am Leben erhalten.
In Silber ein rechts von einem grünen Eichenblatt, links von einer grünen Ähre begleiteter, unten einen beblätterten schwarzen Rohrkolben einschließender roter Sparren.
Die Gemeinde Ostrohe liegt zwischen den Landschaftsarten Wald und Moor. Bei dem Wald handelt es sich um den Erholungswald "Behnke-Forst" im Nordwesten der Gemeinde, bei dem Moor um das Landschaftsschutzgebiet "Ostroher/Süderholmer Moor" im Süden und Südosten der Gemeinde. Beide Landschaftsformen sind so ausgeprägt, daß sie auch eine überörtliche Bedeutung haben, was mit den förmlichen Verordnungen dokumentiert wird. Das Eichenblatt symbolisiert den Wald. Durch die Lage links (heraldisch rechts) im Wappen wird zugleich nach geographischen Gepflogenheiten die Himmelsrichtung Westen dargestellt. Der Rohrkolben symbolisiert das Moor. Seine Größe weist auf die Tatsache hin, daß es sich nach der Aussage des Entwurfes des Landschaftsrahmenplanes für das Gebiet der Kreise Dithmarschen und Steinburg um den größten zusammenhängenden Niedermoorkomplex des Planungsraumes handelt. Die Stellung im unteren Teil des Wappens drückt die südliche Lage aus.
Die Gemeinde hatte von jeher weit überwiegend eine Agrarstruktur. Durch ihre Stadtrandlage zu Heide und ihre landschaftliche Attraktivität, die sich aus der Nähe zum Wald und zum Moor ergibt, wurde die Agrarfunktion durch eine überwiegende Wohnfunktion abgelöst. Diese Funktionszuweisung findet ihren Niederschlag im Regionalplan für den Planungsraum IV. Die Agrarfunktion wird durch die Getreideähre symbolisiert. Die Wohnfunktion wird durch den Sparren dargestellt. Die historische Entwicklung der Funktion der Gemeinde wird dadurch ausgedrückt, daß die Getreideähre in kleiner Ausführung dargestellt wurde und der mächtige Sparren das gesamte Wappenfeld durchzieht. Wohnfunktion.
Geviert von Grün und Silber mit aufgebogener Teilungslinie; in vertauschten Farben überdeckt oben mit einem Bauernhaus (Frontalansicht), unten mit zwei auswärts weisenden, an den Stielen sich kreuzenden, aufrechten Eichenblättern.
Die Gemeinde Stelle-Wittenwurth liegt am Rande der schleswig-holsteinischen Marschlandschaft auf dem Rücken einer Dünenkette, die sich als ehemalige Uferzone der Nordsee bis in das südwestliche Schleswig-Holstein hineinzieht.
Auf dieser „weißen, sandigen Wurth“ bauten die ersten Siedler, geschützt vor den Fluten der Nordsee, ihre ersten Behausungen, die ebenso wie das umgebende, dem Meer abgewonnene Marschland über die Jahrhundert landwirtschaftlich geprägt waren.
Die senkrechte Wappenteilung mit dem doppelten Farbwechsel zwischen Silber und Grün symbolisiert die erdgeschichtlich bedeutsame Situation zwischen dem Meer und dem Festland. Ein giebelständiges, in dieser Region typisches Bauernhaus auf einer leichten Anhöhe (Wurth) bezieht sich auf den Ortsnamen Wittenwurth.
Die gekreuzten Eichenblätter weisen darauf hin, dass hier am Rande der Marsch ehemals ausgedehnte Eichenmischwälder standen.
Geteilt von Rot und Silber. Oben ein durchgehendes silbernes Andreaskreuz, unten eine blaue Waage.
Weddingstedt liegt in einer der vorkarolingischen Siedlungskammern Dithmarschens, die von alters her verkehrsgünstig zu erreichen und militärisch besonders gesichert waren, wie die benachbarte Stellerburg, ein sächsischer Ringwall, bezeugt. Weddingstedt zählt zu den vier "Urkirchspielen" Dithmarschens die als Keimzellen der späteren Wehr-, Gerichts-, Kult- und Verwaltungskreise der Landschaft anzusehen sind. Neben Funden aus vor und frühgeschichtlicher Zeit stellt die Kirche, auch wenn sie erst im Jahre 1140 in einer Urkunde des Bremer Erzbischofs Adalbero genannt wird, ein herausragendes Zeugnis früher Besiedlung dar. Die Kirche ist dem heiligen Andreas geweiht. Das Andreaskreuz symbolisiert die Bedeutung der Kirche für den Weddingstedter Raum, von dem aus auch die Erschließung der westlich vorgelagerten Marsch mit getragen wurde.
Im Mittelalter entwickelte sich Dithmarschen zu einer "föderativen Republik der Kirchspiele“, die das öffentliche Leben des Landes in der Rechtspflege, der Verwaltung und der Wirtschaft ebenso prägten wie das Wehrwesen und die Politik. Zu diesen weitgehend autonomen Teilbezirken zählte auch das Kirchspiel Weddingstedt, dessen führender Beamter, der "Schlüter", die Dithmarscher Landesversammlungen im benachbarten Landesvorort Heide zu eröffnen hatte. Bei der Ungeschiedenheit von Rechtsprechung und Verwaltung besaßen die Kirchspielsgerichte über ihre eigenen Grenzen hinaus besonderes Gewicht. Die Waage symbolisiert die Bedeutung Weddingstedt als Ort der Gerichtsbarkeit vom Mittelalter bis in das 19. Jahrhundert.
Die ausgewählten Farben entsprechen denen des Landes.
Unter blauem Wellenschildhaupt in Gold ein grüner Hügel, darüber drei bewurzelte grüne Laubbäume in der Stellung 1:2.
Die Gemeinde Wesseln erstreckt sich sowohl über Marsch- als auch über Geestflächen. Bis in den Bereich, in dem sich heute die Marsch befindet, erstreckte sich früher die Nordsee. Die blaue Fläche im oberen Teil des Wappens mit der wellenförmigen Abgrenzung symbolisiert die Nordsee bzw. die heutige Marsch. Die Bäume im unteren Teil symbolisieren die Geest. Damit wird die Lage der Gemeinde auf der Scheide zwischen Marsch und Geest verdeutlicht. Der Hügel stellt den vorgeschichtlichen Grabhügel "Rugenberg" dar, das bedeutendste Zeichen einer vorgeschichtlichen Besiedlung des Gemeindegebietes.
In Silber ein grüner Hügel, darauf eine rote Kirche mit silbernem Sockel, zwei schmale blaue Wellenbalken überdeckend. Oben links zwei gekreuzte grüne Schwerter.
Der grüne Hügel soll auf den Namen der Gemeinde hinweisen, der von Wurt - Aufschüttung von Erdreich in Feuchtgebieten zum Zweck der Besiedlung - abgeleitet wird. Die rote Kirche soll auf die wichtige Funktion des Ortes als Zentrum eines Kirchspiels und die wichtige Rolle der Kirche im Freiheitskampf der Dithmarscher Bevölkerung im Jahre 1319 hinweisen. Die blauen Wellenbalken stehen für die frühere Lage der Gemeinde am Wasser und den ehemaligen Hafen, sowie die Nähe der Gemeinde zur Nordsee in der jetzigen Zeit. Die grünen, gekreuzten Schwerter sollen die Bedeutung der Gemeinde während des Freiheitskampfes der Dithmarscher 1319 und 1500 symbolisieren. Für das Gemeindewappen wurden die Farben Silber und Grün festgelegt. Während Silber aus ästhetischen Gründen gewählt wurde, steht die Farbe Grün für die in der Gemeinde vorwiegend betriebene Landwirtschaft und weist außerdem auf die Marschlandschaft hin, in der die Gemeinde liegt. Die Farben Rot und Blau stehen für die gewählten Figuren.