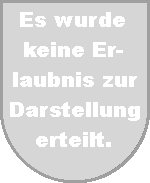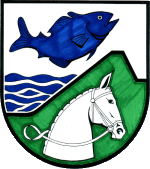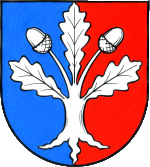Von Silber und Grün nach Maßgabe des Profilschnitts eines Deiches geteilt. Oben ein linksgewendeter springender blauer Fisch (Köhler), unten ein aufgezäumter silberner Pferdekopf. Vor der flachen Kante des Deichprofils blau-silberne Wellen.
Das ungewöhnliche Wappenbild vermittelt einen Eindruck von der Topographie und der Erwerbssituation der Gemeinde Seester, bis 1991 noch Kurzenmoor, in Vergangenheit und Gegenwart. Die Gemeinde Kurzenmoor, oder wie sie Mitte des vorigen Jahrhunderts noch amtlich hieß, "Kortenmoor" wurde 1871 aus dem gleichnamigen Dorf, dem Kirchdorf Seester und den Wohnplätzen Sonnendeich und Seesteraudeich gebildet. 1991 nahm sie den Namen des seit dem 15. Jh. bestehenden Kirchspiels (Seester) an. Die Lage des Ortes an der Krückau, einem Nebenfluß der Elbe, hat das Leben der Bewohner maßgeblich bestimmt. Die Errichtung von Flußdeichen ermöglichte neben der Nutzung der Geest auch diejenige der Marsch. Dadurch wurde bis heute in größerem Umfang Viehhaltung möglich, nicht zuletzt die traditionelle Zucht der Holsteiner Pferde, auf die der Pferdekopf im Wappen hinweist. Der blaue Köhler, besser als Seelachs bekannt, bezeugt im Wappen einen regen Fischfang als Nahrungsquelle. Schließlich weist der Deich unter den Wellen auf dessen Schutzfunktion, aber auch auf das gefährliche Leben hinter den Deichen. Der Deich, hier durch die ungewöhnliche Teilungslinie im Profilschnitt dargestellt, ermöglichte erst die Ansiedlung in den Marschniederungen. Die immer weiter in die Flußniederung vorgeschobene Deichlinie spiegelt sich heute in den Straßenbezeichnungen wider, die den alten Deichnamen entsprechen. Die Farbgebung bezieht sich mit Blau und Silber auf den Bereich jenseits und mit Grün und Silber auf den Bereich diesseits des Deiches.
Das Wappen wurde am 25.5.1990 genehmigt. Entwurfsverfasser war Körner, Seester.
Quelle: Die Beschreibung (Blasonierung) und Erläuterung des Wappens wurde der Kommunalen Wappenrolle des Landesarchivs Schleswig-Holstein (www.schleswig-holstein.de) entnommen.