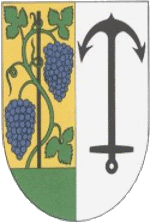In gespaltenem Schild vorn in Rot ein gerauteter silberner Schräglinksbalken, hinten in Gold ein schwarzer Balken.
In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts kam der Ort, der damals Reichslehen war, von dem bischöflich baselschen Rittergeschlecht der Schaler an die ursprünglich aus der Schweiz stammende Familie von Rotberg. Die Schaler sind schon im 12. Jahrhundert nachweisbar und erloschen um 1450 im Mannesstamm. Sie führten ihren Namen auf ihren Hof „zur Leitern“ (Scalarii = Schaler) in Basel zurück. Ihr Wappen: In Rot ein geweckter (=gerauteter) Schrägrechtsbalken. Wappen derer von Rotberg: In Gold ein schwarzer Balken.
1895 wünschte der Gemeinderat ein der Geschichte des Dorfes entsprechendes Wappen. So schuf das Generallandesarchiv eine Kombination, die vorn das abgewandelte Wappen der Schaler und hinten dasjenige derer von Rotberg zeigt. Das historisch begründete Wappen spiegelt die einstigen Besitzverhältnisse wieder.
In Gold auf grünem Schildfuß ein blaugekleideter, bärtiger Landsknecht mit blauer Mütze, roter Weste, roten Strümpfen und schwarzen Schuhen, in der erhobenen Rechten ein rotes Schwert, die Linke in die Seite gestemmt.
In Bellingen hatten einst mehrere Klöster Besitz, so auch die Benediktinerabteien Muri (Schweiz), Murbach (Elsaß) und St. Blasien. Auch Basler Domherren waren hier begütert. 1337 wurde der einem elsässischen Adelsgeschlecht entstammende Friedrich vom Haus mit Bellingen belehnt. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts kam der Ort durch Heirat an die Familie derer von Andlau. Die Landesregierung hat ihm 1969 die Bezeichnung „Bad“ verliehen.
Der Landsknecht ist als Siegelbild seit 1811 nachweisbar. Das dem Vollmachtsformular zur Gemeindehuldigung für Großherzog Karl aufgedrückte Lacksiegel lässt die Figur in einem runden Schild sehen, auf dem ein Helm mit Helmdecken und einem Landsknechtstrumpf als Helmzier ruht. Nach der Bekräftigungsformal der Urkunde von 1811 August 11 handelt es sich um das Gemeindesiegel. Die später verwendeten Farbstempel – nunmehr mit sie als Gemeindesiegel ausweisender Umschrift – sind dem Siegel von 1811 ähnlich. 1904 hatte das Wappen vom Generallandesarchiv unter Farbgebung die abgebildete Form erhalten. 1966 wurde die bis dahin spitze Mütze durch eine flache ersetzt. Über die Herkunft und die Bedeutung des Landsknechtes hat sich nichts geschichtliche Belegbares ermitteln lassen.
In Blau ein zunehmender goldener Mond mit Gesicht über drei balkenweise gestellten goldenen Sternen.
Ein W. der Hertincheim wird 1234 genannt. 1503 fiel Hertingen mit der Herrschaft Sausenburg an Markgraf Christoph I. von Baden. Bis 1773 besaßen es die Freiherren von Rotberg als markgräflich badisches Lehen. Sie verkauften das Dorf für 20.000 Gulden an die Markgrafen Karl Wilhelm von Baden-Durlach.
Mond und Sterne wurden schon im 19. Jahrhundert von der Gemeinde im Siegel geführt. Im Jahr 1906 setzte das Generallandesarchiv die Figuren unter Farbgebung in einen Schild. Im gleichen Jahr hatte die Gemeinde das Wappen angenommen. Ob es sich bei den Bildern um ein altes Dorfzeichen handelt, hat sich nicht feststellen lassen.
In gespaltenem Schild vorn in Gold auf grünem Schildfuß an schwarzem Stecken ein grüner Rebstock mit beiderseits einer blauen Traube und rechts einem, links zwei Blättern, hinten in Silber ein gestürzter schwarzer Anker.
Kolb spricht von einem örtlichen Adelsgeschlecht, aber ohne Zeit- und Quellenangabe. Mehrere Klöster hatten in Rheinweiler Güter und Rechte, zum Beispiel St. Alban zu Basel, St. Ulrich an der Möhlin und St. Blasien. Dies war einer der größten Grundbesitzer im Ort. Wie Bamlach war auch Rheinweiler Reichslehen in der Hand des bischöflich baselschen Rittergeschlecht der Schaler und wurde in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts von den Herren von Rotberg erworben. 1861 schreibt Carl Gustav Fecht: „Die Einwohner, welche nicht besonders bemittelt sind, ernähren sich von Feld- und Weinbau, Viehzucht, Fischerei und Rheinschifffahrt.
Schon im 19. Jahrhundert finden wir das Siegel der Gemeinde mit Rebstock und Anker in gespaltenem Schild. Das Generallandesarchiv hatte 1904 das Wappen neu gestaltet und die Farben festgelegt. Die Bildsprache ist eindeutig.