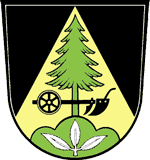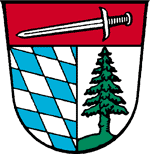In Schwarz eine durchgehende silberne Spitze, darin auf grünem Dreiberg, der mit drei silbernen Eschenblättern an einem Stiel belegt ist, eine grüne Tanne, deren Stamm mit einem waagrechten schwarzen Pflug überdeckt ist.
Für das Gemeindegebiet historisch bedeutsam war vor allem die Hofmark Ascha als Niedergerichtsbezirk. Hierbei gehörte Ascha als Hofmark unter die Herrschaft von Falkenfels. Inhaber dieser Hofmark waren in der Zeit von 1609 bis 1791 die Freiherrn von Weichs, deren Wappen, eine silberne Spitze, die heraldische Grundkomponente des Gemeindewappens bildet. Auf schwarzem Hintergrund ist dort eine durchgehende silberne Spitze dargestellt, darin steht auf einem grünen Dreiberg, der mit drei silbernen Eschenblättern an einem Stiel belegt ist, eine grüne Tanne.
Die grüne Tanne auf einem Dreiberg, dem Gallner, verdeutlicht die geographische Lage der Gemeinde im Bayerischen Wald sowie die bei der Ortsgründung durchgeführte Rodungstätigkeit, die noch im Ortsteilnamen Gschwendt zum Ausdruck kommt. Quer zum Stamm des Baumes befindet sich ein waagrechter schwarzer Pflug. Der Pflug im Wappen weist auf die Rodungen und auf die vorwiegend landwirtschaftliche Struktur der Gemeinde hin. Darüberhinaus soll er die historische Verbindung des Gemeindegebietes mit der Stadt Straubing verdeutlichen, da auch sie einen Pflug im Wappen führt. Als „redender“ Bestandteil des Wappens sind drei Eschenblätter aufgenommen worden. Der Name Ascha ist auf das Althochdeutsche Ask, was so viel wie Esche bedeutet, zurückzuführen.
1399 wurde der Ort Asach genannt, 1465 Aschah geschrieben.
Erst in nachbajuwarischer Zeit wurde der Nordwald durch gezielten Landanbau erschlossen. Die Bajuwaren standen von Anfang an unter der Herrschaft eigener Herzöge aus dem Hause der Agilolfinger. Diese beschenkten und beliehen ihre Gevolksmannen mit Gütern und unkultiviertem Land zur Urbarmachung und Besiedelung. Im engeren Raum von Ascha traten als Kolonisatoren hauptsächlich die Geschlechter der Domvögte von Regensburg und der Grafen von Bogen auf. Vieles deutet auch darauf hin, dass die Ortschaften Herrnberg und Kienberg große Klosterhöfe waren, nachdem das Kloster Oberalteich auch für die Besiedelung des Raumes von großer Bedeutung war. Die Gründung von Ascha lässt sich nicht genau festlegen. Die erste urkundliche Erwähnung von „Aska“ und „Geswende“ ist um das Jahr 1200 belegt.
In Silber über rotem Zinnenschildfuß mit drei Zinnen eine gestürzte schwarze Spitze, darin ein auffliegender goldener Falke.
Für die historische Entwicklung des Gemeindegebietes war die Burg Falkenfels, entstanden im 12. Jahrhundert, von überragender Bedeutung. Sie befand sich zunächst im Besitz der Grafen von Bogen. dann im späten Mittelalter im Besitz der Falkensteiner von Falkenfels. die im 14. Jahrhundert als niederbayerischer Landstand genannt werden. Ihr Wappentier, der Falke, bildet den optischen Mittelpunkt des neuen Gemeindewappens. Die schwarze Spitze ist dem Wappen der Weichser zu Weichs entnommen, die von 1609 bis 1791 als Besitzer der Burg nachweisbar sind. An die Burg selbst erinnert der Zinnenschildfuß. Die Tingierung Silber und Rot soll auf weitere Inhaber der Burg, die Paulsdorfer und Seyboldsdorfer hinweisen. Beide Geschlechter führen Wappen in dieser Tingierung. Die Farben der Gemeindefahne sind Rot - Gelb - Rot. Die Burg ist noch relaliv gut erhalten. Der mächtige Bergfried, der aus unregelmäßigen Quadern errichtei ist, stammt aus dem 13. Jahrhundert.
Von der Burg hat man einen herrlichen Rundblick auf die Donauebene und die Vorberge des Bayerischen Waldes. Eine Besonderheit ist der Titel des Ortsgeistlichen, nämlich „Sacellan“. Der Sacellan war früher der Burggeistliche und hat jetzt die Rechte und Pflichten des Pfarrers einer selbständigen Pfarrei (Sacellanie).
In Blau unten eine silberne Friedhofkapelle mit beiderseits anschließender Mauer, darüber gekreuzt ein goldener Abtstab und ein silberner Schlüssel.
Schon um das Jahr 1130 ist ein Pfarrer in Haselbach nachweisbar. Graf Albert IV. von Bogen übertrug 1225 die Patronatsrechte dem Kloster Oberalteich. Diese Schenkung wurde 1232 erneuert. Von 1600 ins 19. Jahrhundert betreuten Vikare des Klosters Oberalteich die Pfarrei. Hinter der jetzigen Pfarrkirche steht die wertvolle Totentanzkapelle, die um 1670 vom Oberalteicher Prior Balthasar Regler erbaut wurde. Dieser war von 1667 bis 1673 Pfarrvikar in Haselbach und Verfasser der Geschichte des Bogenberges. Das Innere ist mit Totentanzdarstellungen nach dem Vorbild von Hans Holbein, dem jüngeren geschmückt. Die Kapelle ist eine sehr interessante Spätrenaissance-Anlage. Die jetzige Pfarrkirche wurde um 1713 erbaut und ist eine einfache Spätbarock-Anlage.
Das Wappen aus dem Jahre 1957 zeigt die Friedhofskapelle in heraldischer Vereinfachung. Darüber gekreuzt Abtstab und Schlüssel, entnommen aus dem Wappen von Oberalteich. Die in Blau und Weiß gehaltenen Farben wurden dem Stammwappen der Grafen von Bogen entliehen. Die Gemeindefahne hat die Farben Blau - Silber - Blau. Im Zuge der Gebietsreform wurde die ehemalige Gemeinde Dachsberg nach Haselbach eingemeindet.
Heute präsentiert sich die Gemeinde Haselbach als bäuerlich-gewerblich strukturierte Kommune mit guten Wohnmöglichkeiten.
Unter rotem Schildhaupt, darin ein schrägliegendes Schwert, gespalten; vorne die bayerischen Rauten, hinten in Silber eine grüne Tanne auf grünem Hügel.
In Mitterfels war im frühen Mittelalter der Sitz der Ministerialen der Grafen von Bogen. In einer Urkunde des Klosters Oberalteich von 1194 wird ein Bertholdus de Mitterfels erstmalig erwähnt. Nach dem Aussterben der Grafen von Bogen (1245) fällt die Grafschaft an die bayerischen Herzöge. Diese erheben Mitterfels zu einem Pflegegericht. Das spätere Landgericht umfaßte ein Gebiet mit 46 Klöstern, Herrschaften und Hofmarken. Die Burg Mitterfels, einst eine stolze und feste Anlage, beherbergte in ihren Mauern eine Hauptmannschaft für die Landesverteidigung. Auf einer Landtafel aus dem Jahre 1429 ist sogar von zwei Burgen die Rede. Im 30jährigen Krieg fiel die Festung in die Hände der Schweden. Hundert Jahre später wehrt sie mehrmalige Angriffe der Panduren ab. Der Hauptturm stürzte 1812 ein. Heute stehen noch einige Ringmauern mit ihren Rundtürmen, das Pflegerhaus, Teile des Zwingers und Reste des Wehrganges. Die Landrichter hielten strenges Gericht, auch Hinrichtungen wurden durchgeführt. Mit der Neugestaltung der bayerischen Verwaltung erfährt das Landgericht 1861 seine Auflösung. Geblieben ist bis 1973 das Amtsgericht Mitterfels.
Schon 1224 stand eine Kirche in Mitterfels, das zum Kloster Oberalteich gehörte. Das alte Gotteshaus St. Georg wurde 1733 erbaut. Nach 1803 wurde Mitterfels zur selbständigen Pfarrei. Seiner Lage nach nennt man den Ort „das bayerische Jerusalem“.
Auf die historischen Verhältnisse weist das Wappen von 1957 hin. Die Rauten sind die Farben der Grafen von Bogen; das Schwert ist das Symbol der Hochgerichtsbarkeit; die Tanne auf dem Hügel veranschaulicht die Lage auf einem Rücken des Bayerischen Waldes.