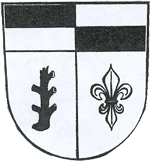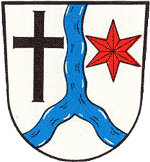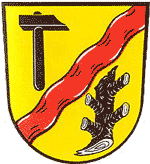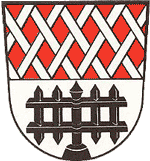Unter einem von Silber und Schwarz gevierten Schildhaupt, gespalten von Rot und Gold, vorne eine silberne Lilie, hinten ein aufrechter gestümrnelter schwarzer Ast.
Im Schildhaupt erinnert das gevierte Zollerwappen daran, daß die Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth die Landesherren waren. Die (heraldisch) Lilie auf rotem Grund versinnbildlicht die Ortsgründung durch den Grafen Berengar von Sulz bach (+ 1125).
Die Farben Schwarz und Gold und der gestümmelte Baumast sind dem Stammwappen der Herren von Schirnting (Schirnding) auf Röthenbach entnommen, in deren Besitz sich als Nothaftisches Lehen seit ca. 1350 Ort und Flur von Bergnersreuth befanden.
Ein nach den Regeln der Heraldik gestaltetes Wappen für die ehemalige Gemeinde Bergnersreuth wurde nach der Gebietsreform von 1977 überflüssig, noch bevor um ministerielle Genehmigung nachgesucht wurde.
Dieses Wappen wurde von Dr. Singer entworfen und beschrieben.
In Silber ein gestürztes blaues Deichselkreuz mit gewellten Balken; rechts ein schwebendes schwarzes Tatzenkreutz, links ein sechstrahliger roter Stern.
Die in der heraldischen Fachsprache besser „Göpel“ genannte Figur versinnbildlicht den Zusammenfluß von Röslau und Eger im Ort.
Das schwarze Kreuz des Deutschen Ritterordens soll an die überwiegende Herrschaft der Kommende Eger dieses Ordens über das heute zur Gemeinde zählende Dorf Oschwitz bis zum Ende des 17. Jahrhunderts erinnern, der Stern als Abzeichen des Kreuzherrenordens an dessen Mitherrschaft über Fischern von der Kommende Eger aus.
Ministerielle Zustimmung zur Wappenaufnahme vom 16. August 1962.
(Fischern steht für den jetzigen Ortsteil Oschwitz)
Über goldenem Schildfuß, darin ein waagrechter gestümmelter schwarzer Ast, in Blau ein wachsendes, rot bezungtes silbernes Einhorn.
Der verkohlte Ast im Schildfuß als Symbol der Rodung bezieht sich auf den Namen des Ortes und seine Entstehung in neu gerodetem Gebiet, die wahrscheinlich von den Grafen von Sulzbach veranlaßt wurde. Als Bestandteil des Stammwappens der Freiherren von Schirnding erinnert er zugleich an dieses Geschlecht,. das von 1739 bis 1817 das Rittergut Grafenreuth besaß. Das wachsende Einhorn ist der ursprünglichen Schildfigur der Herren von Gravenreuth nachgebildet, die 1180 mit einem Wernherus de Gravinriuth urkundlich faßbar werden. Die heute in Affing bei Augsburg ansässige freiherrliche Familie hatte das vom Reich und später von den zollerischen Burggrafen von Nürnberg zu Lehen gehende Gut als Stammsitz bis zum Verkauf 1738 inne. Die Farben Silber und Schwarz im Gemeindewappen sollen auf die Wappenfarben der Markgrafen von Brandenburg-Bayreuth anspielen, in deren Territorium bis 1791 Grafenreuth lag.
Ministerielle Zustimmung zur Wappenaufnahme vom 05. September 1961. (Grafenreuth steht für den jetzigen Ortsteil Garmersreuth)
In Gold ein roter Schräglinksbach, darüber ein senkrecht gestellter schwarzer Bergmannshammer, darunter ein stehender, gestümmelter schwarzer Baumast.
Der rote Bach versinnbildlicht den Ortsnamen. Auf den einst sehr bedeutsamen Bergbau im Gebiet der heutigen Gemeinde verweist der Hammer. Im 18. Jahrhundert waren in Röthenbach laufend vier bis sechs Zechen in Betrieb, und noch 1822 gab es im engsten Umkreis elf Eisenerzzechen. Der für diese Gegend des Fichtelgebirges typische alte Wirtschaftszweig kam um die Mitte des vorigen Jahrhunderts zum Erliegen und wurde insbesondere durch die Textilfabrikation abgelöst. Die Farben Schwarz und Gold und der verkohlte Baumast sind dem Stammwappen der Herren und nachmaligen Freiherren von Schirnding entnommen. Das Geschlecht erscheint mit Besitz in der Ortsflur schon anläßlich der ersten urkundlichen Erwähnung Röthenbachs 1361. Zu seinem Rittergut gehörten die gesamten Dörfer Röthenbach und Bergnersreuth. Seit 1482 besaßen die Schirndinger auch den Blutbann in ihrem ausgedehnten Herrschaftsbereich. Bis in das vorige Jahrhundert erhielt sich die enge Verflechtung der Familie mit der Gemeinde. Das Schloß ist einer der ganz wenigen noch erhaltenen Adelssitze im Sechsämterland. Zur Unterscheidung von dem Wappen der Gemeinde Schirnding wurde für Röthenbach nur einer von den drei gestümmelten Ästen im Adelswappen verwendet. Die Gemeindefahne zeigt zwei Streifen in den Farben Rot und Gelb.
Ministerielle Zustimmung zur Wappenaufnahme vom 19. Dezember 1953.
In Silber ein bärtiger Bauer in der Tracht des Sechsämterlandes mit hohem schwarzen Spitzhut, schwarzer Hose, schwarzen Hosenträgern und Pantoffeln, rotem Wams, silbernen Strümpfen und silbernen Hemd, in der Linken eine schwarze Mistgabel haltend.
Das Gut gehörte nach den Liebensteinern von 1298 ab dem Stift Waldsassen und wurde später ein ansehnliches Rittergut in häufig wechselnden Lehenbesitz adeliger Familien. Der Typus des bäuerlichen Hintersassen ist in reizvoller Weise in der Granitfigur von 1751 eines bärtigen Landmannes mit der Mistgabel verkörpert, die auf einem Brunnen im Schlottenhofer Schloßgarten steht. Die 85 cm hohe Vollplastik im Stil des späten Rokoko mit Resten der ursprünglichen Bemalung ist zugleich ein wichtiges Denkmal der Egerländer Tracht aus alter Zeit. Das als Wahrzeichen des Ortes angesehene und volkstümlich „Brunnenwastl“ genannte Männlein ist jetzt zum Wappenbild der Gemeinde geworden. Den Hauptfarben Schwarz und Weiß des Wappens entspricht die Farbenfolge in der Gemeindefahne, die mit ministerieller Zustimmung vom 2. August 1962 angenommen wurde.
Ministerielle Zustimmung zur Wappenaufnahme vom 12. Juli 1961.
Geteilt von Rot und Silber; oben ein stehendes Leistengitter, unten ein schwarzes Drehkreuz.
Die Gemeinde Seußen hat bisher kein eigenes Wappen geführt. Die Annahme eines eigenen Wappens wurde vom Gemeinderat am 11. August 1964 beschlossen.
Die Gemeindemarkung gehörte im Mittelalter zum Reichsgutsbezirk um Eger, dem sog. Egerland. Dies wirkte sich im Grundherrschaftsbereich noch aus, als das Gebiet um die Wende des 14. zum 15. Jahrhundert unter die Landeshoheit der Zollerischen Burgrafen von Nürnberg kam; denn bis in das 19. Jahrhundert waren Burg, Stadt und Kreuzherrenkommende Eger in Seußen begütert. Die mittelalterliche Besiedlung ging unter der Führung der Egerer Grundherren vor sich, von denen das Reichministerialengeschlecht der Hertenberger ganz besondere Erwähnung verdient.